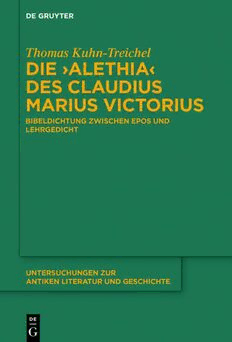Table Of ContentThomas Kuhn-Treichel
Die Alethia des Claudius Marius Victorius
Untersuchungen zur antiken
Literatur und Geschichte
Herausgegeben von
Marcus Deufert, Heinz-Günther Nesselrath
und Peter Scholz
Band 123
Thomas Kuhn-Treichel
Die Alethia
des Claudius
Marius Victorius
Bibeldichtung zwischen Epos und Lehrgedicht
ISBN 978-3-11-050125-4
e-ISBN (PDF) 978-3-11-051633-3
e-ISBN (EPUB) 978-3-11-051553-4
ISSN 1862-1112
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2016 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen
♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier
Printed in Germany
www.degruyter.com
Vorwort
Das vorliegende Buch ist die leicht überarbeitete Fassung meiner Dissertation,
die im Wintersemester 2015/16 von der Philosophischen Fakultät der Georg-
August-Universität Göttingen angenommen wurde. Der Anhang der Dissertati-
on, eine vollständige deutsche Übersetzung der Alethia, wird gesondert in den
Fontes Christiani erscheinen.
Gerne möchte ich all denen meinen Dank ausdrücken, die zum Entstehen
dieses Buches beigetragen haben: Mein erster Dank gilt meinem Doktorvater
Prof. Dr. Heinz-Günther Nesselrath, der mich bei der Arbeit an der Dissertation
und darüber hinaus stets umfassend gefördert hat. Ebenso herzlich danken
möchte ich meinem Zweitbetreuer Prof. Dr. Marcus Deufert, der mich durch
Gespräche und Korrekturen zuverlässig unterstützt hat. In tiefer Dankbarkeit
verbunden bin ich überdies Dr. Rolf Heine, der mich auf Claudius Marius
Victorius aufmerksam gemacht hat und mir bei der Übersetzung, wie schon so
oft, eine treue Hilfe war. Danken möchte ich ferner den Leitern und Teilneh-
mern der Doktorandenkolloquien in Göttingen und Köln sowie des Obersemi-
nars in Leipzig, in denen ich Probleme aus meiner Arbeit vorstellen und disku-
tieren konnte.
Großen Dank schulde ich auch der Studienstiftung des deutschen Volkes,
deren Promotionsstipendium mir ein schnelles und ungestörtes Arbeiten er-
möglicht hat. Für die Aufnahme in die Untersuchungen zur antiken Literatur und
Geschichte sei außer den Professoren Nesselrath und Deufert auch Prof. Dr.
Peter Scholz gedankt, für die kompetente herstellerische Betreuung dem Verlag
De Gruyter und namentlich Florian Ruppenstein und Katharina Legutke. Zu
guter Letzt danke ich meinen Korrekturlesern Jörg von Alvensleben, Matthias
Götte, Felix Heinz und Anna-Maria Nogrady. Für alle verbleibenden Fehler
übernehme selbstverständlich ich allein die Verantwortung.
Gewidmet sei dieses Buch meiner Frau Amöna, die sein Werden von Beginn
an begleitet hat und durch alle Phasen hindurch mit mir geteilt hat.
Leipzig, im Juli 2016 Thomas Kuhn-Treichel
Inhalt
Einleitung und Vorüberlegungen | 1
Hinführung zum Thema | 1
Zur Gattungsproblematik | 6
Konnte Victorius Griechisch? | 15
1 Die poetische Technik vor dem Hintergrund von Epos und
Lehrgedicht | 22
1.1 Aspekte des Werkaufbaus | 22
1.1.1 Ein Proöm im Stil des Lehrgedichts: die precatio | 22
Vertiefung: Leerstellen in der precatio? | 42
1.1.2 Die Anfänge der drei Bücher | 47
1.1.3 Verhältnis von Erzählung und Lehre | 51
1.1.4 Streben nach epischer Einheit | 59
1.2 Präsenz und Verhalten des Erzählers | 72
1.2.1 Beteiligtes Erzählen | 72
1.2.2 Adressatenbezug | 88
1.2.3 Poetic self-consciousness und poetic simultaneity | 100
1.3 Einzelne Elemente der Darstellung | 107
1.3.1 Darstellungselemente mit vorwiegendem Bezug zum Epos | 107
1.3.1.1 Ekphraseis | 107
1.3.1.2 Beinahe-Episoden | 113
1.3.1.3 Pro- und Analepsen | 118
1.3.2 Darstellungselemente mit Bezug zu Epos und Lehrgedicht | 131
1.3.2.1 Wörtliche Rede | 131
1.3.2.2 Kataloge | 144
1.3.2.3 Gleichnisse | 156
1.3.3 Ein Darstellungselement der Lehrdichtung: Reihung von Deutungen
mit sive – sive | 170
1.4 Zwischenfazit | 177
VIII | Inhalt
2 Szenen und Themen mit Bezug zur epischen und
lehrdichterischen Tradition | 180
2.1 Szenen mit Bezug zur epischen Tradition | 181
2.1.1 Gebet in epischer Form (2,42–89) | 181
2.1.2 Kampfszenen nach vergilischem Vorbild (3,415–464) | 189
2.1.3 Zukunftsschau mit Vergilreminiszenzen (3,512–554) | 199
2.1.4 Epiphanien mit epischen Elementen (3,574–579. 639–656.
683–687) | 210
2.1.5 Sonderfall: die Sintflut zwischen Epos und Naturwissenschaft
(2,454–485) | 215
2.2 Themen mit Bezug zur lehrdichterischen Tradition | 223
2.2.1 Die Kosmogonie zwischen Bibel, Patristik und Lehrgedicht
(1,1–170) | 223
2.2.2 Ein Paradies mit Zügen des Goldenen Zeitalters
(1,223–304) | 237
2.2.3 Die Kulturentstehungslehre als Gegenentwurf zu Lukrez
(B. 2 und 3) | 248
2.2.3.1 Die Erfindung der Landwirtschaft: Theorie und Praxis
(2,77–84. 163–177) | 250
2.2.3.2 Die Entdeckung des Feuers: ein persischer Mythos bei Victorius?
(2,100–117) | 261
2.2.3.3 Die Entdeckung der Metalle: abwandelnde Lukrezimitation
(2,118–162) | 265
2.2.3.4 Theoretischer Epilog: Abgrenzung vom Lehrgedicht
(2,163–196) | 275
2.2.3.5 Die Digression des dritten Buches: Divination und Idolatrie
(3,99–209) | 281
2.2.3.6 Verstreute Aussagen zur Kulturentstehung in B. 2 und 3 | 291
2.3 Zwischenfazit | 296
Ausblick: Die Stellung der Alethia in der spätantiken Bibeldichtung | 300
Literaturverzeichnis | 307
Stellenregister (in Auswahl) | 316
Namens- und Sachregister | 321
Einleitung und Vorüberlegungen
Hinführung zum Thema
Ab dem 4. Jh. n. Chr. verbreitete sich im lateinischen und, in geringerem Maße,
im griechischen Sprachraum eine Dichtungsform, für die sich davor nur ganz
vereinzelt Belege finden lassen:1 die dichterische Bibelparaphrase oder, wie sie
oft genannt wird, die Bibelepik. In der Klassischen Philologie wurden die Werke
der christlichen Bibeldichter lange Zeit eher geringschätzig betrachtet. Ihren
prägnantesten Ausdruck fand diese Haltung in Ernst Robert Curtius’ vielzitier-
tem Urteil, das Bibelepos sei „während seiner gesamten Lebenszeit – von Juven-
cus bis Klopstock – eine hybride und innerlich unwahre Gattung gewesen, ein
genre faux“ (Curtius 1948, 457). Erst in den 1970er Jahren entwickelte sich ein
breiteres Interesse an der Gattung und den Hintergründen ihrer Entstehung.
Großen Einfluss gewannen dabei die Positionen von Reinhart Herzog (1975), der
das christliche Andachtsbedürfnis als wesentliches Movens in der Herausbil-
dung des Bibelepos stark machte, und von Michael Roberts (1985), der die These
einer Entwicklung aus der rhetorischen Paraphrase aufstellte. Relativ unum-
stritten war und ist trotz der divergierenden Ansichten, dass die Bibelpoesie
sich zumindest auch vor dem Hintergrund der paganen Dichtungstradition
entwickelte. Als wesentliche Bezugsgattung in der paganen Literatur gilt dabei
meist, wie schon der Terminus Bibelepik andeutet, das narrative Epos.2 In der
Tat lassen sich bei den meisten der betreffenden Autoren Ausdrücke, Formele-
mente oder Szenen mit Bezug zu epischen Vorbildern finden, ja viele von ihnen,
etwa Juvencus, Proba, Sedulius oder Avitus, verweisen sogar explizit auf be-
stimmte pagane Epiker, vor allem auf Homer und Vergil.3 Über einen guten Teil
der Bibeldichtung kann man also, so sehr sich die einzelnen Werke in Inhalt
und Darstellungsstil auch unterscheiden mögen, mit einiger Berechtigung sa-
||
1 Die einzigen Vorläufer sind die fragmentarisch erhaltenen Werke der jüdisch-hellenistischen
Epiker Theodot und Philon, die ganz oder teilweise Themen des Alten Testaments behandel-
ten; dazu Verf. 2012.
2 Wie weit der Einfluss des Epos geht, ist freilich umstritten. Besonders betont wird die Konti-
nuität zum Epos bei Green 2006 (dort konkret zu Juvencus, Sedulius und Arator). Eine starke
Diskrepanz zwischen dem Epos und den meisten Bibelgedichten sieht dagegen etwa Schaller
1993. Differenziert urteilt z. B. Smolak 1999.
3 Vgl. Iuvenc. praef. 9sq.; Proba praef. 3sq.; Sedul. Carm. pasch. 1,17–22; Alc. Avit. SHG
3,336sq.
2 | Einleitung und Vorüberlegungen
gen, dass sich die Dichter mit dem Epos vergilischer Prägung intensiver ausein-
andersetzen als mit jeder anderen Gattung der paganen Literatur.
Freilich gibt es Ausnahmen von dieser Regel, und eine dieser Ausnahmen
ist Claudius Marius Victorius,4 der, wenn man den Angaben in der einzigen
Handschrift und in der mutmaßlich zugehörigen Kurzbiographie bei Gennadius
von Marseille trauen kann, in der ersten Hälfte des 5. Jh. als Rhetor in Marseille
tätig war.5 Victorius’ Werk, die Alethia,6 die das biblische Geschehen von der
Erschaffung der Welt bis zur Zerstörung von Sodom und Gomorrha in drei Bü-
chern7 verarbeitet, weist zwar ebenfalls deutliche Parallelen zum paganen Epos
||
4 In den incipitia und subscriptiones des codex unicus (Par. Lat. 7558, 9. Jh.) lautet der Name
teils Claudius Marius Victorius, teils Claudius Marius Victor. In der älteren Forschung wird der
Autor meist als Claudius Marius Victor bezeichnet (vgl. z. B. Schenkls Edition von 1888).
Hovingh etablierte in seinem Teilkommentar von 1955 und seiner Edition von 1960 aufgrund
des handschriftlichen Befundes Claudius Marius Victorius als wahrscheinlichere Form (vgl.
Hovingh 1955, 16 bzw. 1960, 119f.). Ich bezeichne den Dichter im Folgenden als Victorius (so
auch andere neuere Forscher, z. B. Herzog 1975, Martorelli 2008, Cutino 2009).
5 Ort und Tätigkeit bezeugen bereits die handschriftlichen incipitia und subscriptiones, wo der
Verfasser regelmäßig als orator Massiliensis tituliert wird. Victorius war demnach für die dritte
und höchste Stufe des antiken Schulwesens zuständig (vgl. z. B. Fuhrmann 1994, 81–85). Die
Datierung basiert hauptsächlich auf Gennad. Vir. ill. 61: VICTORINVS, rhetor Massiliensis, ad
filii sui, Etherii, personam commentatus est In Genesi, id est, a principio libri usque ad obitum
Abrahae patriarchae quattuor [v. l. tres] versu edidit libros Christiano quidem et pio sensu, sed
utpote saeculari litteratura occupatus homo et nullius magisterio in Divinis Scripturis exercitatus,
levioris ponderis sententias figuravit. moritur Theodosio et Valentiniano regnantibus. Trotz ge-
wisser Unstimmigkeiten (Namensform, Buchzahl, Inhalt, wobei anzumerken ist, dass in Her-
dingius’ Ausgabe bei den Capitula Victorius als Alternativlesung zu Victorinus vermerkt ist)
spricht viel dafür, dass der hier behandelte Autor gemeint ist (vgl. zuletzt Martorelli 2008, 12f.
und Cutino 2009, 9–11). Victorius starb demnach zwischen 425 (Regierungsantritt Valentinians
III.) und 450 (Tod Theodosius’ II.). Für die Werkentstehung lässt sich aus Aleth. 3,192 (uti nunc
testantur Alani) ein terminus post quem ableiten, da die Alanen 406/407 den Rhein überschrit-
ten und somit ins Bewusstsein der Gallier traten. Wichtig sind zudem mögliche Bezüge zum
semipelagianischen Streit, der Südgallien in den 420er und 430er Jahren erfasste, was eine
Abfassung in dieser Zeit wahrscheinlich macht (so Hovingh 1955, 23; vgl. auch unten Anm.
309).
6 Die Schreibung des Titels schwankt im Codex zwischen Alitia und Aletia (hinzu kommt die
griechische Form ΑΛΗΘΕΙΑ, die aber erst im 16. Jh. hinzugefügt wurde). Die Form Alethia ist
handschriftlich nicht bezeugt, hat sich in der Forschung jedoch eingebürgert.
7 Ob das Werk vollständig überliefert ist, bleibt umstritten. Die Buch- und Inhaltsangabe bei
Gennadius könnte darauf hindeuten, dass ein viertes Buch verloren ist, lässt sich aber auch
durch Gennadius’ Ungenauigkeit oder durch die Zählung der vorangestellten precatio als
eigenes Buch erklären. Unklar ist auch, wie die subscriptio nach Buch 3 (ĒPI ... LIB̄ IIII) zu
deuten ist. Zu Einzelheiten siehe Hovingh 1955, 17 und Martorelli 2008, 13–16; vgl. auch unten
Anm. 167.