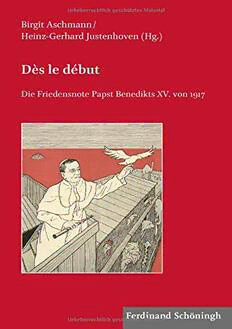Table Of ContentVERÖFFENTLICHUNGEN DER KOMMISSION FÜR ZEITGESCHICHTE
VERÖFFENTLICHUNGEN
DER KOMMISSION FÜR
ZEITGESCHICHTE
In Verbindung mit Michael Kissener •
Birgit Aschmann • Wilhelm Damberg
Herausgegeben von Thomas Brechenmacher
Reihe C: Band 2
Themen der Kirchlichen Zeitgeschichte
FERDINAND SCHÖNINGH
Birgit Aschmann, Heinz-Gerhard Justenhoven (Hg.)
DÈS LE DÉBUT
Die Friedensnote Papst Benedikts XV. von 1917
FERDINAND SCHÖNINGH
Umschlagabbildung:
Die Karikatur auf der Titelseite stammt aus der Ausgabe der Münchner Satirezeitschrift
Simplicissimus vom 17. August 1915. Das Digitalisat findet sich in der Online-Edition
des Simplicissimus (simplicissimus.info), angesiedelt an der Herzogin Anna Amalia
Bibliothek in Weimar. Die Darstellung verweist darauf, dass Papst Benedikt XV. bereits
vor seiner Friedensinitiative von 1917 – d. h. dès le début („von Anfang an“) – auf einen
Frieden im Ersten Weltkrieg drängte.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich
zugelassenen Fällen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlags nicht
zulässig.
© 2019 Verlag Ferdinand Schöningh, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia
Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland)
Internet: www.schoeningh.de
Einbandgestaltung: Evelyn Ziegler, München
Herstellung: Brill Deutschland GmbH, Paderborn
ISsn 2626-5281
ISBN 978-3-506-70272-2 (paperback)
ISBN 978-3-657-70272-5 (e-book)
Inhalt
Einleitung ...................................................................................................... 1
Birgit Aschmann/Heinz-Gerhard Justenhoven
Die Friedensinitiative Benedikts XV. von 1917 im internationalen
Kontext
Eine verpasste Chance und ihre Folgen .................................................... 11
Birgit Aschmann
Luigi Taparellis naturrechtlicher Entwurf einer weltweiten
Friedensordnung ......................................................................................... 49
Marco Schrage
Die Friedensethik Benedikts XV. und der Einfluss Leos XIII. .......... 69
Heinz-Gerhard Justenhoven
Nation, Nationalism and Race in the Diplomacy of
Pope Benedict XV ........................................................................................ 91
John F. Pollard
Die Rolle Eugenio Pacellis bei der Entstehung, der
Zielsetzung und dem Scheitern der päpstlichen
Friedensmediation von 1917 ...................................................................... 107
Klaus Unterburger
Matthias Erzberger, die Friedensresolution des Reichstags
und die deutsche Antwort auf die Päpstliche
Friedensinitiative ........................................................................................ 131
Christopher Dowe
Benedikt XV., katholische Feldpastoral und Kriegsmoral .................. 163
Thomas Schulte-Umberg
Krieg und Frieden im Denken Michael von
Faulhabers (1914–1918)
Reaktionen auf päpstliche Aussagen zum Frieden ................................ 189
Dominik Schindler
vi Inhalt
„Die Menschen geistig mündig machen“
Der Friedensbund Deutscher Katholiken im politisch-religiösen
Gefüge der Weimarer Republik .................................................................. 219
Klaus Große Kracht
Das Zweite Vatikanische Konzil, der Kalte Krieg und das
Erbe Benedikts XV.
Die kirchliche Friedenslehre zwischen ethischem Anspruch
und militärischer Wirklichkeit ................................................................... 247
Markus Thurau
Die Korrespondenz zwischen Nuntius Pacelli und
Staatssekretär Gasparri zur Friedensinitiative Benedikts XV. .......... 287
Sascha Hinkel/Elisabeth-Marie Richter/Hubert Wolf
Autorinnen und Autoren ........................................................................... 369
Personenregister .......................................................................................... 375
Einleitung
Birgit Aschmann/Heinz-Gerhard Justenhoven
„Gleich zu Beginn“ („Dès le début“) seines Pontifikats habe er, Benedikt
XV., sich „vor allem vorgenommen, […] nichts zu unterlassen, soweit es
in Unserer Gewalt steht, was dazu beitragen könnte, das Ende dieses
Unglücks zu beschleunigen“.1 Da es üblich geworden war, päpstliche
Schreiben nach ihren ersten Worten zu bezeichnen, wird jener bedeu-
tende Text, in dem Papst Benedikt XV. im August 1917 den kriegführen-
den Nationen ins Gewissen redete, auch „Dès le début“ genannt. Doch
dieses Schreiben war mehr als ein mahnendes Wort und unterschied sich
daher von den vielen Appellen, die dieser Papst seit dem Beginn seines
Pontifikats, das wenige Wochen nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges
begann, versandt hatte. Zwar fand sich auch in diesem Schreiben die
Mahnung an die kriegführenden Völker und Regierungen, „wieder Brü-
der zu werden“. Doch anders als zuvor präsentierte das Oberhaupt der
römisch- katholischen Kirche hier einen konzise umrissenen Weg zu
einem „gerechten und dauerhaften Frieden“.
Benedikt XV. datierte den Text, der in den ersten Augusttagen ent-
stand, auf den Beginn des Monats zurück – und damit auf den 1. August
1917 als den dritten Jahrestag des Kriegsbeginns. Nach drei Jahren Krieg
wollte der Papst, so schrieb er, dem „allgemeinen Wahnsinn“ ein Ende
setzen und verhindern, dass „die zivilisierte Welt“ sich gänzlich in „ein
Leichenfeld“ verwandeln und Europa weiter „in den Abgrund rennen
und die Hand gegen sich selbst […] zum Selbstmord“ wenden werde.
1 Benedikt XV., Quarto ineunte bellorum anno, nova Pontificis Summi ad moderatores
populorum belligerantium adhortatio, qua certae quaedam considerationes sugge-
runtur, compnendis discidiis et paci restituendae idoneae, in: Arnold Struker (Hrsg.),
Die Kundgebungen Papst Benedikts XV. zum Weltfrieden im Urtext und in deutscher
Übersetzung. Freiburg im Breisgau 1917, 72–79, hier 72f. Die auf Französisch verfasste
Note trug nichtsdestrotrotz einen lateinischen Titel. Bei Struker findet sich parallel
auch eine Übersetzung ins Deutsche der Note: Benedikt XV., Neue Mahnung des Papst-
es an die Oberhäupter der kriegführenden Völker zu Beginn des vierten Kriegsjahres,
in der gewisse, der Beilegung der Streitigkeiten und der Wiederherstellung des Frie-
dens dienliche Erwägungen nahegelegt werden, in: ebd., 72–79.
© verlag ferdinand schöningh, 2019 | doi:10.30965/9783657702725_002
2 Birgit Aschmann/Heinz-Gerhard Justenhoven
Wie sich bald herausstellen sollte, war die Friedensinitiative Benedikts
vom August 1917 zum Scheitern verurteilt – was maßgeblich dazu beige-
tragen hat, dass sie weithin in Vergessenheit geriet.
Dennoch ist es aus mehreren Gründen wichtig, sich ihrer zu erinnern.
Erstens gilt es, die Initiative zum Frieden als Option zu würdigen, die da-
rüber nachdenken lässt, welche Entwicklung die Weltgeschichte hätte
nehmen können, wenn sich die kriegführenden Mächte tatsächlich in
diesem Moment auf Friedensgespräche eingelassen hätten. Nicht nur die
weiteren mehrere hunderttausend Toten der folgenden Kriegsmonate,
sondern auch die spätere Dynamik von russischer Revolution, amerika-
nischer Demokratiemission, angeheizten Kriegserwartungen und den
sozioökonomischen wie emotionalen Folgen von Niederlage und Kapi-
tulation laden zum Nachdenken ein, ob nicht mit der Ablehnung der
Friedensinitiative die letzte Gelegenheit verpasst wurde, die Weichen für
die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts anders zu stellen. Dabei
macht die Rekonstruktion der Entscheidungssituation im Sommer 1917
deutlich, welche strukturellen, aber auch kontingenten Elemente das
Scheitern dieser Option verursachten.
Zweitens kann die Friedensinitiative als Spiegel der damaligen Kriegs-
gesellschaften dienen. Anhand der Reaktionen auf den päpstlichen Vor-
stoß lässt sich rückblickend die Friedensbereitschaft von Gesellschaften
und Regierungen ausloten. Das Ergebnis ist überaus ernüchternd. Auch
nach drei Jahren Stellungskrieg im Westen, nach der Erfahrung massen-
haften individuellen Leides und des Erlebens der ungeahnten destruk-
tiven Dimension maschinellen Tötens einer modernen Kriegführung
waren Gesellschaften und Regierungen der am Krieg beteiligten Länder
nicht bereit, zugunsten des Friedens Kompromisse einzugehen. So zeigt
das Schicksal der Friedensinitiative von 1917 prototypisch, wie leicht man
in einen Krieg „hineinschlittern“ kann, aber wie unglaublich schwer es
ist, ihn zu einem Ende zu bringen. Politiker und Militärs wollten von Ex-
pansionsvorstellungen nicht lassen, hatten sie sich doch in militärisch
vermeintlich hoffnungsvollen Situationen Kriegsziele gesteckt, die nun
eine Eigendynamik entfalteten. Die auf Opferbereitschaft eingeschwore-
nen nationalen Gemeinschaften wollten ebenso wenig auf die Erfüllung
des versprochenen Sinns ihres Opferganges verzichten und waren gerne
bereit, jenen Militärs Glauben zu schenken, die einen baldigen Sieg pro-
gnostizierten. Dass der Papst in dieser Zeit von einem „sinnlosen Mor-
den“ sprach, mochte den Kriegserfahrungen von Frontsoldaten aus der
Einleitung 3
Seele sprechen. In den Gesellschaften fernab der Fronten stieß diese
schonungslose Demaskierung des Kriegsgeschehens auf Unverständnis.
Wie sehr die jeweiligen Gesellschaften ihren nationalen Perspektiven
verpflichtet waren, zeigte sich besonders eindrucksvoll am katholischen
Klerus. Keine andere Institution hätte eigentlich mehr Anlass gehabt als
die katholische Kirche, sich für den Frieden einzusetzen. Doch weder die
Friedensbotschaft des Evangeliums noch die internationale Verflechtung
der Ordensgemeinschaften hatten die Kleriker der europäischen Länder
davon abgehalten, den nationalen Streitkräften ihren Segen zu geben
und sich damit eindeutig in den Burgfrieden der jeweiligen Nationen
einzureihen. Mit ihren Deutungen des Krieges als göttliches Sühnege-
richt hofften Bischöfe und Priester auf moralische Läuterung, statteten
den Krieg aber zugleich mit Sinn aus und leisteten damit einen entschei-
denden Beitrag zur Mobilisierung der Soldaten. Die päpstlichen Worte
von der Sinnlosigkeit, Unvernunft („Wahnsinn“) oder Unmoral des Krie-
ges („Morden“) konterkarierten nun die bisherige, gängige Kriegstheolo-
gie. Anstatt jetzt, im Sommer 1917, die päpstliche Friedensinitiative zu
stützen, reagierte der europäische Episkopat daher mit Sprachlosigkeit
oder Widerstand. Wichtiger als die Loyalität gegenüber dem Papst war
den Bischöfen der Schulterschluss mit ihrer jeweiligen Nation. So ergibt
sich der bedrückende Eindruck, dass die Gesellschaften und Regierungen
nach drei Jahren Krieg mehrheitlich der Gewalt nicht nur nicht entsagen
konnten, sondern es auch noch nicht wirklich wollten.
Drittens lohnt eine Auseinandersetzung mit der Friedensinitiative
des Papstes von 1917 auch deshalb, weil sie zwar nicht den erwünschten
Erfolg hatte, aber doch keineswegs folgenlos geblieben ist. Die tatsächli-
chen, wenn auch zum Teil nicht intendierten Auswirkungen veränder-
ten den Lauf der Kirchengeschichte und beeinflussten den Gang der
Weltpolitik. So forcierte die Initiative des Papstes die Positionierung der
USA als „moral player“, schließlich fühlte sich der amerikanische Präsi-
dent Woodrow Wilson durch den päpstlichen Konkurrenten im Kampf
um die moralische Deutungshoheit herausgefordert. Kirchengeschicht-
lich wurde die Initiative Benedikts insofern relevant, als sie zum einen
de facto den Wandel des Papsttums von einer staatlichen Macht hin
zur moralischen Instanz zementierte. Zum anderen wurden seine Äu-
ßerungen zum Krieg fortan zu einem Referenzpunkt des katholischen
friedensethischen Denkens. Die unmissverständliche Verurteilung der
modernen Kriegsführung, die die Unterscheidung von Kombattanten
4 Birgit Aschmann/Heinz-Gerhard Justenhoven
und Nicht-Kombattanten außer Kraft setzte und die Zivilbevölkerung in
neuem Ausmaß bedrohte, warf die Frage auf, ob es im 20. Jahrhundert
überhaupt noch „gerechte Kriege“ geben könne – galt doch für diese die
Verhältnismäßigkeit der Mittel als ein zentrales Beurteilungskriterium.
Damit aber blieben die klaren Worte Benedikts ebenso wie seine Forde-
rung nach Einrichtung eines übergeordneten internationalen Schiedsge-
richts, dessen Entscheidungen militärische Konflikte erübrigen sollten,
bis auf den heutigen Tag eine Herausforderung für Theologen, Politiker
und Militärs.
Diesen vielfachen Dimensionen nachzuspüren war das Anliegen einer
interdisziplinären Tagung, die vom 6. bis 8. September 2017 unter dem
Titel „100 Jahre Friedensappell Benedikts XV. Dès les début“ Theologen,
Kirchenhistoriker und Historiker im Katholischen Militärbischofsamt in
Berlin zusammenbrachte, um über die Entstehung, Bedeutung und Fol-
gen der Friedensinitiative zu diskutieren. Die in diesem Band vorgeleg-
ten Beiträge gehen auf diese Tagung zurück und folgen weitgehend deren
Gliederung.
Der einführende Aufsatz von Birgit Aschmann umreißt die zentralen In-
halte der Friedensinitiative, lotet die Chancen ihres Erfolges vor dem Hin-
tergrund des militärischen und politischen Kontextes des Jahres 1917 aus
und analysiert die Ursachen ihres Scheiterns. Dabei weist Aschmann da-
rauf hin, dass die päpstliche Initiative ganz gegen ihre Absicht womöglich
sogar noch dazu beigetragen hat, dass der Krieg mit noch größerer Intensi-
tät weitergeführt wurde. Herausgefordert durch die Initiative des Papstes
antwortete der amerikanische Präsident, der nach dem Kriegseintritt der
USA im April ohnehin genötigt war, die Entsendung amerikanischer Sol-
daten zu legitimieren, auf die Infragestellung des Krieges durch den Papst
mit einer neuen Sinn-Offensive. Die Demokratiemission Woodrow Wil-
sons machte aus dem Krieg jetzt einen säkularen „gerechten Krieg“. Diese
ultimative ideologische Aufladung heizte den Krieg an und konterkarierte
damit Versuche, ihn durch einen Verhandlungsfrieden zu beenden.
Für die Einordnung und Beurteilung Benedikts XV. innerhalb der Kir-
chengeschichte war die Frage zu beantworten, welchen Vorbildern und
Inspirationen der Papst folgte.
Im Umkreis des Vatikans wurden Konzepte einer internationa-
len Rechtsordnung erstmals im Kontext der europäischen 1848er-
Revolutionen erörtert. Die zentralen Überlegungen gehen zurück auf
den Jesuiten Luigi Taparelli d´Azeglio, dessen Einfluss auf Benedikt XV.