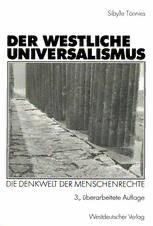Table Of ContentSibylle Tennies
Der westliche U niversalismus
Sibylle T6nnies
Der westliche
U niversalismus
Die Denkwelt
der M enschenrechte
3., iiberarbeitete Auflage
Westdeutscher Verlag
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz fur diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhaltlich
1. Auflage Februar 1995
2., durchgesehene Auflage Dezember 1996
3., uberarbeitete Auflage Marz 2001
Aile Rechte vorbehalten
© Westdeutscher Verlag GmbH, Wiesbaden, 2001
Lektorat: Monika Mulhausen
Der Westdeutsche Verlag ist ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer.
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschutzt.
Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulassig und strafbar. Das gilt insbe
sondere fur Vervielfaltigungen, Dbersetzungen, Mikroverfilmungen und
die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen System en.
www.westdeutschervlg.de
Hochste inhaltliche und technische Qualitat unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der Prod uk
tion und Verbreitung unserer Bucher wollen wir die Umwelt schonen. Dieses Buch ist auf
saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die EinschweiBfolie besteht aus
Polyathylen und damit aus organischen Grundstoffen, die weder bei der Herstellung noch bei
der Verbrennung Schadstoffe freisetzen.
Umschlaggestaltung: Horst Dieter Burkle, Darmstadt
Satz: ITS Text und Satz GmbH, Herford
ISBN-13 978-3-531-32988-8 e-ISBN-13 978-3-322-80841-7
DOl: 10.1007/978-3-322-80841-7
Inhalt
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Teil 1: Der westIiche Universalismus
1. Allgemeine Obersatze tiber das Gute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
I. Universalismus statt Naturrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
II. Die Destruktion durch die Romantik. . . . . . . . . . . . . . . 19
III. Klassische Losungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26
IV. Die Denkform "Fortschritt" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31
V. Universalia sunt realia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2. Der abstrakte Mensch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42
I. Das Gespenst in ntichterner Tageswahrheit . . . . . . . . .. 42
II. Die vorzeitig weggezogene Leiter der Natur. . . . . . . . . . 48
III. Verfassungspatriotismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
IV. Der Unterschied zwischen Sitte und Ethik . . . . . . . . . .. 56
3. Die Ursprtinge des Universalismus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60
I. Ubiquitat oder Diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60
II. Stoa: Die jedem zukommende Wtirde . . . . . . . . . . . . .. 64
III. Ius gentium: Das jedem zukommende Recht . . . . . . . .. 71
IV. Christentum: Die jedem zukommende Seele. . . . . . . . .. 82
4. Staat und Nation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92
I. Die Ambivalenz des Naturrechts gegentiber dem Staat. . 92
II. Individualisierung und Staatsbildung . . . . . . . . . . . . . . . 94
III. Die Degradierung des Staates in der Systemtheorie . . .. 97
6 Inhalt
IV. Der universalistische Charakter der Nation 105
V. Das nationale und internationale Gewaltmonopol. . . . .. 109
5. Universalismus als Oktroy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114
I. Gleichheit durch Uberlagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114
II. Vielleicht erzeugt Sein kein Sollen,
aber Sollen erzeugt Sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 118
III. Sprachanalogie............................... 122
IV. Permissiver Universalismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 124
V. Die miliUirische Durchsetzung der Menschenrechte. . . .. 129
Teil 2: Verschiedene Einwande
6. Der Einwand der DysfunktionaliUit (Luhmann) 133
I. Der Standpunkt der klassischen Soziologie. . . . . . . . . .. 133
II. Der Standpunkt der Systemtheorie . . . . . . . . . . . . . . .. 143
7. Der Einwand der Komplexitatsunangepasstheit (Chaos-Lehre). 151
I. Das Ganze und die Teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 151
II. Die unsichtbare Hand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 156
III. Normative Komplexitatsbewaltigung in der Biologie
(Teilhard de Chardin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 163
IV. Granulierung und Agglomeration . . . . . . . . . . . . . . . .. 171
8. Der Einwand des Idealismus (Habermas). . . . . . . . . . . . . . .. 176
I. Empirisch begrtindeter Universalismus. . . . . . . . . . . . .. 176
II. Das materialistische Relikt der Metaphysikfurcht . . . . .. 183
9. Der Einwand der "ego-orientation" (Parsons). . . . . . . . . . . .. 192
I. Pattern variables statt Gemeinschaft und Gesellschaft. .. 192
II. Der Altruismus der Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . .. 194
III. System statt Antithese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 199
Inhalt 7
IV. Exkurs: Die Vorziige des polaren Denkens 203
Teil 3: Der Vorwurf der Abstraktheit
10. Totalitarismus - links und rechts vereint 208
I. Marxismus und Naturrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 208
II. Gemeinsamkeiten des rechten und des link en
Totalitarismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 217
III. Die Ablehnung des Egoismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 221
11. Adomos Feier des Konkreten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 224
I. Das bleiche Abstrakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 224
II. Gegen die Gleichheit der Menschen . . . . . . . . . . . . . .. 226
III. Gegen das Generelle, gegen das Recht . . . . . . . . . . . .. 228
IV. Das blutvolle Konkrete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 230
12. Der Feminismus im Kampf gegen den "Malestream" . . . . . .. 233
I. Die Nahe zur totalitaristischen Rechtstheorie . . . . . . . .. 233
II. Justitia ist weiblich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240
III. Der Segen der phronesis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 246
13. Kommunitarismus: Gemeinschaft statt Gesellschaft . . . . . . . .. 253
I. Verkennung der Gemeinschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 253
II. Verkennung der Gesellschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 258
III. Universalistischer Partikularismus und partikularistischer
Universalismus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 263
IV. Sucht nach Gemeinschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 267
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 270
Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 283
Einleitung
"Mein altester Bruder Nikolenka war sechs Jahre alter als ich. Als ich fOnf
Jahre alt war, meine Bruder Mitenka und Serjosha sechs und sieben, sagte er
uns, er wisse ein Geheimnis, wie man aIle Menschen glticklich machen kon
ne. Dann gabe es keine Krankheiten mehr, keine Unannehmlichkeiten, die
Menschen wurden nicht mehr aufeinander bose sein, sondern einander lie
ben und ,Ameisenbruder' werden. (Wahrscheinlich hatte er etwas von den
Mahrischen Brudern gehort oder gelesen, aber in unserer Sprache waren das
,Ameisenbruder'.) Ich weiB noch, dass dieses Wort uns besonders gefiel, weil
es uns an Ameisen in einem Erdhaufen erinnerte. Wir spielten sogar ,Amei
senbruder'. Dieses Spiel bestand darin, dass wir uns unter Sttihle setzten, sie
mit Kasten verbarrikadierten und mit Tuchern verhangten und dort eng an
einandergeschmiegt im Dunkeln hockten. Ich erinnere mich, dass ich dabei
ein besonderes GefOhl von Liebe und Zartlichkeit empfand und dieses Spiel
sehr liebte.
In die ,Ameisenbruderschaft' waren wir nun eingeweiht, aber das eigent
liche Geheimnis, wie man es machen musse, dass die Menschen kein Un
gltick mehr kennen, sich niemals streiten, niemals bose sein wurden, son
dern auf immer glticklich waren, dieses Geheimnis sei auf einen grunen
Stock geschrieben, sagte uns Nikolenka, und dies en Stock habe er am Ran
de der Schlucht im Alten Wald vergraben, an der Stelle, wo ich, da man
meine Leiche ja irgendwo verscharren muss, in Erinnerung an Nikolenka
begraben werden mochte. Das Ideal der ,Ameisenbruder', die sich lie bend
aneinanderschmiegen, freilich nicht unter zwei mit Tuchern verhangten Ses
seln, sondern unter dem ganzen Himmelsgewolbe, habe ich mir bis heute
bewahrt. Und wie ich damals glaubte, dass jener grune Stock existierte, auf
dem etwas geschrieben stand, das alles Bose in den Menschen vernichten
und ihnen ein groBes Gluck geben sollte, so glaube ich auch jetzt, dass diese
Wahrheit existiert, dass sie den Menschen offenbar werden und ihnen das
geben wird, was sie verheiBt."
Zwei Motive sind in diesen Erinnerungen von Tolstoi miteinander ver
bunden: einmal die Ameisenbruderschaft, die darin besteht, dass die Kinder
sich unter den Stuhlen eine Hohle bauen, zum anderen der drauBen begra
bene grune Stock, auf dem das Grundgesetz des guten Lebens geschrieben
steht. Diese beiden Motive sollen den folgenden Text begleiten als die bei
den Moglichkeiten, sich eine gute Gesellschaft vorzustellen: einmal als
Ruckzug in gemeinschaftliche Zustande, in denen kollektive Einheit gefOhlt
10 Einleitung
wird, einmal als Heraustreten in den gesellschaftlichen Zustand, dessen uni
versales Gesetz aufzusuchen ist. Schiller trifft zwischen dies en beiden Mbg
lichkeiten die Unterscheidung zwischen "Arkadien" und "Elysium"; Arka
dien ist der zuriickliegende Ausgangs-, Elysium der in die Zukunft proji
zierte Endzustand. Wir kbnnen die beiden Ausrichtungen auch mit den Be
griffen "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" assoziieren. Die eine meint, ei
nen Riickweg in die natiirliche Richtigkeit der Gemeinschaft antreten zu
miissen, fiir sie ist die Gemeinschaft das verlorene Arkadien; die andere
meint, die Errungenschaften der Gesellschaft durch vernunftdiktierte Neu
organisation der Verhaltnisse fortsetzen zu kbnnen - sie sieht das Paradies
in der Zukunft, als Elysium. Schiller selbst lieB keinen Zweifel daran, dass
es ihm urn die Gewinnung Elysiens ging. Den Idealen der Franzbsischen
Revolution - mit anderen Worten: den universalen Menschenrechten - ver
schrieben, ging es ihm nicht urn die Nestwarme vergangener Gemein
schaftsbezogenheit, sondern urn die geschichtlich bisher unerreichte groBe
Verbriiderung alter Menschen: "Seid umschlungen, Millionen" - dieses ely
sische Ziel teilte er mit Kant, dessen Utopie von einer zentral zusammenge
fassten Weltgesellschaft er aufgegriffen hat.
Dieselbe Ausrichtung wird der folgende Text haben: nicht auf Arkadien,
sondern auf Elysium werden wir aus sein, aber der Seufzer "Et in Arcadia
ego" wird uns dabei begleiten, dieses geheimnisvolle Satzfragment, das von
einem antiken Grabstein iibrig blieb und von Schiller als "Auch ich war in
Arkadien geboren" verwendet wurde. Der Gedanke des Riickzugs, die Er
innerung an die Hbhlensituation soll nicht verworfen werden, sondern Sti
mulus sein fUr die elysische Ausrichtung, fUr die Suche nach dem griinen
Stock.
Die beiden als Suche nach der Hbhle einerseits und Suche nach dem
griinen Stock andererseits symbolisierten Mbglichkeiten, das gesellschaftli
che Gute anzustreben, lassen sich in eine grundsatzliche Zweiteilung ein
ordnen, die ich in einer friiheren Arbeit als "Dimorphism us der Wahrheit"
bezeichnet und behandelt habe. 1m ersten Fall ist dieses Gute die Folge der
absichtslosen Evolution des realen Zusammenlebens, im zweiten Fall ist es
die Folge des Gehorsams gegeniiber ideengeleitet entstandenen Maximen.
Die zweite Mbglichkeit ist diejenige, die sich in unserem westlichen Gesell
schaftstyp verwirklicht hat. Dessen Verfassung beruht auf Maximen, die,
wenn nicht gerade auf einem griinen Stock, so doch auf fiktiven ewigen Ta
feln aufgeschrieben sind, die als fUr die ganze Welt verbindlich angesehen
werden - als universal. Ihr Kern ist die Anerkennung der Menschenrechte.
Die auf Tradition gegriindete Autoritat der partikularen Rechtsordnungen
ist weggewischt; an ihre Stelle ist eine Autoritat getreten, die nicht auf tat
sachlich Vorfindbarem, sondern ideal Gedachtem aufbaut. Ihr Charakter ist
nicht empirisch, sondern rational.
Einleitung 11
In dem Konzept der Menschenrechte wird die gesellschaftliche Hierar
chie, die aIle durch Tradition hervorgebrachten Ordnungen kennzeichnet,
aufgehoben. An die Stelle von einander iiber- und untergeordneten Kollek
tiven, an die Stelle von Standen und Kasten werden die einzelnen Men
schen gesetzt, die Individuen, die einander als Freie und Gleiche gegen
iiberstehen.
Das Menschenrechtskonzept hat deshalb mit Problemen zu kampfen: Es
beschreibt keinen tatsachlichen historischen Entwicklungsstand, sondern
ein gedachtes Ideal. Es ist nicht Ausdruck eines Seins, sondern eines Sollens
und deshalb wissenschaftlich (wenn man diesen Begriff eng und quasi-na
turwissenschaftlich versteht) nicht begriindbar. Es ist nicht organisch von
selbst gewachsen, sondern kiinstlich und absichtsvoll etabliert. Es ist nicht
konkret, sondern abstrakt. Da es die tatsachlichen sozialen Einbindungen
ignoriert und auf den individuierten, isolierten Menschen setzt, begiinstigt
es desintegrierende, entwurzelnde Entwicklungen.
Das Menschenrechtskonzept, das wir hier "Universalismus" nennen, hat
deshalb von Anbeginn an - und als seinen Anbeginn verstehen wir die
Franzosische Revolution - mit erheblichen Widerstanden zu kampfen. Mit
diesen Widerstanden werden wir uns ausfiihrlich befassen. Da ist zunachst
die groBe restaurative Gegenbewegung gegen die abstrakten Maximen, die
Freiheit und Gleichheit fordern: die politische Romantik, die die Schwa
chen des Konzepts in einer bis heute uniibertroffenen Weise aufgedeckt
hat. AIle folgenden Widerlegungen, die man im weitesten Sinne als "post
modern" bezeichnen kann, sind nur Variationen zu dem damaligen Thema.
Statt der Suche nach dem griinen Stock wird der Riickzug in die Hohle pro
pagiert. Statt dass man sich den Anforderungen der modernen Gesellschaft
stellt, greift man bei dies en Widerlegungen - wenn auch meistens nicht be
wusst und explizit - auf Argumente zuriick, die ihre Richtigkeit nur in der
Gemeinschaft haben.
Zu streit en ist gegen den Universalismus allerdings von dem Standpunkt
aus, dass die Entfaltung von "Gesellschaft" nur eine voriibergehende Er
scheinung sei, dass sie keineswegs ein Schritt auf dem Weg zur Weltgesell
schaft, sondern ein vergangliches Gebilde sei, wieder zum Auseinanderfal
len verurteilte GroB-Organisation, deren voraussehbarer Niedergang das
rationale Naturrecht als geistigen Uberbau mitreiBen werde. Modernitat
lasst sich als transitorisch ansehen - dieser Standpunkt ist gut gegriindet auf
der Erfahrung des Verfalls friiherer Hochkulturen, und auf ihm ist kein
Raum fUr das universale Naturrecht. Gegen dies en Standpunkt soIl nicht
gestritten werden - er ist die andere, legitime Moglichkeit, die Zukunft zu
sehen. Gestritten werden so11 aber gegen die - von der System-und der Dis
kurstheorie vorgetragene - Auffassung, dass universale Richtlinien durch
die Zunahme an Modernitat obsolet geworden, dass sie nicht zukunftstrach-
12 Einleitung
tig seien, da man sich zunehmend von "Gemeinschaft" entferne und geseIl
schaftliche Struktur zunehme. Soweit und solange PartikulariUit sich auflbst
und ein Homogenisierungsprozess der Weitgesellschaften im Gange ist, ist
das rationale Naturrecht adaquat - es wird obsolet erst dann, wenn diese
Entwicklung sich im Riicklauf befindet und eine Re-Partikularisierung die
Oberhand gewinnt. Ob das der Fall sein wird - dariiber sollen hier keine
Aussagen gemacht werden. Vorausgesetzt werden soli hier das Anhalten
der Vergesellschaftungsprozesse, die Auflbsung partikularer Strukturen zu
Gunsten universaler, und auf dieser Grundlage soli fiir den Universalismus
argumentiert werden. Da sie die Basis auch der system- und diskurstheore
tischen Gegenposition ist, wird es die Aufgabe dieses Textes sein, den not
wendigen Konnex zwischen moderner, westlicher Gesellschaft und Univer
salismus zu begriinden.
Hier soIl der Standpunkt eingenommen werden, dass wir eine weitere
Universalisierungsstufe erst vor uns haben: die Bildung einer Weltgesell
schaft, und dass die bisher in diese Richtung gehenden Vorgange, die zur
Etablierung des rationalen Naturrechts gefiihrt haben, noch iibertroffen
werden von den erst in Gang befindlichen. Wenn man Hobbes Naturrechts
lehre in der Forderung zusammenfassen kann, "dass ein Staat sei", dann ist
der jetzt fiiIlige Schritt der: dass ein Weltstaat sei. Der Universalismus er
weist sich bei dieser Betrachtung nicht als obsolet, sondern im Gegenteil als
erst der Zukunft angemessen. Sein Problem ist nicht, dass er altmodisch,
sondern dass er futuristisch ist; dass Vernunftgegriindetheit mit zu viel Na
turferne einhergeht.
Diese Naturferne kann so scharf gesehen werden, dass der Universalis
mus als Instrument des Imperialismus, der Kolonisation von Lebenswelten,
aufgefasst wird, und dies em Vorwurf kann er nicht entgehen. Man muss der
Tatsache ins Auge sehen, dass alle universalistische Rationalitat ein Kunst
produkt ist, mit dem das naturhaft Entstandene - oft gewaltsam - iiberla
gert wird.
Das Thema "Universalismus" legt nahe, eine Auflistung dessen vorzu
nehmen, was seine notwendigen Inhalte sind, also anzugeben, "quod sem
per, quod ubique, quod ab omnibus creditum" - was immer, iiberall und
von allen anerkannt werden muss. Das Abendland verfiigt bereits iiber ei
nen reichen Bestand solcher Auflistungen; sie machen das aus, was man als
"Naturrecht" bezeichnet, und fiillen Bibliotheken. Ihren Hbhepunkt fanden
die in diese Richtung gehenden Anstrengungen in der Zeit des 17. und 18.
lahrhundert, die die Menschenrechte hervorbrachte; aber es gibt Auflistun
gen des von einer Gesellschaft unabdingbar zu Gewahrleistenden bis in un
sere Tage, es gibt "starke" und "schwache" Konzepte dieser Art - und sie
werden uns aIle nicht interessieren. Wir werden uns mit den Inhalten des
Universalen nur insoweit beschaftigen, als wir sie brauchen, urn den Cha-