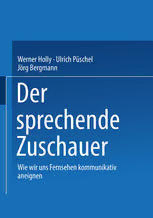Table Of ContentWerner Holly · Ulrich Püschel
Jörg Bergmann
Der
sprechende
Zuschauer
Wie wir uns Fernsehen kommunikativ
aneignen
Werner Holly · Ulrich Püschel
Jörg Bergmann (Hrsg.)
Der sprechende Zuschauer
Werner Holly . Ulrich Püschel
Jörg Bergmann (Hrsg.)
Der sprechende
Zuschauer
Wir wir uns Fernsehen
kommunikativ aneignen
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhältlich
1. Auflage Oktober 2001
Alle Rechte vorbehalten
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2001
Ursprünglich erschienen bei Westdeutscher Verlag GmbH, Wiesbaden 2001.
www.westdeutschervlg.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne
der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jeder
mann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung: Horst Dieter Bürkle, Darmstadt
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
ISBN 978-3-531-13696-7 ISBN 978-3-322-89599-8 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-89599-8
Marita Steffen (1971 - 1999) gewidmet
Inhalt
Vorwort 9
Der sprechende Zuschauer 11
Werner Holly
1.1 Fernsehen als soziale Orientierungsressource 11
1.2 Die kommunikative Aneignung von Fernsehen 13
1.3 Forschungslinien 17
1.4 Die Analyse fernsehbegleitenden Sprechens: Fragen, Ziele, Übersicht 19
1.5 Material und Methoden 21
2 Medienrezeption als Aneignung 25
Marlene Faber
2.1 Rezeption -Nutzung-Aneignung 25
2.2 Die Bedeutung von aneignen 28
2.3 Fernsehtext und Rezipient 31
2.4 Modalitäten der Fernsehtextaneignung 34
2.5 Aneignung: Die Konzeptualisierung der kreativen Begegnung
von Rezipient und Medienprodukt 37
3 Grundlagen des fernsehbegleitenden Sprechens 41
Werner Holly und Heike Baldauf
3.1 Mögliche Konstellationen 41
3.2 Fernsehbegleitendes Sprechen und seine Einbettungsstruktur 44
3.3 Zusammenfassung 60
4 Strukturen und Formen des Fernsehbegleitenden Sprechens 61
Heike Baldauf
4.1 Fernsehbegleitendes Sprechen als ernpraktische Kommunikation 61
4.2 Elemente der Organisation im Open state of talk 63
4.3 Zur Kommunikationsstruktur von Sprechhandlungen 68
4.4 Mitsprechen I Mitsingen -der Doppelcharakter des fernsehbegleitenden Sprechens 75
4.5 Von Stöhnen bis "ich hasse Werbung"-evaluative Ausdrucksformen 78
4.6 Zusammenfassung 81
5 Sprachhandlungsmuster 83
Michael Klemm
5.1 Handlungsfelder und Aneignungsmuster der Zuschauerkommunikation 83
5.2 Handlungsverkettungen, Handlungssequenzen, kommunikative Gattungen in der
Zuschauerkommunikation 108
5.3 Makrofunktionen der Zuschauerkommunikation 111
8 Inhalt
6 Themenbehandlung 115
Michael Klemm
6.1 Ein angemessener Themenbegriff für die Zuschauerkommunikation 115
6.2 Die Themenbehandlung beim fernsehbegleitenden Sprechen 118
6.3 Zusammenfassung: Zur Funktionalität der fernsehbegleitenden
,Jläppchenkommunikation'' 141
7 Gattungsspezifik 143
7.1 Fernsehgattungen in der Aneignung 143
Ruth Ayaß
7.2 Nachrichten 153
Michael Klemm
7.3 Ratgebersendungen: Gesundheitsmagazine 173
Stephan Habscheid
7.4 Krankenhausserien 187
Marlene Faber
7.5 Werbespots 201
Ruth Ayaß
8 Interpretationsgemeinschaften 227
8.1 Gruppen und Stile 227
Ulrich Püschel
8.2 Paare und Alte 235
Werner Holly I Marita Steffen t und Ruth Ayaß
8.3 Erwachsene und Kinder 262
Michael Klemm I Dirk Schulte
9 Zur Konstruktion von Wirklichkeit in der Aneignung 287
Angela Leister
9.1 Zum Umgang mit der Fernsehwirklichkeit 287
9.2 Medien und Wirklichkeit 289
9.3 Grenzen der Wirklichkeit 290
9.4 Fazit 307
Literatur 309
Anhang: Liste der Rezeptionsgemeinschaften, Transkriptionssymbole 329
Am Forschungsprojekt "Über Fernsehen Sprechen", das in Chemnitz, Trier und Gießen
durchgeführt wurde, waren viele beteiligt, denen hier zu danken ist. Zu nennen ist vor allem
Rainer Winter, der an der Konzeption und Antragstellung maßgeblich mitgewirkt hat.
Vorbereitend und begleitend haben in Trier, Saarbrücken und Chemnitz Seminare stattgefun
den, in denen uns viele Studierende mit zahlreichen Tonbandaufnahmen geholfen haben,
besser zu verstehen, wie fernsehbegleitendes Sprechen eigentlich geht. Dies gilt noch mehr
für die (anonym bleibenden) studentischen Hilfskräfte, die als teilnehmende Beobachter unser
reichhaltiges Material erhoben und transkribiert haben, und natürlich besonders für ihre
Rezeptionsgemeinschaften.
Außer den Projektmitarbeitern Heike Baldauf, Andreas Hepp und Angela Leister waren auch
Ruth Ayaß, Marlene Faber, Stephan Habscheid und Michael Klemm Mitglieder der Arbeits
gruppe, was auch aus ihren Kapiteln und Abschnitten in diesem Band hervorgeht, außerdem
als studentische Hilfskräfte Dirk Schulte und Marita Steffen, deren tragischer Unfalltod uns
immer noch mit Schmerz und Trauer erfüllt.
Die Druckvorlage hat Holm Krieger hergestellt. Nicht zuletzt danken wir der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, die das Projekt zwei Jahre gefördert und einen Druckkostenzuschuß
gewährt hat.
Chemnitz, Trier, Gießen
Im Juli 2001 W.H., U.P., J.B.
1 Der sprechende Zuschauer
Wemer Holly
1.1 Fernsehen als soziale Orientierungsressource
Was macht Fernsehen so erfolgreich? - Es ist noch immer, trotz des neuerdings
aufgekommenen Internetbooms, das Leitmedium, das als meistbeachtetes Forum
der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und das die Freizeit einer sehr großen An
zahl von Menschen strukturiert. Fernsehen ist aufgrund einer Reihe von Faktoren
ein hochmodernes und immer noch expansives Medium: nicht nur durch seine mul
timodale Verarbeitungskapazität, mit der es uns wie der Kino-Tonfilm und die Vi
deotechnik bewegte und statische Bilder mit Ton und Sprache präsentiert, dies aber
in Programmform frei Haus, in immer besserer Bild- und Tonqualität und auf im
mer mehr Kanälen. Es hat auch mächtige staatliche bzw. öffentlich-rechtliche oder
eben privat-kommerzielle Institutionen hervorgebracht, die mit ihren Angeboten
den öffentlichen Diskurs, ja die gesamte Öffentlichkeit unserer Gesellschaften
ebenso weitreichend strukturieren wie das Alltagsleben vieler, ja der meisten Ge
sellschaftsmitglieder.
So ist es kein Wunder, daß Revolutionäre als erstes die Fernsehstationen beset
zen; es erstaunt auch nicht, daß die ersten Jahrzehnte der öffentlichen und wissen
schaftlichen Diskussion um Fernsehen sich besonders mit seinem tatsächlichen oder
vermeintlichen Manipulationspotential beschäftigt haben. Fernsehinhalte scheinen
die Zuschauer in ihrer Weitsicht, besonders in ihrem politischen Verhalten zu beein
flussen, darüber hinaus in ihrem Konsum- und Freizeitverhalten. Fernsehen - so der
Argwohn der Kritiker und die Hoffnung der Mächtigen - kann lenken und be
schwichtigen, verdummen und verkaufen, bilden und deformieren.
Bei solcherlei Dämonisierungen wie euphorischen Erwartungen ist Vorsicht ge
boten. Die Wissenschaft muß an die Stelle der Mythenbildungen, die auf Seiten der
Macher, der Kritiker und des Publikums betrieben werden, nüchterne Beobachtun
gen und Analysen setzen. Es ist erstaunlich, wie wenig man noch immer über den
gesamten Verlauf des Fernsehkommunikationsprozesses weiß. Die Kritik hat sich
meist kaum um die Vorgänge bei der Produktion und noch weniger um die wirkli
chen Details bei der Rezeption von Fernsehen gekümmert. Quantifizierbares wie
Einschaltquoten und Umfrageergebnisse, die aber wenig über tatsächliche Verste
hensprozesse aussagen, dominieren ebenso wie Produktanalysen, die idealisierte
Rezeptionen unterstellen und damit die Rechnung ohne den Wirt machen: erst der
Rezipient konstituiert "den Text" endgültig. Gängige institutionalisierte (Selbst)
definitionen von Aufgaben (oder sogar "Aufträgen") des Fernsehens wie Bildung,
Information, Unterhaltung verdecken den Blick auf die alltäglichen Rezeptionsver
haltensweisen, für deren scheinbare Selbstverständlichkeiten unsere Wahrnehmung
unempfindlich ist.
12 Werner Holly
In der herkömmlichen Sicht ist Fernsehen in erster Linie ein Unterhaltungs- und
Informationsmedium. Hier in diesem Buch wird aus der Perspektive einer empiri
schen Untersuchung ein etwas anderes Verständnis des Mediums Fernsehen ent
wickelt, nämlich daß Fernsehen in erster Linie eine soziale Orientierungsressource
ist, in diesem Sinn also ein "Orientierungsmedium" ist. Damit ist aber nicht ge
meint, daß die Fernsehmacher die Zuschauer orientieren oder eben - wie die Kriti
sche Theorie der 70er Jahre und seither manche Teile der Medienkritik und Medi
enpädagogik vermutet haben - manipulieren. In unserer Sicht sind es über weite
Strecken die Zuschauer selbst, die sich untereinander wechselseitig orientieren, aber
eben anhand des symbolischen Materials, das ihnen das Fernsehen ständig und in
großer thematischer und stilistischer Vielfalt liefert.
Diese Sicht auf Fernsehen als eine Orientierungsressource, ein Orientierungsme
dium, das z.T. im Dienst und in der Hand der Zuschauer selbst liegt, ist das Ergeb
nis eines rezeptionsbezogenen Untersuchungsansatzes, der an eine Reihe von medi
enwissenschaftlichen, aber auch soziologischen, sprach- und literaturwissenschaftli
chen, semiotischen und philosophischen Forschungslinien anknüpft (s. auch 1.3).
Hier ist vor allem der Gedanke zu nennen, daß Medienrezeption, besonders aber
Fernsehrezeption, kein passives Geschehen ist, sondern daß der Zuschauer ein "ak
tiver" Zuschauer ist, wie schon der "Uses- and gratifications"-Ansatz annahm. Über
dessen Konzeption eines Zuschauers, der von Nutzungsinteressen geleitet ist, hin
aus haben die Cultural Studies', zumindest einige ihrer späteren Arbeiten, auch die
Rezeption der Inhalte als einen semantischen Konstruktionsprozeß beschrieben, bei
dem die prinzipielle Offenheit der Fernsehtexte von den Zuschauern nach ihren
jeweiligen Deutungsinteressen ausgedehnt werden kann, bis hin zu einer nahezu
subversiven "semiologischen Guerilla"-Tätigkeit, die den produktionsseitigen Sinn
des Textes auf den Kopf zu stellen und vollständig umzudeuten vermag, im Sinne
einer höchst eigenständigen Aneignung.
In dieser Sicht wirken Ideen der Iiteraturwissenschaftlichen Rezeptionsästhetik
nach, das Konzept der "Offenheit" von Texten (z.B. Eco 1973), die erst vom Rezi
pienten "geschlossen" werden, d.h. eine Deutung und damit überhaupt Bedeutung
bekommen, und schließlich das Konzept des "impliziten Lesers" (Iser 1984), das
davon ausgeht, daß die Leerstellen für die eigenständige Rezeption vom Textprodu
zenten schon vorgesehen sein können. Allen solchen Vorstellungen liegt der Ge
danke zugrunde, daß Kommunikation, auch Massenkommunikation, nicht einweg
haft nach dem berühmten "Containermodell" - oder gar einem "Geschoßprinzip"
("bullet"-Theorie) - verläuft, wobei ein Inhalt von einem Sender verpackt über ei
nen Kanal bei einem Empfänger landet, der spiegelbildlich die Botschaft auspackt
und entsprechend versteht, so daß eine gewissermaßen unausweichliche, jedenfalls
aber kalkulierbare Wirkung eintritt, wie bis heute die Werbewirtschaft glauben ma
chen möchte. Stattdessen wird das Wechselseitige im Kommunikationsprozeß her
vorgehoben: Wie schon der Produzent in einem "recipient design" auf einen ge
dachten Adressaten hin kommuniziert und wie der Rezipient zwar möglichst genau
rekonstruieren kann, was der Produzent wohl gemeint haben könnte, aber auch gar
nicht anders als sehr eigenständig konstruieren kann, als was er den Text verstehen