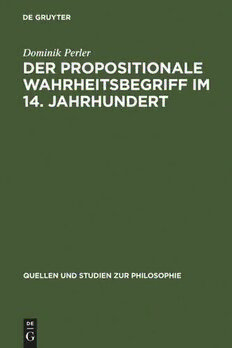Table Of ContentDominik Perler
Der propositionale Wahrheitsbegriff im 14. Jahrhundert
W
DE
G
Quellen und Studien
zur Philosophie
Herausgegeben von
Jürgen Mittelstraß, Günther Patzig,
Wolfgang Wieland
Band 33
Walter de Gruyter · Berlin · New York
1992
Der propositionale
Wahrheitsbegriff
im 14. Jahrhundert
von
Dominik Perler
Walter de Gruyter · Berlin · New York
1992
® Gedruckt auf säurefreiem Papier,
das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.
Die Deutsche Bibliothek — CIP-Einheitsaufnahme
Perler, Dominik:
Der propositionale Wahrheitsbegriff im 14. Jahrhundert / von
Dominik Perler. — Berlin ; New York : de Gruyter, 1992
(Quellen und Studien zur Philosophie ; Bd. 33)
Zugl.: Freiburg (Schweiz), Univ., Diss., 1991
ISBN 3-11-013415-2
NE: GT
© Copyright 1992 by Walter de Gruyter & Co., D-1000 Berlin 30.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Satz und Druck: Arthur Collignon GmbH, Berlin
Buchbinderische Verarbeitung: Lüderitz & Bauer-GmbH, Berlin
Meinen Eltern
Vorwort
„Was in den Begriff der Wahrheit eingreift (wie
in ein Zahnrad), das ist ein Satz."
L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 136
Die Philosophie des 14. Jahrhunderts ist in den letzten zwanzig bis
dreißig Jahren immer mehr in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses
gerückt. Besonders die logisch-semantischen Debatten in den beiden in-
tellektuellen Zentren Oxford und Paris finden sowohl in historischer als
auch in philosophisch-systematischer Hinsicht immer größere Beachtung.
Im Rahmen dieser regen Forschungstätigkeit wurde auch das Wahrheits-
problem teilweise behandelt. Verschiedene Studien untersuchten die Ver-
knüpfung der spätmittelalterlichen Wahrheitstheorien mit der Lehre von
den proprietates terminor um, indem sie von folgender Leitfrage ausgingen:
Welche semantisch-syntaktischen Bedingungen müssen gemäß den Auto-
ren des 14. Jahrhunderts die Termini eines Satzes erfüllen, damit ein Satz
wahr ist?
Die vorliegende Arbeit versucht, diese sehr spezifische Frage nach
den Wahrheitsbedingungen auf die grundlegendere Frage nach dem Wahr-
heitsbegriff zurückzuführen. Bevor bestimmt werden kann, welche Bedin-
gungen die Termini eines Satzes erfüllen müssen, ist grundsätzlich zu
klären, im Rahmen welcher Wahrheitskonzeption diese Bedingungen zu
formulieren sind. Da die Autoren des 14. Jahrhunderts zur Erarbeitung
einer Wahrheitskonzeption stets vom Satz ausgingen, ist zu fragen: In
welchem Verhältnis steht der Satz zum Wahrheitsbegriff, oder — mit
Wittgenstein gesprochen — wie greift der Satz in den Wahrheitsbegriff
ein? Ziel dieser Arbeit ist es, diesen zahnradartigen Mechanismus des
„Eingreifens" in semantische, erkenntnistheoretische und ontologische
Problembereiche näher zu betrachten.
Die vorliegende Studie ist die überarbeitete, leicht gekürzte Fassung
meiner Dissertation, die im Januar 1991 von der Philosophischen Fakultät
der Universität Fribourg auf Antrag der Professoren R. Imbach (erster
Gutachter) und G. Küng (zweiter Gutachter) angenommen wurde.
VIII Vorwort
Mein besonderer Dank gilt Prof. Imbach, der die Entstehung dieser
Arbeit auf vielfältige Weise gefördert hat. Seine kompetente Betreuung
und seine ermunternden Kommentare waren mir stets eine wertvolle Hilfe.
Ich danke auch Prof. Küng, der mich durch anregend-kritische Detailbe-
merkungen zur Überprüfung verschiedener Argumente angespornt hat.
Des weiteren danke ich den Professoren K. Jacobi (Freiburg i.Br.), L.
Krüger (Göttingen), L.M. de Rijk (Leiden) und PD Dr. P. Schulthess
(Zürich), die frühere Fassungen dieser Arbeit ganz oder teilweise gelesen
und mir hilfreiche Korrektur- oder Ergänzungsvorschläge unterbreitet
haben.
Ferner danke ich dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, der
mir durch die Gewährung eines Stipendiums für das akademische Jahr
1988/89 einen in vielfacher Hinsicht anregenden Studienaufenthalt an der
Universität Göttingen ermöglicht hat. Die Professoren G. Patzig und L.
Krüger haben mich am Philosophischen Seminar äußerst gastfreundlich
empfangen und stets wohlwollend unterstützt.
Ebenso herzlich wurde ich an der „Sage School of Philosophy" der
Cornell University empfangen. Ich danke Prof. N. Kretzmann, der mir
hier in einer äußerst stimulierenden Umgebung ideale Arbeitsbedingungen
geschaffen hat.
Den Herausgebern der „Quellen und Studien zur Philosophie" danke
ich für die Aufnahme meiner Arbeit in ihre Buchreihe.
Dr. Daniel Deckers (Köln) danke ich für die freundschaftliche Hilfe
bei den Druckvorbereitungen.
Cornell University
Ithaca N.Y., im Dezember 1991 D.P.
Inhalt
Einleitung 1
0.1 Methodische Vorbemerkungen 1
0.2 Problemstellung 9
0.3 Ansatz der Untersuchung 14
0.4 Systematische Leitfragen 19
0.5 Bemerkungen zur Terminologie 24
1. Was heißt ,wahr'? 28
1.1 Wahrheitsbegriffe im Anschluß an Aristoteles 28
1.2 Die Definition des propositionalen Wahrheitsbegriffs 34
1.3 Der Wahrheitsbegriff im Kontext der Wissenschaftstheorie
und der Metaphysik 50
1.4 Zusammenfassung 59
2. Was ist ein wahrer Satz? 63
2.1 Die Satzdefinition 66
2.2 Die Satzglieder 75
2.3 Die Prädikation 80
2.3.1 Die Zusammensetzung der Satzglieder in der Prädika-
tion 80
2.3.2 Die syntaktisch-semantische Analyse der Prädikation . 82
2.3.3 Die ontologischen Voraussetzungen und Implikationen
der Prädikation 91
2.3.4 Konsequenzen für das Wahrheitsproblem 106
2.4 Die Supposition der Termini als Wahrheitsbedingung eines
Satzes 109
2.4.1 Die syntaktisch-semantische Definition der Supposition 109
2.4.2 Lücken und Probleme der Suppositionstheorie 125
2.4.3 Die Supposition in Sätzen über Vergangenes und Zu-
künftiges 129
2.4.4 Die Supposition in Sätzen über fiktive Gegenstände . . 139
2.4.5 Die Supposition in Sätzen mit intentionalen Verben . . 149
2.5 Zusammenfassung 157
X Inhalt
3. Wie wird ein wahrer Satz verstanden? 160
3.1 Die mentalen Wahrheitsbedingungen eines Satzes 162
3.2 Der mentale Satz 169
3.2.1 Ausgangspunkt und Problemstellung 169
3.2.2 Die Funktion der mentalen Termini 173
3.2.3 Die Relation zwischen den mentalen, den gesprochenen
und den geschriebenen Termini 179
3.2.4 Der ontische Status der mentalen Termini 185
3.2.5 Die Struktur des mentalen Satzes 196
3.3 Der Verstehensakt 208
3.3.1 Erfassen und Urteilen 208
3.3.2 Sensitives und intellektives Verstehen 216
3.3.3 Die Konstituierung eines Verstehensaktes 226
3.4 Die Evidenz des Verstehensaktes 237
3.4.1 Evidenz und Intuition 237
3.4.2 Intuitive und abstraktive Kenntnis 244
3.5 Zusammenfassung 258
4. Was bezeichnet ein wahrer Satz? 261
4.1 Ontologische Voraussetzungen 263
4.1.1 Die Objekte eines Satzes mit einstelligem Prädikat . . . 264
4.1.2 Die Objekte eines Satzes mit zweistelligem Prädikat . . 271
4.2 Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Voraussetzungen 279
4.3 Das significatum eines objektsprachlichen Satzes 292
4.3.1 Die complexum-Theorie 294
4.3.2 Die rw-Theorie 308
4.3.3 Die complexe significabile-Theotie 317
4.4 Das significatum eines selbstbezüglichen Satzes 326
4.5 Zusammenfassung 342
Schluß 349
Literatur 366
Index Nominum 379
Index Rerum 383