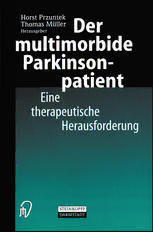Table Of ContentHorst Przuntek . Thomas Müller (Hrsg.)
Der multi morbide Parkinsonpatient
Horst Przuntek· Thomas Muller (Hrsg.)
Der mult or ide
e
Parke so pa ient
Eine therapeutische Herausforderung
Prof. Dr. med. Horst Przuntek
Prof. Dr. Thomas Muller
Neurologische Klinik
der Ruhr-Universitat Bochum
St. Josef-Hospital
GudrunstraBe S6
44791 Bochum
Die Deutsche Bibliothek -CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz ftir diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhaltlich
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschtitzt_D ie dadurch begrtindeten Rechte, insbesondere die
der Obersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfaltigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine VervieWiltigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Ein
zelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulassig.
Sie ist grundsatzlich vergtitungspf\ichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestim
mungen des Ur heberrechtsgesetzes.
ISBN 978-3-7985-I 353-2 ISBN 978-3-642-57512-9 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-642-57512-9
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002
Originally publisbed by SteinkopffVeriag Darmstadt in 2002
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
waren und daher von jedermann benutzt werden dtirften.
Produkthaftung: Ftir Angaben tiber Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann
vom Verlag keine Gewahr tibernommen werden. Derartige Angaben mtissen vom jeweiligen
Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit tiberprtift werden.
Redaktion: Dr. Maria Magdalene Nabbe, /utta Salzmann - Herstellung: Heinz /. Schafer
Umschlaggestaltung: Erich Kirchner, Heidelberg
80/7231 -5 4 3 2 1 0 -(jedruckt auf saurefreiem Papier
Vorwort
Das dritte gemeinsame Treffen der Deutschen Parkinsonkliniken
auf der Insel Zypern 2001 bot wieder, wie schon bei den ersten bei
den Treffen, die hervorragende Gelegenheit, das Wissen und die
Erfahrung über Therapiemöglichkeiten und -erfolge in der Behand
lung von Parkinsonpatienten auszutauschen, zu erweitern und hin
sichtlich therapeutischer Effizienz und allgemeiner Anwendbarkeit
zu bewerten. Die bunte Vielfalt der hier vorgestellten Beiträge spie
gelt das unermüdliche Bestreben aller in die Therapie von Parkin
sonpatienten involvierten Vortragenden wider, Lebensqualität und
Wohlbefinden von chronisch Kranken und deren Angehörigen zu
verbessern und diese komplexe Erkrankung auch vor dem Hinter
grund von Begleiterkrankungen zu betrachten. Einerseits wurde die
Bedeutung vegetativer und sensorischer Störungen diskutiert, ande
rerseits wurde der Einfluss von Begleiterkrankungen und ausge
prägten Begleitsyndromen auf Therapie und Verlauf der Erkran
kung vor dem Hintergrund persönlicher Erfahrungen in Übersich
ten vorgestellt. Diese Zusammenstellung bietet Erkenntnisse über
mögliche Interaktionen, die im Rahmen der medikamentösen Kom
binationstherapie zu beachten sind, sowie eine Bewertung der gän
gigen intensivmedizinischen Vorgehensweisen und der neu entwi
ckelten Therapieverfahren wie der Tiefenhirnstimulation und eine
Bewertung von Langzeitaspekten. Abgerundet wird dieses Buch mit
Aussagen zur Pharmakoökonomie und zu nichtmedikamentösen,
die Lebensqualität und die Krankheitsverarbeitung verbessernden
Therapieansätzen.
Insgesamt bot dieses Symposium die einmalige Gelegenheit sich
über diese Inhalte auszutauschen. Dieses Buch soll den so gewonne
nen verbesserten Wissensstand und Erfahrungsschatz weiter ver
mitteln. Der Dank gilt im besonderen Maße der Firma Lundbeck,
deren großzügige finanzielle Unterstützung dieses nicht alltägliche
Treffen auf der Insel Zypern ermöglichte.
Bochum, im März 2002 Professor Dr. HORST PRZUNTEK
Professor Dr. THOMAS MÜLLER
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.............................................. V
Morbus Parkinson und Schlaf
D. Schäfer, W. Greulich ................................. 1
Restless Legs und Morbus Parkinson
1. Csoti ........................... ..................... 17
Optisches System und Morbus Parkinson
T. Büttner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Morbus Parkinson und Depression
M. H. Strothjohann, G. Fuchs . .. . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . 45
Morbus Parkinson und Demenz - der De-novo-Patient
J. Rieke ............................................... 51
Parkinson-Syndrom und zerebrovaskuläre Morbidität
G. Ebersbach .......................................... 61
Medikamentöse Intervention beim Parkinson-Syndrom
W. Jost, W. Fogel....................................... 69
Morbus Parkinson und Diabetes mellitus
F.-J. Stein ............................................. 75
Harnblasenfunktionsstörungen bei Morbus Parkinson
A. Hendrich, W. L. Strohmaier........................... 81
Morbus Parkinson und Infektionskrankheiten
M. Körner............................................. 91
Akinetische Krisen und intensivmedizinische
Komplikationen der Parkinsonkrankheit
H. Reichmann ......................................... 97
VIII Inhaltsverzeichnis
Parkinson-Syndrom und proximale Femurfrakturen
D. Przuntek ........................................... 103
Tiefenhirnstimulation und Neuropsychologie
bei Morbus Parkinson
C. Neumann, J. Durner, W. Kaiser........................ 109
Dopaminerg-induzierte Psychosen und Halluzinationen
bei Morbus Parkinson
S. Bittkau ............................................. 117
Morbus Parkinson zwischen Innovation und
Arzneimittelbudget
G. Knaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Spielerisches Training kognitiver Funktionen
I. Gemende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Autorenverzeichnis
Dr. SIMON BITTKAU Dr. GERD FUCHS
Arzt für Neurologie, Psychiatrie Parkinson -Klinik Wolfach
und Psychotherapie Kreuzbergstr 12-16
Langgasse 14 77709 Wolfach
97753 Karlstadt
Dr. IRENE GEMENDE
Prof. Dr. THOMAS BÜTTNER Waldklinik Bernburg
Neurologische Klinik Keßlerstraße 8
Hans-Susemihl-Krankenhaus 06406 Bernburg
Bolardusstraße 20
26721 Emden Prof. Dr. WOLFGANG GREULICH
Klinik Ambrock
Dipl.-Med. ILONA CSOTI Ambrocker Weg 60
Gertrudis-Klinik Biskirchen 58091 Hagen
Karl-Ferdinand -Broll-Straße 2-4
35635 Leun-Biskirchen Dr. ALBRECHT HENDRICH
Klinikum Rodach
Dr. JOACHIM DURNER Kurring 16
Fachklinik Ichenhausen 96476 Bad Rodach
Krumbacher Straße 45
89335 Ichenhausen Prof. Dr. WOLFGANG JOST
Deutsche Klinik für Diagnostik
Dr. GEORG EBERsBAcH Fachbereich Neurologie
Neurologisches Aukammallee 33
Fachkrankenhaus für Bewe 65191 Wiesbaden
gungsstörungen/Parkinson
im Gesundheitspark Beelitz Dipl.-Psych. WALTER KAISER
GmbH Fachklinik Ichenhausen
Straße nach Fichtenwalde 16 Krumbacher Straße 45
14547 Beelitz-Heilstätten 89335 Ichenhausen
Dr. WOLFGANG FOGEL Dr. GÜNTER KNAAK
Deutsche Klinik für Diagnostik Arzt für Neurologie und
Fachbereich Neurologie Psychiatrie
Aukammallee 33 Beethovenstraße 25
65191 Wiesbaden 34346 Hann. Münden
X Autorenverzeichnis
Dr. MATTHIAs KÖRNER Dr. DIETMAR SCHÄFER
Paracelsus Elena Klinik Klinik Ambrock
Klinikstraße 16 Ambrocker Weg 60
34128 Kassel 58091 Hagen
Dr. CHRISTIAN NEuMANN Dr. FRANZ-JOSEF STEIN
Fachklinik Ichenhausen Klinik am Haussee
Krumbacher Straße 45 Buchenallee 1
89335 Ichenhausen 17258 Feldberg
Dr. DANIELA PRZUNTEK Prof. Dr.
Marien-Hospital W ALTER LUDWIG STROHMAIER
Bochum-Wattenscheid Klinikum Rodach
Parkstraße 15 Kurring 16
44866 Bochum 96476 Bad Rodach
Prof. Dr. HEINZ REICHMANN Dr. MARTIN HEINRICH
Klinik und Poliklinik für STROTHJOHANN
Neurologie Parkinson -Klinik Wolfach
Medizinische Fakultät Kreuzbergstr 12-16
Carl Gustav Carus 77709 Wolfach
Fetscherstraße 74/ Haus 27
01307 Dresden
Dr. JÜRGEN RIEKE
Arzt für Neurologie und
Psychiatrie
Frankfurter Str. 22
35392 Gießen
Morbus Parkinson und Schlaf
D. SCHÄFER, W. GREULICH
Einleitung
Der weitaus größte Teil der Parkinsonkranken wird im Lauf der Erkrankung von
Schlafstörungen betroffen. Diese spielen im Lebensalltag des Patienten eine nicht
zu unterschätzende Rolle: Karlsen und Mitarbeiter [8] konnten in einer epide
miologischen Studie an Parkinsonpatienten zeigen, dass aus der Sicht des Patien
ten der Grad der Abhängigkeit und der Schweregrad der Erkrankung erst auf den
Rängen drei und vier der Hauptursachen eingeschränkter Lebensqualität ran
gierten. An erster Stelle nannten die Befragten depressive Symptome, an zweiter
Stelle Schlafprobleme.
In einer Fragebogenaktion unter 78 konsekutiven Patienten einer Ambulanz
berichteten 66% der Parkinsonkranken über Einschlaf-und 88,5% über Durch
schlafstörungen [1]. Während neuere Arbeiten die Einschlafstörungen eher als
altersbedingt werten, lassen sich Durchschlafstörungen als charakteristisches
Merkmal der Schlafstörung des Parkinsonpatienten beschreiben [26, s. auch 17].
Die Ursachen der Ein- und Durchschlafprobleme variieren im Verlauf der
Erkrankung. In vielen Fällen liegt auch eine multifaktorielle Genese der Störung
zu Grunde.
Insbesondere die Diskussion um sogenannte Schlafattacken (oder besser:
exzessive Tagesschläfrigkeit) unter dopaminerger Medikation hat das Interesse
an der Erforschung von Vigilanzschwankungen und Schlafstörungen bei extra
pyramidalmotorischen Erkrankungen in den vergangenen Jahren wieder ent
facht [2, 5, 6,10-17,20-21,27].
Da die Grundlagenwissenschaften zum Einfluss dopaminerger Mechanismen
auf die Vigilanz und den Schlaf gegenwärtig noch keine schlüssigen Konzepte
aufweisen können, bleibt hier weiterhin ein erheblicher Forschungsbedarfbeste
hen.
Diagnostik von Schlafstörungen
SUbjektive Angaben und Fragebögen
Bereits die anamnestischen Angaben können richtungweisend für den ursäch
lichen Schwerpunkt der Schlafstörung sein. Da das übliche neurologische Unter-
2 • D. Schäfer, W. Greulich
suchungsprocedere zumeist die motorischen Defizite und Fähigkeitsstörungen
in den Vordergrund stellt, ist eine gezielte Nachfrage im Gespräch notwendig.
Allgemeine Schlaffragebögen können helfen, charakteristische Merkmale von
Schlafstörungen zu erfassen. Neben validierten, nicht erkrankungsbezogenen
Bögen zu Störungen des Schlafs (vgl. 25) wurden auch Parkinson-spezijische
Skalen wie die Parkinson's Disease Sleep Scale (PDSS) erarbeitet.
Die Ergebnisse einer derartigen Befragung können gute Anhaltspunkte für
erste Behandlungskonzepte geben. Ferner eignet sich die PDSS auch für Ver
laufskontrollen bei bekanntem schlafmedizinischen Befund. Es darf dabei
jedoch nicht übersehen werden, dass die Eigenwahrnehmung der Vigilanz, des
Schlafes und entsprechender Störungen recht unscharf ist.
N eben den Fragebögen und Skalen, die Schlafstörungen erfassen, existieren
auch validierte Instrumente zur Ermittlung der Folgen von Schlafstörungen,
zum Beispiel der subjektiven Schläfrigkeit. Die Epworth Sleepiness Scale fragt die
Einschlafneigung in monotonen Standardsituationen ab, die Stanford Sleepiness
Scale dient der momentanen Einschätzung der Wachheit.
Tedlnisdle Untersuchungsverfahren
Screeningmethoden. Zum Screening unterschiedlicher Schlafstörungen stehen
eine Vielzahl tragbarer Mess- und Aufzeichnungssysteme zur Verfügung, die
jeweils einzelne Störfaktoren erfassen können.
So existieren ambulante Schlafapnoe-Screening-Geräte, die Sauerstoffsätti
gung, Atmungsbewegungen, Puls- oder Herzfrequenz bzw. EKG, Körperlage
und gegebenenfalls weitere Messgrößen in digitalisierter Form aufzeichnen kön
nen. Ferner ist über eine Aktigraphie, d. h. die Bewegungsmessung an einer oder
mehreren Extremitäten, eine Information über das motorische Verhalten erhält
lieh. Schließlich ist auch ein Gerät auf dem Markt, das über ein Summensignal
neurophysiologischer Messungen (mit EEG, EOG und EMG-Anteilen) und einen
komplexen Auswertungsalgorithmus ein "Hypnogramm" ermittelt. Dieses Ver
fahren erscheint jedoch aufgrund der Parkinson-charakteristischen Verände
rung aller erfassten Signale wenig hilfreich, verlässliche Daten zur Entwicklung
einer Behandlungsstrategie liefern zu können. Auch die übrigen genannten
Screeningverfahren sind bei schwer schlafgestörten Parkinsonpatienten oft
wenig hilfreich, da sie nur einen Ausschnitt aus der Gesamtsymptomatik auf
zeichnen und wesentliche Störungs anteile möglicherweise nicht erfassen. Aus
diesem Grunde ist für den Fall, dass eine apparative Abklärung der Störung indi
ziert ist, zunächst eine Untersuchung mit polysomnographischer Technik anzu
raten. Verlaufskontrollen hingegen können bei klar definierter Fragestellung in
manchen Fällen durchaus mit Screeninggeräten vorgenommen werden.
Polysomnographie. Die Untersuchung im Schlaflabor erfolgt in der Regel mit
polysomnographischer Technik. Unter standardisierten Bedingungen werden
das Schlaf-EEG einschließlich Elektrookulogramm und mentalem Elektromyo
gramm, das EKG, die Atmungsbewegungen und der Atemgasfluss, die Sauer-