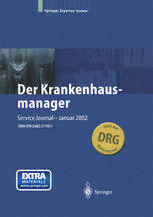Table Of ContentDieses Service Journal hält Sie mit Der Verlag achtet im Rahmen der
aktuellen Informationen über wichtige redaktionellen Möglichkeit auf eine
Entwicklungen auf dem Laufenden. bedarfsgerechte Zusammenstellung
Redaktion und Herausgeber stellen der Seiten zum schnellen Einsortieren.
das Wesentliche gut lesbar und praxis In nur wenigen Minuten aktualisieren
gerecht für Sie zusammen. Sie Ihr Nachschlagewerk.
Das Service Journal ist so konzipiert, Sollten Sie gerade keine Zeit für
dass Sie es ganz nach Ihrem indivi das Einlegen der neuen Seiten in Ihr
duellen Bedarf nutzen können. Es ist Experten System finden, so können
stabil gebunden, damit Sie es wie eine Sie das Service Journal an der Lochung
Zeitschrift lesen und sich auch zu einfach vorne in den Ordner einhängen.
Hause oder unterwegs bequem über
das Neueste informieren können. Um dieses Service Journal zu einem
wertvollen Bestandteil Ihres Springer
I
Hinweisz um Einsortieren Experten Systems zu machen,
sortieren Sie bitte die Beiträge nach
Öffnen Sie den Heftstreifen: un-serer Anleitung ein.
Entnehmen Sie zunächst Haben Sie Fragen zu Ihrem Springer
"Auf einen Blick", Experten System oder zum Service
"Themen und Berichte", und Journal? Gibt es Anregungen oder
die "Einsortieranleitung". Wünsche an die Redaktion und die
Diese Seiten werden im Nach Herausgeber? Wir helfen Ihnen gerne
schlagewerk nicht benötigt. weiter.
Fügen Sie dann bitte
unter Beachtung der Anleitung
die Seiten in Ihr Werk ein bzw. Service-Telefon:
entfernen Sie Veraltetes. freecall o8 oo-8 63 44 88
Fax: ( o 6221) 345-229
E-mail: [email protected]
Service Journal Januar 2002 Auf einen Blick
Der Krankenhausmanager
Service Journal Januar 2002
Auf einen Blick
I DRGs und Pflege: Und wieder nur das ,.Stiefkind"?
Welche Bedeutung haben die DRGs für die Pflege? Nur selten ist in der Fach
literatur die Auseinandersetzung mit diesem Thema zu finden. Im Mittel
punkt eines neuen Beitrags steht deshalb die Frage nach den Konsequenzen
für den Pflegebereich, wenn in den Krankenhäusern die Abrechnung nach
dem DRG-System eingeführt wird. Damit verbunden ist die Diskussion, wel
che Erwartungen sich dabei an die verschiedenen Ebenen der Pflegehierarchie
knüpfen. Letztlich kann es nur ein Gewinn sein, wenn alle von der Einfüh
rung der DRGs Betroffenen, und insbesondere die im Pflegebereich Tätigen,
in die Debatte mit einbezogen werden.
I Mobbing - Der Leidende ist diesmal nicht der Patient
Mobbing stellt ein zunehmendes Problem in Einrichtungen des Gesundheits
wesens dar. Es belastet dabei nicht nur das Arbeitsklima und das Wohlbefin
den Einzelner, sondern verursacht durch hohe Fluktuation, hohen Kranken
stand und verminderte Arbeitsleistung des Einzelnen betriebswirtschaftliche
Kosten in der Größenordnung von 50 ooo bis 150 ooo DM pro gemobbter Per
son und Jahr. Mittlerweile nimmt sich die Rechtsprechung verstärkt dieser
Problematik an, in der Tendenz zu Gunsten der "Gemobbten". Ein Beitrag
geht auf den Begriff Mobbing sowie die persönlichen, betrieblichen und öko
nomischen Konsequenzen ein. Die Erfahrungen der Mobbing-Beratung be
troffener Ärztinnen und Ärzten werden dargelegt aus der Sicht zweier "Mob
bingansprechpartner/innen".
Auf einen Blick Service Journal Januar 2002
I Qualitätsmanagement auf allen Ebenen
Einen Überblick über die wichtigsten Ansätze des Qualitätsmanagements zu
erlangen ist nicht einfach. Ein Kapitel versucht, Ansatzpunkte des Qualitäts
managements auf den verschiedenen Systemebenen darzustellen: Auf der Mi
kro-Ebene geht es um die Qualität der konkreten Beziehung zwischen Patient
(Leistungsempfänger) und Health Professionals (Leistungserbringer). Auf der
Meso-Ebene wird die Frage der Qualität aus der Sicht der Organisationen an
gegangen. Auf der Makro-Ebene werden Qualitätsverbesserungen mit den
Möglichkeiten des Gesetzgebers bzw. der Selbstverwaltung und der professio
nellen Vereinigungen gesucht. Und am Ende steht ein ganz aktuelles Fazit.
2
Service Journal Januar 2002 Themen und Berichte
Der Krankenhausmanager
Service Journal Januar 2002
1 Spezielle Kodierrichtlinien 1 Studiengang
1 Infektionsschutzgesetz ,.Klinisches lngenieurwesen"
1 Abfalltrennung I Doku-Serie
,.Krankenhaus lichtenberg"
Editorial
Pflege und DRGs
Das Thema DRG und die damit verbundenen Auswirkungen werfen viele
Fragen auf Welche Auswirkungen haben die DRGs auf das Krankenhaus?
Welche Investitionen sind damit verbunden? Was heißt das für die finan
zielle Situation des Hauses? Welche Umstrukturierungsmaßnahmen müs
sen vorgenommen werden? Welche Bedeutung haben aber die DRGs für
die Pflege? Nur selten wird zur letzten Frage Stellung genommen und nur
selten äußern sich im Pflegebereich Tätige in der Fachliteratur zu diesem
Thema. Es stellt sich die Frage nach dem Warum.
Die pflegerische Leistung ist neben der medizinisch-tee/wischen die
Hauptleistungsgruppe. Die Pflege befindet sich auf einem Weg der Profes
sionalisierung, ihre Bedeutung wird zunehmen. Wo aber taucht sie im
DRG- ')'Stern auf? Prof D. Hindle, Direktor der australischen esundheits
behörde AHA in Canberra, bestätigt, dass die Pflege viel zu spät in den
Prozess mit einbezogen wurde (Klinik Management Aktuell 12/2000 .
32). Auch in dem vorliegenden Modell in Deutschland erscheint die Pflege
nicht als gesonderter Leistungsträger. Eingruppierungskriterien sind al
lein Haupt- und Nebendiagnosen.
Themen und Berichte Service Journal Januar 2002
Man könnte nun sagen: Die Pflege hat zu wenig Einfluss oder ihren
Einfluss nicht geltend gemacht, sie muss - wie auch immer - mit der Ein
führung der DRGs zurechtkommen, da hilft kein jammern und kein Ze
tern. Dabei besteht jetzt für das Pflegemanagement die Chance, das DRG
System nicht nur als aufoktroyiertes Obel zu erdulden, sondern sich beim
Prozess der Implementierung zu Wort zu melden und den eigenen Stand
zu vertreten, sich Konzepte zu überlegen, in denen ihre eigene Leistung,
Wirtschaftlichkeit und Qualität ausgewogen vertreten ist und auch trans
parent wird.
Die Transparenz, die durch die Einführung der DRGs entsteht, wird
Auswirkungen auf die Pflege haben. Denn es wird zu einem indirektem
Vergleich der pflegerischen Leistung kommen, auch wenn die dazu not
wendigen Instrumentarien noch nicht feststehen oder erst noch entwickelt
werden müssen. Es liegt am Berufsstand selbst, sich konstruktiv einzu
bringen. Dass es dafür Ansätze und Wege gibt, zeigt der Beitrag von Hol
liek in diesem Service Journal .
.
/
Prof. Dr. Andrea Kerres
2
Service Journal Januar 2002 Themen und Berichte
Themen und Berichte
I Gesamtversion der Deutschen Kodierrichtlinien einschließlich
des Speziellen Teils verabschiedet
]ürgen Malzahn
Anfang September hatten die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), die
Spitzenverbände der Krankenkassen (GKV) und der Verband der privaten
Krankenversicherung (PKV) den speziellen Teil der deutschen Kodierrichtli
nien inhaltlich konsentiert. Die erste Gesamtausgabe der Deutschen Kodier
richtlinien, Version 2002 für das G-DRG-System gemäß § 17 b KHG ist im In
ternet unter der Hornepage www.gdrg.de abrufbar.
In der Vereinbarung zu den Deutschen Kodierrichtlinien haben die Ver
tragspartner festgelegt, dass die Anwendung der Kodierrichtlinien ab Veröffent
lichung empfohlen wird. Seit dem 1.1. 2002 ist die Anwendung des Allgemeinen
und Speziellen Teils der Kodierrichtlinien zur Verschlüsselung von Kranken
hausfällen für alle in § 17 b KHG genannten Einrichtungen oder Abteilungen,
die ihre Entgelte künftig über DRGs abrechnen werden, verpflichtend. Das be
deutet auch, dass die Kodierrichtlinien in Einrichtungen, die der Psychiatrie
Personalverordnung unterliegen, nicht angewendet werden müssen.
Bei der ersten Gesamtausgabe der Deutschen Kodierrichtlinien ist zu be
achten, dass durch die Arbeit am Speziellen Teil der Kodierrichtlinien auch
einige Anpassungen am bereits veröffentlichten Allgemeinen Teil notwendig
geworden sind. Beispielsweise wurden Modifizierungen der Verschlüsselung
von Reoperationen vorgenommen, weil für die Verschlüsselung von Reopera
tionen in der Herzchirurgie eine von den allgemeinen Richtlinien abweichen
de Form der Verschlüsselung durchzuführen ist. Der weitaus überwiegende
Anteil des Allgemeinen Teils der Kodierrichtlinien bleibt aber unverändert.
Die erste verbindliche Version der Deutschen Kodierrichtlinien ist mit einem
neuen Nummerierungssystem ausgestattet, das es in Zukunft erlauben wird,
die Häufigkeit der Änderungen einzelner Kodierrichtlinien an der einzelnen
Nummer zu erkennen. Außerdem wurde berücksichtigt, dass zum 1. 1. 2002
die Version 2.1 des Operationenschlüssels nach § 301 SBG V für die Verschlüs
selung von Krankenhausfällen zu verwenden ist. Bei der praktischen Umset
zung der Verschlüsselung gemäß der Kodierrichtlinien sollten Übergangsre-
3
Themen und Berichte Service Journal Januar 2002
geln für die Verschlüsselung nach Bundespflegesatzverordnung sowie die Hin
weise zur Mehrfachkodierung in Verbindung mit den Erfordernissen der Da
tenübermittlung gemäß den Anlagen zu § 301 SGB V beachtet werden.
Der Spezielle Teil der Kodierrichtlinien gliedert sich insgesamt in acht
zehn Kapitel, die sich an den Kapiteln des ICD-1o-SGB V orientieren. Damit
wird dem australischen Vorbild und auch dem Aufbau der australischen
DRG-Klassifikation gefolgt. Bei der Bearbeitung des Speziellen Teils der Ko
dierrichtlinien wurde grundsätzlich wie folgt vorgegangen: Alle australischen
Speziellen Kodierrichtlinien wurden übersetzt und sofern erforderlich um An
teile reduziert, deren Adressat offensichtlich australische klinische Kodierer
sind. Grund hierfür ist, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Deutschland
davon ausgegangen werden kann, dass die Verschlüsselung von Diagnosen
und Prozeduren überwiegend von ärztlichem Personal durchgeführt wird. In
sofern reduziert sich für Deutschland der Erklärungsbedarf medizinischer
Sachverhalte im Kontext der Kodierung. Außerdem wurden australische Ko
dierrichtlinien nicht übernommen, deren Inhalte in Deutschland aus rechtli
chen Gründen nicht zulässig sind.
Die einzelnen Kapitel des Speziellen Teils der Deutschen Kodierrichtlinien
sind unterschiedlich umfangreich. Ein Zusammenhang zwischen der Häufig
keit einzelner Krankheitsbilder und der Berücksichtigung in den Kodierricht
linien ist nicht gegeben. Dies ist auch nicht erforderlich, weil das Aufstellen
spezieller Kodierrichtlinien nur erfolgt ist:
I wenn von den Allgemeinen Kodierrichtlinien abgewichen werden muss;
I wenn Kodierrichtlinien aus dem Allgemeinen Teil durch konkrete Bei
spiele näher erläutert werden müssen;
I wenn die Kodierung in der australischen Praxis offensichtlich zu Proble
men geführt hat.
Aus Zeitgründen musste m der ersten Version der Deutschen Kodierrichtli
nien darauf verzichtet werden, spezielle Probleme bei der Kodierung abzufra
gen und einzuarbeiten bzw. spezifisch deutsche Kadierproblerne theoretisch
zu antizipieren.
Von interdisziplinärer Bedeutung sind die Richtlinien für die Kodierung
von Chemotherapie, Strahlentherapie und Dialysebehandlung: In diesen drei
Bereichen richtet sich die Zuweisung der Hauptdiagnose nach der Aufent
haltsdauer der Patienten.
4
Service Journal Januar 2002 Themen und Berichte
Werden Patienten zur Chemo- oder Strahlentherapie aufgenommen und
verlassen das Krankenhaus noch am gleichen Tag, sind die jeweiligen Haupt
diagnosen aus dem Kapitel XXI der ICD-10 (Z51 - Sonstige medizinische Be
handlung) zu verwenden und die begründenden bösartigen Neubildungen als
Nebendiagnosen anzugeben. Sind Patienten für mehrere Tage wegen einer
Chemo- oder Strahlentherapie in stationärer Behandlung, wird das jeweilige
Malignom bzw. dessen aktuell zu behandelnden Metastasen die Hauptdia
gnose des stationären Aufenthalts.
Bei der Dialyse ist diese Richtlinie ähnlich; allerdings ist ein Schlüssel aus
Z49 (Dialysebehandlung) auch zu verwenden, wenn die gesamte Aufenthalts
dauer 24 Stunden nicht überschreitet. Damit wird der Tatsache Rechnung getra
gen, dass Dialysebehandlungen über Nacht nicht wie "echte" mehrtägige statio
näre Aufenthalte kodiert werden. Bei der Kodierung längerer Krankenhausfälle
ist die begründende Nierenerkrankung als Hauptdiagnose anzugeben und die
Dialyse als Nebendiagnose zu verschlüsseln, sofern die Dialyse der Grund für
die stationäre Aufnahme gewesen ist. Die Prozedurenverschlüsselung für Che
motherapie, Strahlentherapie und Dialysebehandlung ist unterschiedlich gere
gelt, aber nicht von der Dauer des stationären Aufenthalts abhängig.
Für die praktische Umsetzung des Speziellen Teils der Kodierrichtlinien ist
im Gegensatz zum Allgemeinen Teil zu beachten, dass es sicherlich nicht er
forderlich ist, dass jeder Arzt alle Speziellen Kodierrichtlinien inhaltlich bis
ins letzte Detail kennt. Jedoch ist in geeigneter Form sicherzustellen, dass alle
Ärzte eine Gesamtausgabe der Kodierrichtlinien zur Verfügung gestellt be
kommen. Damit soll bei Krankheiten, für die Spezielle Kodierrichtlinien gel
ten, auf die Existenz der Richtlinien hingewiesen werden (z. B. mit einer Liste
der Krankheiten oder einer Liste der !CD-Schlüssel), da nahezu jede Krank
heit als Nebendiagnose in anderen Fachgebieten vorkommen kann.
I Umfassende Novellierung des Seuchenrechts
Hermann Fenger
Wir hatten in den "Themen und Berichten" schon kurz darauf hingewiesen,
dass am 1. 1. 2001 das Infektionsschutzgesetzes IfSG in Kraft getreten ist. Da
die Bedeutung des Gesetzes in der Praxis oft nicht ausreichend bekannt ist,
sollen an dieser Stelle die speziell für den Krankenhausbereich geltenden Re
gelungen dargestellt werden.
5
Themen und Berichte Service Journal Januar 2002
Mit dem IfSG wurden gleichzeitig das bisherige Bundesseuchengesetz, das
Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, die Laborberichtsverord
nung, die Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht auf humanen
spongiaformen Enzephalopathien, ferner die erste und zweite Verordnung zur
Durchführung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten so
wie die Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 3 des Bun
desseuchengesetz außer Kraft gesetzt.
Das Gesetz bezweckt, übertragbaren Krankheiten vorzubeugen, Infektionen
frühzeitig zu erkennen und deren Weiterverbreitung zu verhindern. Das Ro
bert-Koch-Institut RKI in Berlin erhält eine zentrale Position und wird epide
miologisches Zentrum. Das RKI erstellt im Benehmen mit den jeweils zuständi
gen Bundesbehörden für Fachkreise als Maßnahme des vorbeugenden Gesund
heitzsschutzs Richtlinien, Empfehlungen, Merkblätter und sonstige Informatio
nen zur Vorbeugung, zur Erkennung und zur Vermeidung der Weiterverbrei
tung übertragbarer Krankheiten. Entsprechend den epidemiologischen Erfor
dernissen hat es Kriterien für die Übermittlung eines Erkrankungs- oder Todes
falles oder eines Nachweises von Krankheitserregern zu erarbeiten.
Meldepflichtige Nachweise von Krankheiten (§ 6 IfSG). Nach § 6 IfSG sind
im dortigen Katalog aufgeführte Krankheiten gegenüber dem zuständigen
Gesundheitsamt meldepflichtig. Beispielhaft sei hier auf akute Virus-Hepa
titis, Meningokokken-Meningitis oder Sepsis sowie Milzbrand verwiesen.
Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern (§7 IfSG). Melde
pflichtig sind bei bestimmten Krankheitserregern der direkte oder indi
rekte Nachweis, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen.
§ 7 IfSG enthält einen entsprechenden Katalog. Beispielhaft seien hier
Gelbfiebervirus, Hepatitis-A/B/C/D/E-Virus, Lassavirus und Salmonellen
genannt.
Meldepflichtig ist der feststellende Arzt. In Krankenhäusern oder anderen
Einrichtungen der stationären Pflege ist für die Einhaltung der Meldepflicht
neben dem feststellenden Arzt auch der leitende Arzt zuständig. In Kranken
häusern mit mehreren selbständigen Abteilungen ist der leitende Abtei
lungsarzt, in Einrichtungen ohne leitenden Arzt ist der behandelnde Arzt
verantwortlich.
6