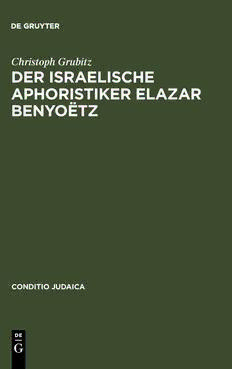Table Of ContentConditio Judaica 8
Studien und Quellen zur deutsch-jüdischen Literatur- und Kulturgeschichte
Herausgegeben von Hans Otto Horch
in Verbindung mit Itta Shedletzky
Christoph Grubitz
Der israelische Aphoristiker
Elazar Benyoetz
Mit einem Geleitwort
von Harald Weinrich
Max Niemeyer Verlag
Tübingen 1994
In Erinnerung an meine Mutter
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Grubitz, Christoph: Der israelische Aphoristiker Elazar Benyoetz / Christoph Grubitz. Mit
einem Geleitwort von Harald Weinrich. - Tübingen: Niemeyer, 1994
(Conditio Judaica ; 8)
Zugl.: Freiburg (Schweiz), Univ., Diss., 1993
NE: Conditio ludaica
ISBN 3-484-65108-3 ISSN 0941-5866
© Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG, Tübingen 1994
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Druck: Weihert-Druck GmbH, Darmstadt
Einband: Hugo Nadele, Nehren
Inhalt
Geleitwort IX
Einleitung . l
l Reflexion auf Sprachmagie und Moralistik: Benyoetz' poetische
Verfahrensweisen 8
l. l Semantische Pointierungsweisen 9
1.1.1 Die bildgleiche Fortführung erstarrter Metaphern 10
1.1.2 Die Verknüpfung von Redensarten zu Priameln 16
1.1.3 Die Personifizierung handlungsorientierender Abstrakta 25
1.1.4 Witzige Kombination und 'Kubistik' des Einwortspiels 29
Ergebnisse 35
1.2 Poetische Überformung der Prosa 36
1.2.1 Lautliche Äquivalenz und sachliche Analogie 37
1.2.2 Ironische Klangmagie 47
1.2.3 Parallelismus membrorum und Rhetorisierung der Parataxe ... 52
Ergebnisse 59
1.3 Selbstbewußtes Sprechhandeln 60
1.3.1 Feststellungen mit offenem propositionalen Gehalt 61
1.3.2 Aufgehobene Handlungsregeln 63
Ergebnisse : 70
1.4 Witz und Ethik des Zitierens 70
1.4.1 Anspielung als Rettung 72
1.4.2 Kontrafaktur als Neubestimmung der Vorlage 77
1.4.3 Collage als Emanzipation des Zitats vom Aphorismus 82
Ergebnisse 86
VI
2 Sprachwitz in theologischen und poetologischen
Zusammenhängen: Benyoetz' Sujets
2.1 Paradies und Sündenfall 89
2.1.1 Gott als Vertragspartner 91
2.1.2 Die Genesis als Geschichte der Sprachentstehung 96
2.1.3 Der Sündenfall als Bedingung von Freiheit und
Verantwortung 100
Ergebnisse 103
2.2 Die Sprache 104
2.2.1 Epistemologischer Aspekt: Die Sprache als Mittel der
Erkenntnis 105
2.2.2 Ethischer Aspekt: Die Sprache als Mittel der
Handlungsorientierung 109
2.2.3 Poetischer Aspekt: Die Sprache als Medium und Sujet 113
Ergebnisse 116
2.3 Die eigene Schreibweise 117
2.3.1 Aphoristik 117
2.3.2 Wortspiel 120
2.3:3 Kürze 122
2.3.4 Interpunktion 124
Ergebnisse 127
2.4 Die Erinnerung 128
2.4.1 'Erinnerung' und 'Gedächtnis' 128
2.4.2 Erinnerung und Totengedenken 132
Ergebnisse 135
3 'Einsatz', Buchtyp und Gattung: Benyoetz' Auffassung
der literarischen Aphoristik 136
3. l Dominante Merkmale 137
3.1.1 Rhythmisierung 142
3.1.2 Segmentierung und Zentrierung 147
3.1.3 Verkettung 152
3.1.4 Collage 157
Ergebnisse 163
νπ
3.2 Zwei Schl sseltraditionen 164
3.2.1 Skeptische Spruchdichtung: Kohelet 166
3.2.2 Sprachreflexive Aphoristik 170
Ergebnisse 176
Literaturverzeichnis 178
Anhang: Elazar Benyoetz: ICHMANDU oder:
Was nicht trifft, kommt nicht an.
Briefe an Christoph Grubitz 1987 bis 1992 192
Geleitwort
Vom Roman, dieser lexikalisch aufwendigsten und beim Lesepublikum
erfolgreichsten aller literarischen Gattungen, fast aussichtslos in die Enge
getrieben, hat der Aphorismus in der deutschen Literatur der jüngeren Zeit
nur noch wenig von sich sich vernehmen lassen. Gibt es diese literarische
Gattung überhaupt noch? Haben die Lichtenberg, Friedrich Schlegel, Nova-
lis, Schopenhauer und Nietzsche keine Nachfolger mehr in dieser hellsichti-
gen Kunst gefunden? Warum kann unter den Heutigen niemand mehr so
scharf züngig entlarven, dem verkehrten Denken so klar auf den Grund sehen
wie Karl Kraus?
Es mußte wohl einer von außen kommen, einer wie der deutschschrei-
bende Israeli Elazar Benyoetz, um den Aphorismus neu in die deutsche Lite-
ratur einzupflanzen, als ein zartes Gewächs, doch winterhart geworden in
kalten Zeiten. So haben wir nun wieder einen sprachmächtigen Aphoristiker
deutscher Zunge.
Hier stocke ich. Wer hat hier das Recht, »wir« und »uns« zu sagen? Denn
»wir« haben ja Benyoetz vom Grund und Boden dieser Sprache vertrieben,
durch »uns« ist der Autor ein Fremder geworden in diesem Land, dieser
Sprache.
Oder verhält es sich gerade umgekehrt? Einer, der jetzt zwischen den
streng mit den Menschen redenden Steinen Jerusalems lebt, ist der deutschen
Sprache aufs engste verbunden geblieben, und wir, die wir weiterhin hierzu-
lande heimisch sind, haben uns von dieser Sprache, die wir vollmundig spre-
chen, im Eilschritt entfernt?
Der Aphorismus - eine eigenartige Gattung. Sie ist, außer durch ihre
knappe, prägnante, pointierte Form, auch durch ihren Inhalt definiert: Apho-
ristik als Moralistik. Bei Elazar Benyoetz ist diese Kunst, über die europäi-
sche Literatur hinweg, auch mit der hebräischen Spruchdichtung verwandt.
Besonders der Prediger Salomo, Kohelet, steht ihm nahe als einer, der gottes-
fürchtig zu denken übrig läßt.
In Christoph Grubitz, dem Verfasser dieser Buches, hat Elazar Benyoetz
einen Interpreten gefunden, der den hohen Ansprüchen der Gattung und des
Autors gerecht wird. Man kann sein Buch also, entweder vor oder nach der
Benyoetz-Lektüre, mit der Erwartung öffnen, in ihm die Gattung und ihre
von Elazar Benyoetz neuentdeckte Art genau beobachtet und zutreffend
beschrieben zu finden. Man darf folglich auch gewiß sein, bei der Lektüre
und Betrachtung dieses Gegenstands ein Stück mehr von der Sprache, von
der Welt zu verstehen.
Harald Weinrich
Professor am College de France, Paris