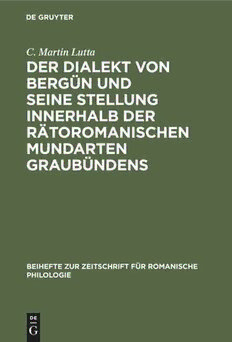Table Of ContentBEIHEFTE
ZUR
ZEITSCHRIFT
FÜR
ROMANISCHE PHILOLOGIE
BEGRÜNDET VON PROF. DK. GUSTAV GRÖBER F
FORTGEFÜHRT UND HERAUSGEGEBEN
VON
DR. ALFONS HILKA
PROKKSSOR AN DER UNIVKRS1TÄT GÖTTINGKN
LXXI. HEFT
C. MARTIN LUTTA
DER DIALEKT VON BERGÜN UND SEINE STELLUNG INNERHALB
DER RÄTOROMANISCHEN MUNDARTEN GRAUBÜNDENS
HALLE (SAALE)
VERLAG VON MAX NIEMEYER
1923
DER
DIALEKT VON BERGÜN
UND SEINE STELLUNG
INNERHALB DER RÄTOROMANISCHEN
MUNDARTEN GRAUBÜNDENS
vox
C. MARTIN LUTTA
m
m
HALLE (SAALE)
VERLAG VON MAX NIEMEYER
I923
Geleitwort.
Der Verfasser dieser Arbeit gehört nicht mehr zu den Lebenden.
In den stürmischen Novemberlagen des Jahres 1918, als die Grippe
unter unsern Truppen wütete, vermochte sein durch frühere Krank-
heiten geschwächter Körper nicht zu widerstehen. Er entschlief
mit einem Lächeln anf den LippeD, im Alter von 32 Jahren. Er
hatte sich gefreut, unter der Leitung von Prof. Dr. C. Pult an den
Arbeiten des Idiotikons der rätischen Schweiz tätigen Anteil zu
nehmen. Zu dieser Aufgabe schien er prädestiniert. Nach einem
Beisammensein von kaum vier Monaten mufste Herr Pult den
warmen Nachruf schreiben, der in den Annalas della Società reto-
romantscha, Bd. XXXIII, p. 239—251, zu lesen ist.
Das schönste Denkmal hat sich Herr Lutta selber in diesem
seinem Werke gesetzt. Langsam war es herangereift. Als echter,
bedächtiger Bündner, unablässig feilend, hatte er es lange nicht
gut genug befunden. Den Tag vergesse ich nicht, wo er mir
endlich, mit verlegenem Stolz, das saubere, fünfbändige Manuskript
seiner Dissertation brachte. Als ob er eine Ahnung gehabt hätte,
war das ganze Ausmafs seiner Fähigkeiten hineingelegt. Der Arbeit
durfte das beste der üblichen Prädikate zuerteilt, werden. Das
mündliche Examen, das am 21. Juli 1917 abgelegt wurde, bestätigte
den vorzüglichen Eindruck, den Lutta als Student gemacht hatte.
Während das Oberland und das Engadin in prächtigen Mono-
graphien durchforscht waren, harrte Mittelbünden noch auf eine
tiefere Behandlung. Wohl hatte Herr Dr. J. Luzi in seiner Laut-
lehre der sutselvischtn Dialekte, Zürcher Dissertation von 1904, die
ersten guten Spatenstiche getan. Aber er hatte das Gebiet un-
mittelbar nördlich des Albula-Massivs nur als Randstreifen be-
trachtet, und vor allem hatte die Wissenschaft mittlerweile höhere
Forderungen aufgestellt. Die Mundart des bis zur Erstellung der
Albula-Bahn (1903) ziemlich auf sich gestellten und daher lautlich
und lexikologisch originellen Bergün empfahl sich als willkommenes
Objekt. Sie war durch die genialen Angaben Ascolis, nach schrift-
lichen Dokumenten und eigenen Aufzeichnungen (s. Saggi ladini,
p. 119), sowie durch die grundlegenden Tabellen Gärtners (.Raeto-
romanische Grammatik und Handbuch der raelo - romanischen Sprach*
VI
und Literatur, littera g) nur unvollkommen bekannt. Andere Forscher
hatten sie nur gelegentlich berührt.1
Herr Lutta hätte nun einfach die vorbildliche Studie des
Schweden Walberg, Saggio sulla fonética del parlare di Celerina-Crtsta,
Lund 1907, zum Muster nehmen können, die die Lautverhältnisse
jenseits der Berge im Oberengadin schildert. ' Der EinSufs dieses
Werkes ist auch unverkennbar. In Graphie und Anordnung des
Stoffes lehnt sich Lutta daran an in dem Matee, wie ein nach Un-
abhängigkeit Ringender sich anlehnt.1 Huonders von Einfällen
strotzende, kühn konstruierende, blitzartig aufbellende Art war ihm
nicht gegeben (Der Vokalismus der Mundart von Disentís, iqoi).
Seine Natur war klug abwägend und doch, nach reiflicher Über-
legung, [energisch vorstofsend. Am meisten Eindruck scheint ihm
die tief ausschöpfende und weitblickende Monographie Dr. F. Fank-
hausers über Das Patois von Val d'Illiez (Wallis), iQii, gemacht
zu haben. Wie dieser läfst er die Punkte, in denen der Lautstand
von Bergün nichts Eigenes hat, zurücktreten und belegt alles Be-
sondere mit langen Reihen von Beispielen aus dem gesamten Wort-
schatz. Wie dieser läfst er eine Menge seltener Wörter, Pflanzen-
und Ortsnamen hereinfliefsen. Er ist überhaupt bestrebt, den immer
wieder zitierten Normalwörtern aus dem Wege zu gehen und
seiner Darstellung durch Nennung des Eigentümlichen und Lokalen
neue Reize zu verleihen. Da bei dem Umfang der Arbeit ein Re-
gister des verwendeten Materials umgangen werden mufste, ist überall,
wo der Sinn sich nicht von selbst ergibt, eine deutsche Übersetzung
beigegeben, auf deren Prägung viel Scharfsinn verwendet wurde.
Das ist besonders für diejenigen, denen das Rälische nicht geläufig
ist, eine angenehme, wenn auch Platz raubende Zugabe.
Luttas Genauigkeit und Aufrichtigkeit hätten nicht zugegeben,
dafs Wörter, die zu der Formulierung der Lautregeln nicht stimmen,
verschwiegen worden wären. Als Bündner, der von Jugend auf
das Zaozer Engadinisch sprach, besafs er den Vorteil, leichter als
ein Fremder erkennen zu können, welche Einflüsse störend wirkten.
Besonders in den heiklen Lehnwortfragen von Sprache zu Sprache
oder von Dialekt zu Dialekt besafs er ein seltenes Urteilsvermögen.
Aber oft genug muís auch er mit Erklärung zurückhalten.
Die Zuverlässigkeit der Notierungen ist kaum zu übertreffen.
Bei Anlafs einer dialektologischen Exkursion des romanischen
Seminars hatten wir Gelegenheit, die außergewöhnliche Feinheit
seines Ohrs zu beobachten. Er hörte noch Unterschiede, wo wir
andern alle versagten. Er hat auch die Niederschriften Ascolis,
Gärtners und Luzis vielfach beanstandet In seinem Transkription s-
1 Seit Lutta hat Herr Dr. Scheuermeier für dtn so verdienstvollen und
ergebnisreichen Schweiz.-oberital. Sprachatlas der Herren Jud und Jaberg im
nahegelegenen Latsch eine Normalaufnahme gemacht.
Natürlich nützte Lutta nach Kräften die Winke aus, die Herr Jud in
leintr bedeutenden Besprechung Walbergs gegeben hatte.
VII
system finden sich u. a. 6—7 verschiedene f-Laute, doch macht
er in der eigentlichen Arbeit nicht von allen Gebrauch. Ein be-
sonderes akustisches Sensorium war bei einem Dialekt vonnöten,
der unglaubliche Kombinationen wagt, wie aviok^is „Bienen", artfts
„Bogen", krokfts „Kreuze", pri'itßs „Preise" etc.
Was jedoch dieses Buch über den Rahmen einer Monographie
hinauswachsen läfst, ist das Bestreben, das im Untertitel zum Aus-
druck kommt, die Stellung dieses Dialekts im Gesamtbild der
Mundarten Graubündens genau zu bezeichnen. Die kleinsten Unter-
schiede von einem Gewährsmann zum andern einerseits, die Ab-
weichungen und Zusammenhänge innerhalb der Gegend und des
ganzen romanischen Teiles des Kantons andrerseits machen das
Wesen der Arbeit aus, die, von synoptischen Tabellen durchzogen,
zu einem Vademecutn des Rätologen wird. Wer es studiert, dringt
mit dem Verfasser in den lebendigen Kern der Mundart ein und
hat die Illusion, diese Sprache gehört und gelernt zu haben. In
den Schlussparagraphen werden die Charakteristika nochmals nach
allen Seiten abgegrenzt. Wenn auch die morphologischen und
lexikologischen Divergenzen nur zum Teil berücksichtigt sind, so
hat sie der Verfasser doch beständig vor Augen gehabt, so dafs
das Schlufsergebnis, dafs die Bergüner Mundart ein nidwaldisches
Snbstratum mit engaJinischer Übermalung darstellt, nicht Gefahr
läuft, neu gestellt und gelöst zu werden. Dieses Resultat bestätigt
das, was Lutta in seinem ausführlichen Einleitungskapitel vom histo-
rischen und verkehrsgeschichtlichen Standpunkte voraussagt.
Im übrigen möge das Buch für sich seiher sprechen. Aufser
der Formenlehre wird man alles darin finden, was man suchen mag,
sei es die ganz eigenartige Latinität Graubündens, sei es die ge-
duldige Erforschung einzelner Probleme. Noch nie wurden z. B.
die von Gärtner als „verhärtete Diphthonge" bezeichneten Kom-
binationen i'k, ek, ik, ok, uk aus früherem »', ei, ti, 011, uu so ein-
gehend und fördernd besprochen (vor allem in den §§ 331 ff.).
Die Frankoprovenzalisten sprechen da mit Gillieron von einem
„k parasite". Es ist einer der auffallendsten Züge, die die Sprache
östlich und westlich des Gotthard verbinden. Bergün ist in diesem
Punkte besonders konsequent und archaistisch. Die Erscheinung
war bei der Auswahl des Themas mitbestimmend.
Es wäre unverantwortlich gewesen, eine solche Arbeit nach
dem Tode des Verfassers in einer Schublade zu bergen. Zum Glück
waren ein Bruder Martin Luttas, der schon während seiner Studien
Opfer gebracht hatte, und die Mutter bereit, die Kosten des Druckes
zu übernehmen. Das Manuskript war aber nicht druckfertig, und es
bedurfte der entsagungsvollen, langwierigen Arbeit zweier Freunde
des Verstorbenen, der Herren Jud und Fankhauser, um es her-
zurichten, auf den Stand der inzwischen fortgeschrittenen Wissen-
schaft zu bringen, die ausführlichen Register zu verfassen und den
schwierigen Druck zu überwachen. Für die Duichführung dieser
nicht einfachen Aufgabe sind wir alle, denen lebendiges Wissen
VIII
am Herzen liegt, beiden herzlich verpflichtet. Auch die Herren
Pnlt und cand. phil. R. Vieli haben teilweise mitkorrigiert Unser
Dank sei aber auch dem Verleger, Herrn Dr. M. Niemeyer, aus-
gesprochen, der in dieser schlimmen, bücherlosen Zeit das Unter-
nehmen wagte. Die Offizin Karras, Kröber & Nietschmann in
Halle a.S. hat den schwierigen Satz, wie gewohnt, glänzend be-
wältigt.
Möge dieses mit Liebe geschriebene Werk, das nun anch ein
Denkmal der Bruder- und Freundesliebe geworden, einer Sprache,
die um ihre Existenz kämpft, neue Freunde werben.
Zürich, Januar 1923.
L. Gauchat
# * *
Dem warm empfundenen Vorwort wünschen die beiden Heraus-
geber nur noch einige Worte beizufügen. Martin Lutta plante,
vor dem Drucke mehr als ein Kapitel seiner Arbeit noch um-
zugestalten und an gewissen Stellen noch tiefer zu schürfen; er ge-
dachte ferner, auf den Rat von J. Jud, das Wörterbuch an die
Spitze der Monographie zu stellen, um so die Wiederholung der
Bedeutungen bei jedem einzelnen Worte zu vermeiden. Die Um-
arbeitung, wie die Bereitstellung des (etymologischen) Wörterbuches
steckte leider Ende 1918 durchaus in den Anfängen. Zum Glück
hatte der eine Herausgeber dem Werdegang der Arbeit von früh
an so nahe gestanden und mit Martin Lutta als einem seiner
Studenten und Freunde so oft gemeinsam fesselnde Probleme
durchbesprochen, dafs er die Verantwortung übernehmen zu dürfen
glaubte, getreu den ihm bekannten Intentionen des Verfassers und
gemeinsam mit F. Fankhauser, das Manuskript für den Druck vor-
zubereiten. Wir haben uns in engster Zusammenarbeit nicht ge-
scheut, formell und stilistisch überall da einzugreifen, wo die Aus-
feilung der Darstellung noch im Rückstände war, wir bauten
einzelne etwas zu summarisch dargestellte Probleme aus, die
Martin Lutta vor dem Drucke selbst wohl in Angriff genommen
hätte; doch haben wir anderseits aus Pietät den ursprünglichen
Text — selbst wenn er etwa Wiederholungen enthielt — wo
immer angängig, intakt gelassen. Bis 1920, d. h. dem Zeitpunkte,
da der Druck begann, wurde auch die Bibliographie nachgefühlt.
Eine besonders heikle Frage war die Vereinheitlichung der Tran-
skription. Martin Lutta hatte während der Abfassung Seiner
Dissertation in mehreren wichtigen Punkten das Passysche System
dem Rätischen angepafst und es vereinfacht, aber die Einheits-
transkription in der ganzen Arbeit durchzuführen, war ihm nicht
mehr möglich geworden. Soweit als möglich galt es auch hier
IX
den letzten Absichten des Verfassers gerecht zu werden. Die
Indices hat J. Jud, die Karte F. Fankhauser beigesteuert.
Und nun, Martin Lutta, soll dein Werk zeugen für den nur
durch den unerbittlichen Tod gebrochenen Willen, ein deiner
Familie, deiner Lehrer und deines rätischen Heimatlandes würdiges
Denkmal zu schaffen. Deine Freunde allerdings hätten dich auch
ohnedies in ihrer Erinnerung festgehalten als einen jener Menschen,
mit denen ein Stück Weges zusammenzugehen einen Glücksfall
ihres Lebens bedeutet.
J. Jud. F. Fankhauser.