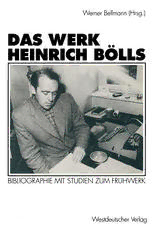Table Of ContentWerner Bellmann (Hrsg.)
Das Werk Heinrich Bölls
Werner Bellmann (Hrsg.)
Das Werk
Heinrich Bölls
Bibliographie mit Studien
zum Frühwerk
Westdeutscher Verlag
Alle Rechte vorbehalten
© 1995 Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen
Der Westdeutsche Verlag ist ein Unternehmen der Bertelsmann Fachinformation.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbe
sondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und
die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Horst Dieter Bürkle, Darmstadt
Titelbild: Heinrich Böll an seinem Schreibtisch, 1952; Fotograf: Hans Lenz, Bergisch-Gladbach
Gedruckt auf säurefreiem Papier
ISBN 978-3-531-12694-4 ISBN 978-3-322-92512-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-92512-1
Inhalt
Vorwort ................................................................................................................. 7
Teil A: Studien zum Frühwerk
Werner Bel/mann
Das literarische Schaffen Heinrich Bölls in den ersten Nachkriegsjahren.
Ein Überblick auf der Grundlage des Nachlasses .................................................. 11
Gabriele Sander
Unbekannte Varianten bekannter Erzählungen aus der Frühzeit Bölls.
Über ästhetische und verlagspolitische Hintergründe von TexteingrifIen .............. 31
Beate Schnepp
Die Aufgabe des Schriftstellers. Bölls künstlerisches Selbstverständnis
im Spiegel unbekannter Zeugnisse ....................................................................... 45
Gabriele Sander
Die Last des Ungelesenen. Heinrich Böll und die literarische Modeme ................ 61
Michael Okroy
Räsoneur im Wartesaal. Konfession und Zeitkritik in Bölls früher
Erzählung In guter Hut... . ................................................................................... 89
Beate Schnepp
Die Architektur des Romans. Zur Komposition von Heinrich Bölls
Wo warst du, Adam? ......................................................................................... 109
Teil B: Bibliographie (1947-1994)
Einfiihrende Hinweise ........................................................................................ 127
I. Schriften: Erstveröffentlichungen und Buchausgaben .................................. 131
II. Gedruckte Briefe von und an Heinrich Böll ................................................. 222
111. Interviews und Gespräche ........................................................................... 231
IV. Heinrich Böll als Herausgeber und Mitherausgeber.. ................................... 249
V. Übersetzungen von Annemarie und Heinrich Böll... .................................... 250
Namenregister ................................................................................................... 259
Verzeichnis der Titel-Varianten ......................................................................... 264
Titelregister ....................................................................................................... 277
Vorwort
"Bölls literarische Anfange sind heute noch nicht durchleuchtet. Die
ersten Versuche der dreißiger Jahre sind im Krieg vernichtet worden.
Der Neubeginn zwischen 1945 und 1947 ist noch nicht dokmnen
tiert." (Klaus Schröter, 1982)
"Die Böll-Forschung hat in den letzten Jahren an Intensität und Er
trägen erheblich zugenonunen [. . .]. Dennoch stehen wir noch vor dem
Beginn einer wirklichen Böll-Philologie [. . .]." (Bemd Balzer, 1992)
Am 16. Juli 1995 jährt sich zum zehnten Mal der Todestag Heinrich Bölls. Die zu
rückliegenden Jahre haben gezeigt, daß das Interesse an Werk und Person des
Autors keineswegs nachgelassen hat. Ein sichtbares Zeichen dafiir war vor allem
die außerordentliche Resonanz, die die Veröffentlichung des Romans Der Engel
schwieg im Jahre 1992 gefunden hat, der ersten größeren Prosaarbeit Bölls, die aus
dem Nachlaß herausgegeben und inzwischen in zahlreiche Sprachen übersetzt
wurde. Zu konstatieren ist indes nicht nur das ungebrochene Interesse des Leser
publikums; auch die wissenschaftlichen Bemühungen um die philologische Aufar
beitung und interpretatorische Erschließung des Böllschen <Euvres sind in den
vergangenen Jahren intensiviert worden.
Dennoch blieb eine vollständige bibliographische Erfassung der Schriften
Heinrich Bölls und damit ein zuverlässiger Überblick über das Lebenswerk des
Nobelpreisträgers bis heute ein Desiderat. Die Veröffentlichung der letzten umfas
senden Verzeichnisse seiner Werke, Interviews und Übersetzungen - durch Werner
Martin und Werner Lengning - liegt fast 20 Jahre zurück. Die nun anläßlich des
10. Todestages vorgelegte Bibliographie schafft durch die Erweiterung des Be
richtszeitraums sowie durch den Nachweis zahlreicher neuentdeckter Texte und
korrigierter Daten erstmals eine gesicherte Grundlage für alle weiterführenden
Beschäftigungen mit dem Autor und seinem Werk. Von der Böll-Forschungsstelle
der Bergischen Universität Wuppertal erarbeitet wurde ein die Jahre 1947 bis 1994
umfassendes chronologisches Verzeichnis sämtlicher Erstveröffentlichungen sowie
der relevanten Neudrucke und Sammelausgaben. Durch systematische Recherchen
und durch die Überprüfung aller bislang erfaßten Daten konnten viele, teilweise
seit Jahrzehnten tradierte Irrtümer beseitigt, überdies mehr als 100 in den vorlie
genden Werkausgaben nicht enthaltene Texte des Autors nachgewiesen werden.
Der etwa 850 Einzeltitel verzeichnende zentrale Teil wird ergänzt durch separate
Zusammenstellungen der im Druck vorliegenden Briefe und Interviews sowie der
von Annemarie und Heinrich Böll angefertigten Übersetzungen. Die den Hauptteil
der Bibliographie erschließenden Titel- und Namenregister komplettiert ein rund
600 Einträge umfassendes Verzeichnis (Titel-Varianten), das die Identifizierung
und Zuordnung von Texten und Textteilen ermöglicht, die unter divergierenden
Titeln publiziert wurden.
Abgerundet wird der Band durch sechs Aufsätze, in denen erstmals aus dem
Nachlaß gewonnene Erkenntnisse fruchtbar gemacht werden. Gegenstand der Stu
dien ist vornehmlich Bölls erste Arbeitsphase nach dem Krieg, deren wissenschaft-
8 Vorwort
liche Aufarbeitung besonders starke Defizite aufweist, die aber bevorzugt Aufmerk
samkeit verdient, weil sie zum Ausgangspunkt wurde für ein Schaffenskontinuum,
in dem sich über vier Jahrzehnte hinweg die Aneignung und kritisch-engagierte
Verarbeitung erlebter deutscher Nachkriegsgeschichte vollzieht. Dargestellt werden
- unter Berücksichtigung des bislang Unpublizierten - Themen, Tendenzen und
zentrale Aspekte des Frühwerks sowie die Herausbildung von Bölls künstlerischem
Selbstverständnis, das sich in wesentlichen Grundzügen bereits in den ersten
Nachkriegsschriften manifestiert. Durch den Vergleich von Manuskript- und
Druckfassungen und die Auswertung der Korrespondenzen mit den Lektoren kann
an ausgewählten Erzählungen demonstriert werden, daß die Nachlaßmaterialien
sehr aufschlußreich sind rur die Rekonstruktion von Textmetamorphosen. Unter
Auswertung aller verfiigbaren Quellen wird überdies Bölls Lektüre bis zum Ende
der runfziger Jahre nachgezeichnet und in ihren Auswirkungen auf das eigene
Schaffen erörtert. Weitere Beiträge eröffnen Einsichten in Arbeitstechnik, komposi
torisches Verfahren und erzählerische Strategien des Autors. Gegenstand exempla
rischer Analysen sind der erste veröffentlichte Roman Wo warst du, Adam? sowie
die programmatische Züge tragende Erzählung In guter Hut, die zu den kleineren
schriftstellerischen Arbeiten gehörte, mit denen der junge Autor im Frühjahr 1947
auf der literarischen Bühne zu debütieren versuchte.
Die ersten drei der nachfolgend abgedruckten Aufsätze basieren auf Vorträgen,
die am 16. Dezember 1992 im Rahmen eines von der Heinrich-Böll-Stiftung veran
stalteten Symposions gehalten wurden. Für die freundliche Genehmigung zur Ver
wendung von Zitaten aus unveröffentlichten Schriften und Briefen Bölls danken die
Verfasser/innen dieser Beiträge und der Herausgeber des vorliegenden Bandes noch
einmal der Erbengemeinschaft Heinrich Böll.
W.B.
Im Aufsatzteil dieses Bandes und innerhalb der Bibliographie werden rur die Aus
gaben der Werke, Interviews und Briefe Heinrich Bölls folgende Siglen verwendet:
RE I-IV Heinrich Böll: Romane und Erzählungen. 4 Bde. Hrsg. von Bemd Balzer. Köln:
Kiepenheuer & Witsch, 1987.
HTD Heinrich Böll: Werke. Hörspiele, Theaterstücke, Drehbücher, Gedichte 1.
1952-1978. Hrsg. von Bernd Balzer. Köln: Kiepenheuer & Witsch, <1978>.
G Heinrich Böll: Wir kommen weit her. Gedichte. Mit Collagen von Klaus Staeck.
Nachwort von Lew Kopelew. Göttingen: Steidl Verlag, 1986.
SR I-IX Heinrich Böll: In eigener und anderer Sache. Schriften und Reden 1952-1985.
9 Bde. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, <1988> (dtv 5962; Einzel
bände: dtv 10601-10609).
!NT Heinrich Böll: Werke. Interviews 1. 1961-1978. Hrsg. von Bemd Balzer. Köln:
Kiepenheuer & Witsch, <1978>.
BW Die Hoflhung ist wie ein wildes Tier. Der Briefwechsel zwischen Heinrich Böll
und Ernst-AdolfKunz 1945-1953. Hrsg. und mit einem Nachwort von Herbert
Hoven. Mit einem Vorwort von Johannes Rau. Köln: Kiepenheuer & Witsch,
1994.
Teil A: Studien zum Frühwerk
Das literarische Schaffen Heinrich Bölls in den ersten
Nachkriegsjahren
Ein Überblick auf der Grundlage des Nachlasses'"
Werner Bel/mann
Bei der Suche nach frühen Publikationen und der Datierung von Texten, bei der
Ermittlung von Schreibanlässen und Entstehungsumständen war die Böll-For
schung bislang weitgehend auf Mitteilungen angewiesen, die der Autor selbst in
Essays und Interviews gemacht hat. Erhebliche Irritationen verursachten etwa die
Aussagen Bölls, er habe, "noch keine drei Wochen zu Hause" und "noch krank von
der Gefangenschaft", sofort zu schreiben angefangen und zwischen 1945 und 1947
"etwa 60 Novellen in zehn verschiedenen Zeitungen veröffentlicht". 1 Diese Anga
ben waren bisher ebensowenig verifizierbar wie die Interviewäußerung aus dem
Jahr 1976, nach einem schon 1946 entstandenen Roman habe er bis 1950 drei oder
vier weitere geschrieben, die sämtlich unpubliziert blieben.2 Bei Auskünften insbe
sondere über die literarische Produktion der ersten Nachkriegsjahre wurde Böll
offenbar des öfteren von der eigenen Erinnerung getrogen, und so hat er selbst zu
Verunsicherungen und Spekulationen beigetragen. Geradezu exemplarisch dafiir ist
der 1973 entstandene autobiographische Essay Am Anfang. Folgt man den dort
gemachten Angaben, so wurde die 1949 im Verlag Middelhauve erschienene Er
zählung Der Zug war pünktlich schon "im Winter von 1946 auf 1947" geschrie
ben.3 Tatsächlich begonnen hat Böll die Niederschrift jedoch erst Mitte April 1948,
wie sich eindeutig aus den im Typoskript angebrachten Datierungen und auch aus
der Korrespondenz ergibt. Solche in die Irre weisenden, einer Überprüfung nicht
standhaltenden Mitteilungen finden sich keineswegs nur hinsichtlich der noch
weitgehend im dunkeln liegenden ersten Schaffensphase nach dem Krieg. Aus den
Hinweisen etwa zur Entstehung von Ansichten eines Clowns wurde in der For
schungsliteratur gefolgert, daß Böll diesen Roman "offenbar sehr schnell geschrie
ben" habe und daß er "unter dem Einfluß der Erfahrungen" entstanden sein müsse,
die der Autor "unmittelbar vorher in der Sowjetunion gemacht hatte". 4 Grundlage
• Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den ich am 16. Dezember 1992 im Rahmen eines Böll
Symposions in Wuppertal gehalten habe. Gegenüber dem Abdruck in der Zeitschrift 'Euphorion'
(88. Bd., 1994, Heft 2, S. 243-261) wurden einige Präzisierungen und Erweiterungen vorgenonunen.
Vg 1. "Ich habe nichts über den Krieg aufgeschrieben". Ein Gespräch mit Heinrich Böll und Hennann
Lenz, in: Literatunnagazin 7. Nachkriegsliteratur, hrsg. von Nicolas Born und Jürgen Manthey,
Reinbek bei Hamburg 1977, S. 30-74, ebd. S. 32. -"Weil dieses Volk so verachtet wurde, wollte ich
dazugehören ..... (1973), INT 245.
2 "Eine deutsche Erinnerung" (1976), INT 641.
3 SR V,48.
4 1. H. Reid: Heinrich Böll. Eine Zeuge seiner Zeit, München 1991, S. 177f.
12 Wemer Bellmann
für diese Feststellungen sind Informationen, die Böll 1976 im Gespräch mit Rene
Wintzen gegeben hat:
Ich erinnere mich, daß ich an einem Roman schrieb, als ich seinerzeit auf Bitten der
Bundesregierung und der so\\jetischen Regierung mit einer Delegation nach Moskau
fuhr [00'). Ich habe mich also diesem Druck gebeugt, und praktisch ist daran eine große
Erzählung gescheitert. Ich war die ganze Zeit über in der So\\jetunion sehr schlecht
gelaunt und auch gereizt, aber das Buch war weg. Verstehen Sie, es ist nicht wichtig, ich
habe dann ein anderes geschrieben, das hieß "Ansichten eines Clowns". 5
Tatsache ist indes, daß Böll die Arbeit am Clown anläßlich der Rußlandreise 1962
lediglich rur etwa vier Wochen (20.9.-19.10.) unterbrochen hat. Im Juni und Juli
war die erste Niederschrift entstanden, ab 18. September die zweite, die nach der
Reise abgeschlossen wurde. Die frühesten, schon im März und April angefertigten
Entwürfe zeigen überdies, daß nicht Eindrücke und Erfahrungen während des Auf
enthalts in der So\\jetunion inspirierende Wirkung ausgeübt haben, sondern solche
bei Besuchen im Ostsektor Berlins Anfang desselben Jahres. Nach dem ersten Kon
zept kommt Hans Schnier, als Agent im Dienst der DDR, aus Erfurt in die Bundes
republik zurück, getarnt als "Republikflüchtling" .
Die dargestellten Sachverhalte verdeutlichen exemplarisch, daß es der Böll
Forschung in vielfacher Hinsicht an soliden Grundlagen mangelt. Erst durch die in
den letzten Jahren begonnene Aufarbeitung des Manuskript- und Briefnachlasses
wird es Schritt rur Schritt möglich, zu gesicherten Erkenntnissen zu gelangen. Im
Mittelpunkt der Bemühungen standen bislang Sichtung und Auswertung der
Nachlaßmaterialien aus den ersten Nachkriegsjahren, also jener Schaffensphase,
deren wissenschaftliche Aufbereitung besonders starke Defizite aufweist. Der nach
folgende Überblick möchte als Versuch verstanden werden, zum Abbau dieser
Defizite beizutragen.
[00'] ich habe angefangen zu schreiben - das kann ich ziemlich genau sagen, weil ich
neulich mal alle meine ollen Klamotten durchgesehen habe - so mit 18, 19. Ich habe
Gedichte geschrieben, sehr schwermütige, gar nicht heiter, und dann Kurzgeschichten.
Ich habe auch einen Roman geschrieben, da war ich so 23, mit der Hand, schön unleser
lich. Der Impetus war immer da. Während des Krieges hat sich das verloren. [00']
Die satirische Entwicklung [00'] die war auch bei mir als junger Mensch sehr stark. Ich
habe schon mit 19 Jahren Pamphlete geschrieben, satirische Pamphlete, das ist immer
ein starker Zug gewesen.
Ich habe [00'] auszudrücken versucht, was mich an der erfahrenen, erlebten und nicht
ganz durchschauten Geschichte bewegt hat. Soziale Dinge, religiöse Dinge, politische
auch. Also, 1945 war nicht der Beginn des Prozesses. Ich war da immerhin 28, also
einigermaßen erwachsen. Ganz bewußt war es eine Fortsetzung filr mich.6
5 "Eine deutsche Erinnerung", INT 660. -Eindrücke der Reise in die Sowjetunion skizzierte Böll in
einem Entweder -oder überschriebenen Essay (s. die Bibliographie, Nr. 63.17).
6 Heinrich BölllHeinrich Vonnweg: Weil die Stadt so fremd geworden ist ... Gespräche, Bornheim-Mer
ten 1985, S. 80, 104 und 111. Den im Frühjahr/Sommer 1939 geschriebenen Roman - Titel: Am
Rande der Kirche -erwähnt Böll auch in den Gesprächen mit N. Born und 1. Manthey (wie Arun. 1),
Das literarische Schaffen in den ersten Nachkriegsjahren 13
Die wiedergegebenen Interviewäußerungen sollen zunächst noch einmal in Erinne
rung rufen, daß Böll sich bereits in der Vorkriegszeit schriftstellerisch betätigt hat.
Dieser Sachverhalt ist durch eine Reihe ähnlicher Aussagen seit vielen Jahren be
kannt, und wir wissen aus den Selbstäußerungen des Autors auch, daß die "ersten
Schreibversuche" nachhaltig durch die Lektüre insbesondere Dostojewskijs und
Leon Bloys beeinflußt wurden. Unbekannt war hingegen bis vor wenigen Jahren,
daß Böll vor dem Krieg auch schon Aktivitäten entwickelt hat, Ergebnisse seiner
literarischen Bemühungen zu publizieren. Das einzige Dokument, das bislang dar
über Auskunft gibt, ist ein am 29. Oktober 1979 an Fritz 1. Raddatz gerichteter,
1991 von diesem veröffentlichter Brief, in dem Böll ausfuhrt:
[ ... ] meine ersten schüchternen Publikationsversuche fallen in die Jahre 1936:37:38 -
damals schickte ich Gedichte an die "Junge Front", eine eindeutig oppositionelle katholi
sche Wochenzeitung -leider -oder vielleicht sogar Gott sei Dank -ohne Erfolg -denn es
hätte ja sein können, dass mich da einer entdeckt hätte! (Sie wissen wohl, daß Baumann
- der morsche Knochen-Baumann - aus der katholischen Jugendbewegung kam.) Dann:
hn Jahre 1938 schickte ich eine Kurzgeschichte zu einem Preisausschreiben an die
"Dame" -mich lockte das Preisgeld -es waren, glaube ich, 1000 Mark, also ein Vermö
gen -auch das ohne Erfolg: Ich fand die Kurzgeschichte jetzt, als ich endlich nach fast 40
Jahren meine "Papiere" durchsah, wenigstens flüchtig in mein Archiv hineinsah -stellen
Sie sich vor, ich hätte den Preis der "Dame" bekommen: 1938, 21 Jahre alt (die
Geschichte war gar nicht so schlecht!)? Wer weiss, was aus mir geworden wäre.7
Die Einberufung zur Wehrmacht am 4. September 1939 setzte den schriftstelleri
schen Ambitionen und "schüchternen Publikationsversuchen" zunächst einmal ein
Ende. Während des Krieges hat Böll zahllose Briefe geschrieben, sich aber nur
noch vereinzelt - vornehmlich in der Zeit bis Herbst 1941, also vor der (zweiten)
Abkommandierung nach Frankreich -an poetischen Texten versucht. 8
Nach der endgültigen Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft am 15. Septem
ber 1945 wurden Energie und Arbeitskraft Bölls, wie die aller Kriegsheimkehrer,
durch die Regelung elementarer Existenzprobleme absorbiert. Das erste Zeugnis,
das die Wiederaufnahme, die "Fortsetzung" der durch den Krieg unterbrochenen
schriftstellerischen Aktivitäten dokumentiert, stellt eine mit der Datumsangabe
"Mai 1946" versehene Nachlaßerzählung dar. Dabei handelt es sich um eine breit
angelegte, mit religiösen Reflexionen durchsetzte Schilderung einer Schlacht, die
als Typoskript ohne Titel überliefert ist und die seinerzeit nicht zur Veröffentli-
s. 32, und R. Wintzen ("Eine deutsche Erinnerung"), !NT 617. - VgJ. zum Vorkriegswerk ferner:
Protokoll zur Person. Autoren über sich und ihr Werk, hrsg. von Ekkehart Rudolph, München 1971,
S. 28f. -"Im Gespräch: mit Heinz Ludwig Amold" (1971), !NT 135-139. -"Dostojewskij -heute?"
(1971), !NT 182f. - Heinrich Vormweg: Böll vor 1945, in: Heinrich Böll, 1917-1985, zum 75.
Geburtstag, hrsg. von Bemd Balzer, Bem [u.a.) 1992 (Memoria), S. 15-23.
7
"Lieber Fritz". Briefe an Fritz J. Raddatz 1959-1990, Hamburg 1991, S. 126f. -Böll spielt an auf Es
zittern die morschen Knochen. das berüchtigte HJ-Lied von Hans Baumann.
8 Zutreffend ist Bölls Aussage im Gespräch mit Heinrich Vormweg, er habe "unendlich viel geschrieben
während des Krieges, aber meistens [!) Briefe" (Heinrich BölllHeinrich Vormweg: Weil die Stadt so
fremd geworden ist [wie Anm. 6). S. 106). -VgJ. demgegenüber "Drei Tage im März" (1975), !NT
371, sowie das Gespräch mit N. Born und 1. Manthey (wie Anm. I), S. 33.