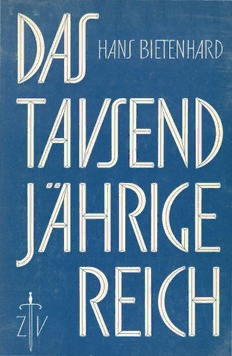Table Of ContentDas tausendjährige Reich
Eine biblisch-theologische Studie
von
Hans Bietenhard
Dr. theol., Privatdozent an der Universität Bern
Zwingli-Verlag Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Copyright 1955 by Zwingli-Verlag, Zürich
Printed in Switzerland
Buchdruckerei F. Graf-Lehmann, Bern
Vorwort
Die vorliegende Studie entstand in ihrer ursprünglichen Fassung in den
Jahren 1942/1943 und lag im Frühjahr des folgenden Jahres der theologischen
Fakultät der Universität Basel als Dissertation vor. Sie wurde für den Druck
überarbeitet und erschien in sehr kleiner Auflage im Buchhandel zu Beginn
des Jahres 1945.
Diese Daten zeigen, daß die Arbeit in einer Zeit entstand und erschien,
in der wieder einmal in der Geschichte die Idee des tausendjährigen Reiches
von höchster Aktualität war, wo sie aber auch in schlimmster Weise per
vertiert wurde. Um so dringender erschien eine biblisch-theologische Besin
nung auf diese Sache.
Nachdem die erste Bearbeitung dieser Schrift längst vergriffen ist, und von
vielen Seiten her der Wunsch nach einer erneuten Publikation an mich heran
trat, lasse ich sie wieder hinausgehen. Wieder wurde manches anders gefaßt,
manches korrigiert, einiges umgestellt. Vor allem habe ich mich bemüht, die
seither erschienene Literatur, soweit sie mir zugänglich war, zu berücksichtigen
und mich mit ihr auseinanderzusetzen.
Steffisburg, im Sommer 1955. Hans Bietenhard
Inhalt
Seite
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Exegese von Apk 19, 11-20, 10 im Zusammenhang mit dem Ganzen
der Apokalypse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
a) Kurze Inhaltsübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
b) Die Exegese im Einzelnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Die zukünftige Parusie Jesu Christi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. Der Ursprung der Weissagung vom tausendjährigen Reich . . . . . . 33
a) Alttestamentliches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
b) Spätjüdische Parallelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
c) Gog und Magog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
d) Die Herkunft der Zahl 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
e) Die Fesselung Satans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5. Die Frage der doppelten Auferstehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Anhang: Spätjüdische Parallelen zur Lehre von der doppelten Auf-
erstehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6. Die Herrschaft Jesu Christi und der Heiligen im tausendjährigen
Reich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
7. Die «geliebte Stadt». Israel und das tausendjährige Reich . . . . . . . 90
a) Hinweise auf die Geschichte der Exegese . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
b) Das Gericht über Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
c) Die fürlsrael bleibende Verheißung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
d) Abwehr des judaistisch-judenchristlichen Mißverständnisses . . 116
e) Israel als Weltmissionar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
8. Die Verheißung des Alten Test~entes und das tausendjährige
Reich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
9. Die Lehre vom tausendjährigen Reich in der Theologie der Gegen-
wart 144
10. Register ............................................. . 165
1. Einleitung
über das rechte Verständnis des 20. Kapitels der Offenbarung des Johannes
(im Folg. abgekürzt: Apk) wurde schon in der alten Kirche lebhaft debattiert.
Es scheint, daß bis weit ins zweite Jahrhundert hinein das endzeitlich-zukünf
tige Verständnis dieses Textes das durchaus vorherrschende gewesen ist. Doch
vertraten schon Justin und Irenaeus diese Lehre mit deutlicher polemischer
Spitze gegen allerhand Gegner. Vor allem drängte dann später das Aufkommen
der alexandrinischen Theologie das eschatologische Verständnis zurück. Diese
Entwicklung vollzog sich nicht ohne Schuld der Chiliasten 1 selbst. Diese
Erwartung wurde bald einmal als «Judaismus» gebrandmarkt, wußte man
doch, daß auch in der Synagoge die Erwartung auf ein messianisches Reich
am Ende der Tage lebendig war. Juden und Chiliasten konnten sich dabei oft
nicht genug tun im Ausmalen der herrlichen, paradiesischen Zustände jener
Endzeit. Sicher ist ferner, daß jüdische Zukunftsbilder die Chiliasten beein
flußten.
Warf man so den Juden und den Chiliasten «fleischliche Gesinnung» vor,
die eines durch den Geist erleuchteten Christen unwürdig sei, so verfiel man
nun sei~erseits in den entgegengesetzten Fehler, den «Geist> mit griechisch
platonischer Geistigkeit gleichzusetzen. So sind von Origenes über Dionys
von Alexandrien bis zu Hieronymus und Augustin die großen und tonan
gebenden Kirchenlehrer Gegner des Chiliasmus. Dabei läßt sich eine gewisse
Unsicherheit nicht verkennen: sie prägt sich etwa aus in den giftigen Be
merkungen und der unendlich verschrobenen Exegese des Hieronymus, der
den chiliastischen Kommentar des Victorin von Pettau zur Apk in usum
1 In terminologischer Hinsicht ist folgendes zu bemerken: Chiliasmus bedeutet einfach
«Lehre vom tausendjährigen 1,leich», und zwar ohne den depreziativen Nebensinn,
der dem Wort leider oft zum vornherein anhaftet. Ein Chiliast ist somit zunächst
einfach einer, der ein endzeitliches tausendjähriges Reich erwartet - also nicht zum
vornherein ein Judaist, Schwärmer, Wirrkopf, Sektierer oder Irrlehrer. Stehen die
beiden Worte in Anführungszeichen, dann ist damit auf das Depreziative hingewiesen,
das die Gegner mit diesen Worten verbanden oder verbinden. Die Ausdrücke tausend
jähriges Reich und Millennium sind abwechselnd und gleichbedeutend gebraucht.
7
Delphini reinigte; aber auch im Schwanken Augustins dieser Lehre gegen
über: hatte doch Augustin selbst noch in den «Sermones» 2 einen Welten
sabbat von tausend Jahren am Ende dieser Weltzeit erwartet, um dann in
«de civitate Dei» von dieser Lehre abzurücken. Dieser Wandel war bei ihm
vorbereitet durch die ihm auf die Nerven gehenden Phantastereien der Chilia
sten und wurde vollzogen, als der große Kommentar des Tyconius ihm zu
Gesichte kam. In dieser Erklärung von Apk 20 wurde das tausendjährige Reich
verstanden als die Zeit der Kirche. Kirche und tausendjähriges Reich sind eins.
Jesus hat durch seine Wirksamkeit auf Erden den Satan gefessel~, die «erste
Auferstehung» wird mit der Auferstehung der Gläubigen in der Taufe gleich
gesetzt. Augustin übernahm diese recht einfache und scheinbar alles erklä
rende Exegese und deckte sie für die folgenden Jahrhunderte mit seiner über
ragenden Autorität. Wer in der Folge etwas über Apk 20 sagen wollte, der
tat es in den Gedankengängen Augustins. Für die katholische Kirche ist es
im großen und ganzen bis auf den heutigen Tag bei diesem Verständnis
unseres Textes geblieben. Vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil diese «kirchen
geschichtliche» Deutung von Apk 20 dazu dienen könnte und kann, allerlei
Weltherrschaftsansprüche der Kirche biblisch zu legitimieren; denn es ist
nicht zu übersehen, daß in diesem Kapitel der Kirche die Weltherrschaft ver
heißen ist. Wir hätten dann in der bischöflich-hierarchisch organisierten
Kirche mit dem Papst an der Spitze nichts anderes zu erblicken als die Er
füllung der Weissagung Apk 20, 3 f.; Johannes hätte dann im Geiste die
Bischofs-Kathedren vorausgeschaut. Man sieht, daß diese im doppelten Sinne
«kirchengeschichtliche» Reminiszenz noch heute ihre Bedeutung nicht ver
loren hat.
Man kann nicht sagen, daß das Problem von Apk 20 in der alten Kirche
wirklich durchdiskutiert und damit geklärt worden ist. Die Lösung von
Tyconius und Augustin ist keine Lösung; sie ist bestenfalls eine exegetische
Möglichkeit neben andern mindestens gleichwertigen Möglichkeiten. Diese
andern Möglichkeiten wurden nämlich nicht etwa widerlegt, sondern von
den Exegeten einfach nicht mehr erwähnt, oder sie blieben ihnen überhaupt
unbekannt. Immerhin gab es durchs ganze Mittelalter3 hindurch Leute, die
2 Vgl. 259, 2: «Üctavus ergo iste dies in fine saeculi novam vitam significat, septimus
quietem futuram sanctorum in hac terra. Regnabit enim Dominus in terra cum
sanctis suis, sicut dicunt scripturae, et habebit hie ecclesiam, quo nullus malus intrabit,
separatam atque purgatam ab omni contagione nequitiae.»
3 Eine wissenschaftlich fundierte, zuverlässige und ausführliche Geschichte des Chilias
mus fehlt leider bis auf den heutigen Tag. H. Corrodi, Kritische Geschichte des
Chiliasmus, 4 Bde. (1781 ff.) hat ein aufklärerisches Pamphlet geschrieben, das mehr
8