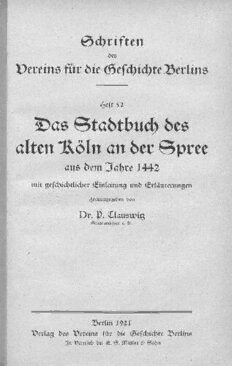Table Of ContentSchriften
des
Vereins für die Geschichte Berlins
Heft 52
Das Stadtbuch des
alten R. övy ln an der Spree
aus dem Tahre 1442
mit geschichtlicher Einleitung und Erläuterungen
„Zerausgegeben von
Dr. P. Clauswitz
Stadtarchivar a. D.
| Berlin 1921
Verlag des Vereins für die Geschichte Berlins
In Vertrieb bei EE. S. Mittler & Sohn
Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901
sowie das Übersezung3rec<ht sind vorbehalten.
Inhaltsverzeichnis.
Seite
Vorwort TIT
Geschichtliche Einleitung.
Die Stadt Köln vor der Abfassung des Stadtbuche8.
!. Entstehung, Name, Umfang, älteste Einrichtungen . :
"Vereinigung der beiden Städte 1432 . 48
Ende der Vereinigung, Streit mit dem Kurfürsten und die
Folgen. . . 2
Zustand der Stadt 38
Das eigentliche Stadtbuch 44
Die Nachträge 58
Erläuterungen zum eigentlichen Stadtbuche *%
Register *-
Dorwort.
Wos uns an Quellenmaterial zur Geschichte Berlins aus dem
Mittelalter erhalten geblieben ist, wurde bereits seit längerer
Zeit durch den Druck veröffentlicht und so der Forschung zugäng-
licher gemacht. AusSgenommen waren davon nur zwei Handschriften,
das älteste Berliner Bürgerbuch und das im städtischen Archiv ver-
wahrte alte Stadtbuch von Köln. Bruchstücke aus diesem Stadtbuche
konnten schon in Urkundensammlungen verwertet werden, aber an der
Wiedergabe des Ganzen im Zusammenhange fehlte es bis jetzt noch.
Die Handschrift besteht aus 25 Pergamentblättern, die lose
zwischen den ursprünglichen starken, mit dunkelrotem Papier über-
zogenen hölzernen Ginbandde>eln liegen, da die Verbindung der
Deckel gelöst ist. Ein Teil, das eigentliche Stadtbuch, in schöner
Schrift ausgeführt, vielfach mit roten Initialen geschmückt, umfaßt
nur 11 Blätter und ist in den Jahren 1442 und. 1443 nieder-
geschrieben. Daran schließen sich dann weitere 14, teils leer, teils
zu Eintragungen benußt, die mit dem vorhergehenden Inhalt nicht
im Zusammenhang stehen und aus späterer Zeit, bis in die Mitte
des 16. Jahrhunderts hinein, stammen. Darunter befinden sich auch
einige Abschriften von Urkunden, die älter sind als das eigentliche
Stadtbuch.
Die Sprache ist in dem lekteren niederdeutsch, in den Nach-
trägen aus dem 16, Jahrhundert mit .oberdeutschen Wortbildungen
durchsekt. Das Lateinische findet man hin und wieder in den Über-
schriften und an der Spike von Eintragungen. Auch Nikolaus
Molner leitet den Teil der Handschrift, der von ihm herrührt, latei-
nisc<) ein. In reinem Oberdeutsch ist die kurfürstliche Verordnung
von 1476 wegen der Reihenfolge bei den Prozessionen verfaßt, wie
ja dies die Sprache der kurfürstlichen Kanzlei war. Eine Über-
jezung ver Handschrift oder doch einzelner Teile beizufügen, wäre
vielleicht für manchen Leser erwünscht gewesen, aber die Absicht
wurde aufgegeben, um das Buch nicht umfangreicher zu machen und
IU verteuern.
„Die geschichtliche Einleitung ist nicht als eine Darstellung der
älteren Stadtgeschichte aufzufassen. Es handelt sich nur um die
: IN --
Entwicklung von Köln bis 1442, bis zur Abfassung des Stadtbuches,
um die Zusammenstellung dessen, was uns hierüber an Nachrichten
erhalten ist. Bei der engen Verbindung Kölns mit seiner Nachbar-
stadt konnten aber auch die Verhältnisse in Berlin nicht ganz außer
Betracht gelassen werden. Und da die Vereinigung der beiden
Städte im Jahre 1432 und die baldige Trennung durch den Kur-
fürsten 1442 viel dazu beitrug, daß man in Köln ein Stadtbuch
schreiben ließ, da auch die Abtretung des Plates für das Schloß
und dessen Erbauung für die weitere Entwieklung Kölns von großer
Wichtigkeit war, so ist dieser Begebenheit und dem Streit der Städte
mit der kurfürstlichen Regierung ein breiterer Raum gewidmet
worden.
Die mittelalterlichen Stadtbücher enthalten die Privilegien einer
Stadt, ihr Gewohnheitsrecht, die Befugnisse des Rats, seine Nutungs-
rechte und anderes. Köln war ein bedeutend kleineres Gemeinwesen
als Berlin, weit ärmer an Gerechtsamen und an Besik. Der In-
halt feines Stadtbuches kann demnach nur ein bescheidener sein und
muß hinter dem des berlinischen sehr zurückstehen. Dennoch ist die
Kenntnis notwendig für die Ergänzung der Stadtgeschichte, und der
Verein für die Geschichte Berlins erwirbt sich ein Verdienst durch
die Veröffentlichung der Handschrift, von der biSher nur einzelne
Stücke bekannt geworden sind. Zugleich ist dadurch erreicht, daß
nun die mittelalterlichen Quellen bis auf einige Blätter der oben
erwähnten Bürgerverzeichnisse lückenlos gedruckt vorliegen.
Die Erläuterungen zu dem eigentlichen Stadtbuche sind nicht
in den Text eingefügt, sondern am Schlusse nachgetragen, um die
Handschrift im Zusammenhange wiederzugeben.
Das vom Verein heraus8gegebene Urkundenbuch zur Stadt-
geschichte zitieren wir unter der Bezeichnung B. U. B., obwohl es
eigentlich den Titel führt „Urkundenbuch zur Berliner Chronik“.
Riedel3 Codex diplomaticus Brandenburgensis ist hin und wieder
mit R. abgekürzt.
Den Stadtteil Köln schreibt man seit Anfang der achtziger
Jahre -des vorigen Jahrhunderts „Kölln“. Da es sich in diesem
Buche um das alte Köln, das mittelalterliche Colonia handelt, j9
ist die frühere Schreibweise beibehalten.
P. Clauswiß.
Geschichtliche Einleitung.
Die Stadt Köln vor der Abfassung des Stadtbuches.
1. Entstehung, Name, Umfang, älteste Einrichtungen.
Über die Entstehung der Stadt Köln sind wir ebenso mangel-
haft unterichtet wie über die von Berlin. Folgende Nachrichten aus
den Quellen kommen hierbei zunächst in Betracht. Die etwa 1280
verfaßte Chronica prineipum Saxoniae erzählt"), daß die jungen
Markgrafen Johannes 1. und Otto 111. zuerst unter Vormundschaft
regiert hätten und fährt dann fort: Postquam antem adolevisgent
„=“. terras et reditus ampliayerunt, fama, gloria et potentia exere-
verunt. A domino Barnem terras Barnonem et Teltowe et alias
plures obtiunerunt, Ukaram terram usque in Walsene*) fluvium
emerunt. In Hartone*) castra et advocacias comparaverunt. Berlin,
Struzeberch, Vrankenvorde, Novum Angermunde, Stolp, Liven-
walde et Stargarde*), Novum Brandenburch et alia loca plurima
exstruxerunt et gie degerta ad agros reducentes bonis omnibus
habundaverunt.
- Danach hätte also die Gründung Berlins nicht vox der Mün-
digkeit der beiden Markgrafen stattgefunden, die etwa von 1226 an
zu rechnen ists). Die nächste Erwähnung geschieht im Jahre 1244
durch die Anführung eines Propstes von Berlin als Zeugen bei
einer Beurkundung. Zwischen diese beiden Jahre muß man also
die Entstehung des Ortes legen, von allen näheren Bestimmungen
aber absehen. Weil Spandau 1232 die Zusicherung erhielt, daß
alle Städte im Teltow und Barnim ihr Recht von dort zu holen
hätten, so nahm man an, daß von da ab erst mit der Anlage von
Städten in diesen Landen begonnen werden sollte und auch Berlin
1) Monum. Germ. histor. Sceriptorum Tom. XXV. S. 478. -- Märkische
Forschungen IX S. 24. --. ?) Welfe. -- 3) Harz. -- 9) Dorf an der Oder unweit
Angermünde. -- 2) in Mecklenburg-Strelit. =- *) Pauli, Preußische Staatsgeschichte
1 S. 290. F. Voigt in den Märkischen Forschungen IR S. 116.
Schriften des Vereins f. d. Geschichte Berlins. Heft 52.
Sn
dann erst entstanden ist. Indessen konnte es, wenn auch noch nicht
als Stadt, immerhin schon vorhanden gewesen sein. Die Chronica
prineipum bezeichnet die Gründungen nur als castra, advocacias
und loca, nicht als oppida oder civitates. Die Aufzählung der von
den Markgrafen gegründeten Orte geht von Westen nach Osten und
Nordosten, ob zugleich auch“ <ronologisch, ist nicht wahrscheinlich.
Frankfurt wurde 1253 angelegt, Stargard 1259, Neu-Brandenburg
1248. Von den anderen Ortschaften sind die Gründungsjahre nicht
bekannt.
Man hat versucht, die Entstehung mit der ältesten Spandauer
Urkunde vom Jahre 1232 in Beziehung zu seen. Dort heißt es
von den beiden Markgrafen: Insuper civitati nostra Spandowe in-
dulgemus, ut omnes de Terra Teltowe et omnes de Ghelin ne6 non
omnes de nova terra nostra Barnem jura sua ibidem accipiant
et observent Sicut nostram graciam diligunt et favorem, ipsa
antem civitas nostra Spandowe jura sua in Brandenburg afferat
universa. Danach, meint man, wären im Teltow und Barnim die
Städte erst nach 1232 gegründet. Aber dann müßten sie auch
Spandauer Recht gehabt haben, was nachweislich nirgend8, auch
bei Berlin nicht, der Fall ist. Übrigens drückt der lateinische Text
der Urfunde feine bestimmte Vorschrift aus, es wird den Beteiligten
nur die Befolgung anheimgestellt sicut nostram graciam diligunt
et favorem. Die Urkunde ist also für die Zeitbestimmung, um die
es sich hier handelt, unwesentlich.
Die Chronik der sächsischen Fürsten unterließ es, Köln neben
Berlin bei der Aufzählung der neugegründeten Städte zu nennen,
obwohl es doch 1261 schon als Stadt vorhanden war, wie der EGr-
werb der kölnischen Heide unzweifelhaft feststellt. Man kann viel-
leicht annehmen, daß es dem Chronisten nicht wichtig genug neben
Berlin erschien, um namhaft gemacht zu werden. Und doch finden
wir den Ort schon im Jahre 1237 erwähnt, also früher als Berlin.
In der für unsere Landes8geschichte so wichtigen Urkunde dieses Jahres,
die im Auftrage - des Papstes Bestimmungen über das Recht am
Zehnten in der Brandenburger Diözese, ferner über Rechte und
Pflichten der Markgrafen gegen die bischöfliche Kirche in den neuen
Landen östlich der Havel und an der Spree trifft, wird als einziger
geistlicher Zeuge aus diesem neuen Gebiet neben Würdenträgern der
Kapitel oder Stifte in Halberstadt, Magdeburg, Stendal 8Symeon
plebanus de Wolonia aufgeführt. Die Urkunde ist datiert aus
Brandenburg.
Derselbe Symeon erscheint dann wieder 1244 als Zeuge beim
Verzicht der Märkgrafen auf den, Nachlaß geistlicher Personen, ex
wird hier aber praepositus de Berlin genannt. Mitzeugen sind
der Bischof von Brandenburg und zwei andere Geistliche. Der Ort
der Urfunde ist Markee bei Nauen. Ferner kommt ex vor ebenfalls
als. Zeuge in Gemeinschaft des Bischofs und kirchlicher Würdenträger
1245 in Liebenwalde, als das Kapitel von Gramzow die Mark-
grafen zu Schirmherren wählt, dann 1247 bei einer Landschenkung
in der Uckermark, die der Bischof dem Kloster Walkenried macht. In
dem ersten Fall heißt er praepositus de Berlin, im zweiten prae-
Positus de Colonia juxta Berlin. Aus demselben Jahre findet sich
aber auch eine Urkunde, eine Schenkung an Kloster Lehnin, wo er
wieder als praepositus de Berlin bezeichnet wird. Bei diesen beiden
Urkunden fehlt der Ort der Unterzeichnung, aber dem Inhalte nach
wird es wohl kaum in Berlin oder Köln gewesen sein. Wir sehen
ihn also unter wechselndem Titel an verschiedenen Orten auftreten,
aber immer als Zeuge bei wichtigen kirchlichen Verhandlungen und
meist im Gefolge des Bischofs von Brandenburg.
-Um die Stellung dieses Geistlichen zu den beiden Kirchen in
Berlin und in Köln besser beurteilen zu können, sehen wir uns nach
seinen Nachfolgern um. 1265 finden wir urkundlich einen prepositus
Theodorieus in Berlin als Zeugen in Spandau neben Domherren
des brandenburgischen Kapitels, zugleich einen plebanus Gernotus de
Berlin. 1273 denjelben Theodoricus in Brandenburg beim dortigen
Kapitel mit der Bezeichnung prepositus in Colonia und daneben
jeinen (ejusdem) viceprepositus Ludoyieus. Der nämliche Bizepropst
tritt auf 1275, aber als vicepraepositus zu Berlin, in Gottow im
Erzstift Magdeburg, in demselben Jahre und nochmals 1277 in
Magdeburg selbst, immer als Zeuge bei wichtigen geistlichen Ange-
legenheiten des brandenburgischen Kapitels. 1285 bei einer mark-
gräflichen Schenkung für die Kirche in Köln ist gegenwärtig der
Plebanus der Kirche, Joannes, prepogitus in Berlin.
Aus allen diesen Ausführungen ist ersichtlich: erstens der leitende
Geistliche der berlinischen und der kölnischen Pfarrkirchen ist stets
dieselbe Person, mag er fich de Berlin oder de Colonia nennen;
zweitens, er war nicht an die AusSübung seines Pfarramts gebunden,
da -man ihm so oft fern von Berlin begegnet, und zwar meist den
brandenburgischen Kapitelherren angereiht. Daraus ist zu schließen,
daß er über die Einkünfte beider Pfarrstellen verfügte und vermutlich
dem brandenburgischen Kapitel angehörte. In einer Urkunde von
BEET SD:
1319 seßen denn auch der Bischof von Brandenburg und Markgraf
Woldemar als Patron dies Verhältnis der Pfründen endgültig fest,
indem sie die beiden Kirchen zugleich mit der Propstei wirklich zu
einem beneßeium vereinigen und die fkölnische Pfarre und die
Stadt Köln alle Male der berlinischen Propstei unterstellen. Damit
waren dem Propste die Möglichkeit und die Mittel für einen weiteren
Wirkungskreis geboten. Indessen bei den politischen Wirren, die
gleich nach -Woldemars Tode eintraten und durch Bann, und Inter-
dift für die Schwesterstädte noch fühlbarer wurden, erfahren wir
zunächst lange Zeit nichts über die Berliner Pröpste. Daß aber die
Einheit des Pfarrers für beide Kirchen fortbestand, lehrt eine Ur-
funde aus dem Jahre 1355, nach der das Haus der berlinischen
Propstei an einen markgräflichen Vasallen vermietet, der Pfarrer
also auf die kölnische angewiesen war. Im Landbuche Karls IV.
hat der Markgraf das jus patronatus von Berlin und Köln, aber
es besteht nur ein beneficeium, die prepositura Berlyn. 1436 be-
schweren sich beide Städte, daß der Propst die Kirchen nicht ge-
nügend mit Kapellanen versorgt.
Wenn also der Propst in den Urkunden am frühesten mit Köln
in Verbindung gebracht wird, so berechtigt dies no< nicht zu dem
Schlusse, daß die Kirche die ältere sei. =- Die Nachrichten über die
Geistlichen beider Kirchen sind älter, als die “über die Kirchen selbst.
Die ecclesia 8. Nicolai confessoris wird zuerst 1264 genannt ge-
legentlich eines gewährten Ablasses, die ecclesia parochialis in Volne
1285 gelegentlich einer Schenkung, und mit dem Namen ecclesia
St. Petri in Colonia 1327. Beide Kirchen verdanken ihre Gründung
den Brämonstratensern, das heißt dem Domkapitel in Brandenburg,
wie auch die Einsezung von Pröpsten anstatt der Dekane als kir<-
liche Aufsichtosbeamte für eine Anzahl von Pfarreien eine Einrichtung
der Prämonstratenser war. Den Heiligen, auf dessen Namen eine
Kirche geweiht werden sollte, den patronus titularis, bestimmte der
zuständige Bischof, also hier der von Brandenburg. Oft wählte er
den Schußheiligen der bischöflichen Kirche. Die patroni des Branden-
burger Kapitels waren die Apostelfürsten Petrus und Paulus, Petrus
der besondere Heilige der Domkirche. Hieraus würde die Benennung
der kölnischen. Pfarrkirche als ecclesia St. Petri zu erklären sein. Für
den Namen der berlinischen Pfarrkirche ecclesia 8. Nicolai con-
fessoris (1264) fehlt es an einem Hinweise. Dem heiligen Nicolaus
von Myre, der auch der Nationalheilige für Rußland wurde, sind
im nordöstlichen Deutschland viele Kirchen gewidmet. Man hat die