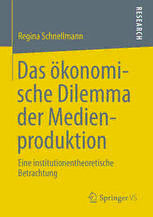Table Of ContentDas ökonomische Dilemma
der Medienproduktion
Regina Schnellmann
Das ökonomische
Dilemma der
Medienproduktion
Eine institutionentheoretische
Betrachtung
Mit einem Geleitwort von
Prof. Dr. Christian Steininger
Regina Schnellmann
Paris Lodron Universität Salzburg
Salzburg, Österreich
Dissertation Paris Lodron-Universität Salzburg 2011
ISBN 978-3-658-00591-7 ISBN 978-3-658-00592-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-00592-4
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio-
n a lbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufb ar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung,
die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Über-
setzungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die-
sem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass
solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürft en.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe
Springer Science+Business Media.
www.springer-vs.de
Geleitwort
In medienökonomischen Lehrbüchern findet sich mitunter der Verweis auf die
Kostenkrankheit der Kulturproduktion. Sehr viel weiter als bis zu dem Befund,
dass diese Kostenkrankheit auch für Medien (auf Grund ihres Dienstleistungs-
charakters) gilt, reicht die Befassung zum Thema aus medienökonomischer Per-
spektive nur selten. Dies verwundert, gibt es doch für die Kommunikationswis-
senschaft gute Gründe, sich mit diesem Thema zu befassen: Die spezifischen
Bedingungen der Medienproduktion vertieft aufzuarbeiten, ist für die Kommuni-
kationswissenschaft insbesondere vor dem Hintergrund ihrer verschütteten nati-
onalökonomischen Wurzeln unerlässlich. Die vorliegende Publikation verdeut-
licht, dass sich die Ökonomie zu einer analytischen Wissenschaft entwickelt hat,
die sich (a) zu wenig mit Kultur beschäftigt und (b) die historische Schule der
deutschen Nationalökonomie vernachlässigt. Die Befassung mit der Kosten-
krankheit stellt aber auch die Kommunikationswissenschaft als Sozialwissen-
schaft mit interdisziplinären Bezügen im Rahmen der Zusammenführung der
Theorien und Befunde unterschiedlicher Disziplinen auf die Probe.
Schnellmann befasst sich in der hier vorliegenden Dissertation auf einer
bemerkenswert breiten Literaturbasis mit dem von Baumol und Bowen 1966
beschriebenen ‚Ökonomischen Dilemma der Kulturproduktion‘ und diskutiert
dieses vor dem Hintergrund aktueller institutionen- und kulturökonomischer
Ansätze. Da sich heterodoxe ökonomische Ansätze mittlerweile immer stärker in
Richtung soziologischer Positionen zu den Themenkreisen Markt, Wettbewerb
und Unternehmen bewegen, findet auch der soziologische Institutionalismus
Berücksichtigung, um sich dem ökonomischen Dilemma der Medienproduktion
angemessen nähern zu können.
Medienleistungen werden hier in Abhängigkeit von der Medieninstitutiona-
lisierung beschrieben. Fragen nach dem ökonomischen Dilemma der Medien-
produktion, nach den Auswirkungen gesteigerter Produktivität für den Medien-
unternehmer sowie für normative publizistische Werte und Ziele, nach den Steu-
erungsmechanismen im Mediensektor, nach öffentlichen Subventionen für die
Medienproduktion werden formuliert und im Rahmen der Verbindung ausge-
6 Geleitwort
wählter Thesen zu Kunst und Kultur von Bourdieu mit Theorieansätzen der Kul-
tur- und Medienökonomie einer Beantwortung zugeführt.
Schnellmann begreift Kultur, Kunst und Medien als Institutionen und be-
schreibt medialen Wandel daraus resultierend als institutionellen Wandel. Die
Institution wird dabei als Grundlage von Erwartungen, als relativ stabiles Regel-
system, welches aus dem Verhalten von Individuen resultiert und folglich soziale
Beziehungen, Verhaltensmuster und Formen sozialer Handlungen umfasst, ge-
fasst. Auch unterscheidet die Autorin zwischen Institutionen und Organisationen
und macht deutlich, welche Arten von Medienorganisation und damit einherge-
henden Organisationszielen unterschieden werden können. Vor dieser Folie
werden Befunde zur Einkommenssituation von Medienschaffenden gesammelt
und die Ursachen für das ökonomische Dilemma der Medienproduktion erläu-
tert.
Die Arbeit verdeutlicht letztlich, dass mangelnde Produktivitätssteigerung
an sich noch keine Rechtfertigung für öffentliche Subventionen darstellt und
dass für die Analyse von Medienpolitik die Betrachtung sich wandelnder und
neuer Akteurskonstellationen notwendig ist. Sich verändernde institutionelle
Regelstrukturen, die durch neue Akteure und neue Aushandlungsprozesse ent-
stehen, müssen berücksichtigt werden. Institutionelle Ordnungen sind folgen-
reich für die Interessensdurchsetzungsmöglichkeiten gesellschaftlicher Gruppen.
Für die Medienpolitik dürfen deshalb individuelle Kosten-Nutzen-Kalküle
allein nicht Ausschlag gebend sein. Damit über die Rangordnung medialer Ziele
gesellschaftlich-politisch entschieden werden kann, bedarf es solcher Arbeiten
wie der vorliegenden. Damit der unhinterfragte Einbau von ökonomischen Be-
grifflichkeiten und Theorien in den Theoriebau der Kommunikationswissen-
schaft vermieden werden kann, bedarf es dieser ebenso.
Gastprofessor Dr. Christian Steininger
Inhaltsverzeichnis
1(cid:1) Einleitung ................................................................................................... 9(cid:1)
2(cid:1) Makroebene .............................................................................................. 29(cid:1)
2.1(cid:1) Markt als Institution .............................................................................. 29(cid:1)
2.1.1(cid:1) Eingeschränkt rationales Verhalten .............................................. 34(cid:1)
2.1.2(cid:1) Transaktionskosten ....................................................................... 35(cid:1)
2.2(cid:1) Kultur und Markt und Ökonomisierung der Medien ............................ 39(cid:1)
2.3(cid:1) Kultur- und Medienpolitik .................................................................... 43(cid:1)
2.4(cid:1) Regulierung ........................................................................................... 48(cid:1)
2.5(cid:1) Subventionen ......................................................................................... 53(cid:1)
2.5.1(cid:1) Argumente für Subventionen im Medien- und Kulturbereich ...... 56(cid:1)
2.5.2(cid:1) Argumente gegen Subventionen im Medien- und Kulturbereich . 61(cid:1)
2.6(cid:1) Zahlen zu Medien und Kultur ............................................................... 62(cid:1)
2.6.1(cid:1) Österreich ...................................................................................... 62(cid:1)
2.6.2(cid:1) Deutschland .................................................................................. 66(cid:1)
2.6.3(cid:1) International .................................................................................. 67(cid:1)
3(cid:1) Mesoebene ................................................................................................ 73(cid:1)
3.1(cid:1) Zum Begriff der Institution ................................................................... 74(cid:1)
3.1.1(cid:1) Arten von Institutionen ................................................................. 79(cid:1)
3.1.2(cid:1) Kultur als Institution ..................................................................... 83(cid:1)
3.1.2.1(cid:1) Kultur im weiteren Sinn ................................................................. 85(cid:1)
3.1.2.2(cid:1) Kultur im engeren Sinn .................................................................. 89(cid:1)
3.1.3(cid:1) Kunst als Institution ...................................................................... 94(cid:1)
3.1.4(cid:1) Medien als Institutionen ............................................................. 102(cid:1)
3.2(cid:1) Institutionenwandel ............................................................................. 108(cid:1)
3.3(cid:1) Unterschiede zwischen Institution und Organisation .......................... 114(cid:1)
3.4(cid:1) Arten von Medienorganisationen ........................................................ 116(cid:1)
3.4.1(cid:1) Kommerzielle Medienunternehmen ........................................... 120(cid:1)
3.4.2(cid:1) Öffentlich-rechtliche Medienunternehmen ................................. 121(cid:1)
3.4.3(cid:1) Organisationsziele ...................................................................... 127(cid:1)
8 Inhaltsverzeichnis
3.5 Das ökonomische Dilemma ................................................................ 136
3.5.1 Einkommenssituation von Kultur- und Medienschaffenden ...... 153
3.5.2 Ursachen des ökonomischen Dilemmas der Medienproduktion 159
3.5.2.1 Differenzierung von Produktion und Distribution im
Mediensektor ................................................................................ 159
3.5.2.2 Gutspezifik ................................................................................... 162
3.5.2.3 Kostenstruktur .............................................................................. 165
3.5.2.4 Vermarktungsprobleme und Refinanzierungs-
schwierigkeiten ............................................................................ 168
3.5.3 Lösungen des ökonomischen Dilemmas .................................... 169
3.5.3.1 Organisation der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung ...... 170
3.5.3.2 Inhalts- und herstellungsbezogene Produktionsstrategien ..... 170
3.5.3.3 Größenvorteile (Economies of scale) ....................................... 177
3.5.3.4 Internationalisierung der Distribution und Produktion /
Synergieeffekte / Verbundvorteile ............................................ 178
3.5.3.5 Mehrfachverwertung der produzierten Inhalte ........................ 179
3.5.3.6 Heterogenisierungsstrategien ..................................................... 180
3.5.3.7 Diversifikation ............................................................................. 181
3.5.3.8 Vertikale Integration ................................................................... 182
3.5.3.9 Selektive Anreize ......................................................................... 182
3.5.3.10 Editoriale Produktion .................................................................. 183
3.5.3.11 Flowproduction ............................................................................ 184
3.5.3.12 Verbesserte Produktions- und Distributionstechnologien
(Digitalisierung) ........................................................................... 185
3.5.3.13 Erschließung zusätzlicher Erlösquellen ................................... 187
4 Mikroebene ............................................................................................ 191
4.1 Kultur-, Medienschaffende ................................................................. 191
4.2 Das Phänomen des Stars ..................................................................... 195
4.3 Rezipient ........................................................................................... 199
4.4 Geschmack und Präferenzen ............................................................... 209
5 Fazit ........................................................................................................ 217
6 Literatur ................................................................................................. 241
1 Einleitung
Die vorliegende Abhandlung des ökonomischen Dilemmas medialer Produktion1
orientiert sich an kommunikationswissenschaftlichen und ökonomischen sowie
soziologischen Theoriekonzepten. McQuails Anforderungen an eine Kommuni-
kationstheorie und die ökonomischen Analyseobjekte nach Acocella lassen sich
nach Kiefer gut kombinieren:2 Kommunikationstheorien müssen nach McQuail
„eine Basis für die normative und kritische Bewertung der Entwicklungen“ be-
reitstellen, „Methoden und Konzepte für deren Beschreibung und Abklärung“
bieten und „Wirkungszusammenhänge erklären können und Voraussagen dazu
machen“.3 Die drei Analyseebenen der Ökonomie im Hinblick auf gesellschaftli-
che Entscheidungen und Wahlhandlungen sind die Ebene gesellschaftlicher,
institutioneller und laufender individueller Wahlhandlungen.4 „Es sind also die
Makro-, Meso- und Mikroebene von Wahl- und Entscheidungshandeln, die hier
theoretisch unterschieden, aber durch die Anwendung des ökonomischen Verhal-
tens- oder Rationalmodells auf allen Ebenen gleichzeitig analytisch wieder ver-
bunden werden.“5 Auf diese drei Ebenen – mit Schwerpunkt auf die Mesoebene
(in Anlehnung an McQuail die Erklärung von Wirkungszusammenhängen und
die Ableitung von Voraussagen) – nimmt die Dissertation Bezug. Der Mesoebe-
ne gilt auch das besondere Interesse der Institutionenökonomik, die als zentrale
Theorie im Mittelpunkt der Arbeit steht. Kiefer konstatiert eine Unklarheit in der
Mehrstufigkeit kommunikationswissenschaftlicher Theoriekonzepte und der
theoretischen Verknüpfung verschiedener Analyseebenen. Das Defizit sieht sie
im Meso- und Makrobereich, wo durch „die Adaption entsprechender Theorie-
ansätze [ein] zumindest prima facie […] sinnvolle[r] und notwendige[r] Beitrag“
geleistet werden kann.6 Hier will die vorliegende Arbeit ansetzen.
1 Die Dissertation wurde im Jänner 2011 am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Paris
Lodron Universität Salzburg eingereicht und im Februar 2011 von Dr. Christian Steininger als
Erstgutachter und Prof. Dr. Roman Hummel als Zweitgutachter angenommen.
2 Vgl. Kiefer 2005, S. 397
3 McQuail 1986, S. 633 zit. nach Kiefer 2005, S. 397
4 Vgl. Acocella 1998 zit. nach Kiefer 2005, S. 397
5 Kiefer 2005, S. 397f.
6 Vgl. Kiefer 2005, 398, 407; vgl. auch Jarren 2003, S. 13
R. Schnellmann, Das ökonomische Dilemma der Medienproduktion,
DOI 10.1007/978-3-658-00592-4_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
10 1 Einleitung
„Gerade die Unterschiede in den theoretischen Konzepten und der immer wieder in der PKW
[Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Anm. d. Verf.] beklagte Mangel an Meso- und
Makrotheorien verweisen auf Potentiale sinnvoller Ergänzungen der PKW durch eine Teildis-
ziplin Medienökonomik [wozu die Anwendung der Institutionenökonomik für diese Arbeit hier
gerechnet wird; Anm. d. Verf.], die sich nicht nur auf die genauere Analyse der wirtschaftli-
chen Bedingtheiten von Medien beschränkt, sondern auch theoretischen Zugewinn bringt. Die-
ser Zugewinn wird auf den einzelnen Ebenen ökonomischer Analyse unterschiedlich groß sein,
im Bereich der normativen Theorie eher gering, als positive Theorie auf den Ebenen institutio-
neller und laufender individueller Wahlhandlungen hingegen eher hoch.“7
Kiefer fordert eine Analyse der Funktionsweise von Medien als Institutionen und
Organisationen sowie publizistischer und ökonomischer Zielkonflikte, Normen
und Leitwerte.8 Jarren konstatiert wie Kiefer eine starke Vernachlässigung der
Analyse der Mesoebene und somit ein „Schattendasein“ von Medien als Organi-
sationen sowohl als theoretischer als auch empirischer Forschungsgegenstand
innerhalb der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft.9
Werden Regulierung der Medien und das Medienangebot als problematisch
bewertet, ist vor der Entwicklung von Lösungsmodellen eine Ursachenanalyse
notwendig.10 Als solche Ursachenanalyse ist diese Dissertation einzuordnen.
Medienleistungen und Programmqualitäten sind von der Medieninstitutionalisie-
rung, ihrer rechtlichen Verfasstheit und ökonomischen Ausrichtung abhängig.11
„Qualitätsdefizite im Rundfunk […] sind […] keine Zufälle, sie sind nicht allein
auf individuelle Fehlleistungen einzelner Kommunikatoren, sondern zumeist auf
das Vorhandensein spezifischer Organisationen und der in ihnen vorherrschen-
den dominanten Handlungsformen zurückzuführen.“12 Angelehnt an die Institu-
tionenökonomik, sind die Hauptursachen für Koordinationsprobleme bei der
Zielerreichung im Mediensektor in den institutionellen Rahmenbedingungen zu
suchen. Im Mediensektor sind nach Kiefer „eine Reihe von Störfaktoren auszu-
machen, die eine soziale Kooperation der beteiligten Akteure im Sinne der Ziel-
erreichung von Medien ver- oder zumindest behindern, die dies selbst dann täten,
wenn alle Akteure diese Zielerreichung wünschen und anstreben würden.“13
Gründe dafür sind auf Seiten der Medienproduzenten Dilemmata hinsichtlich der
Normensysteme und institutionellen Regelungen, auf Seiten der Medienkonsu-
menten ihre Rolle, die nicht jener des Marktmodells entspricht.14
7 Kiefer 2005, S. 398
8 Vgl. Kiefer 2005, S. 399f.
9 Vgl. Jarren 2003, S. 13
10 Vgl. Kiefer 2005, S. 404ff.
11 Vgl. Jarren 2003, S. 13
12 Jarren 2003, S. 14
13 Kiefer 2005, S. 404
14 Vgl. Kiefer 2005, S. 404
1 Einleitung 11
Die untersuchungsleitende Frage der vorliegenden Abhandlung ist, wie sich
die Ursachen des ökonomischen Dilemmas der Medienproduktion und soweit
möglich Lösungen institutionentheoretisch darstellen.
In der Dissertation wird versucht, detaillierter folgende Fragestellungen zu
beantworten, die sowohl im Bereich der Metaebene liegen als auch natürliche
Phänomene des ökonomischen Dilemmas der Medienproduktion betreffen:
(cid:1) Ist das ökonomische Dilemma der Medienproduktion unausweichlich?
(cid:1) Welche Auswirkungen hat eine gesteigerte Produktivität im Mediensektor
für Medienunternehmer und Publikum?
(cid:1) Ist die Verbindung ausgewählter Thesen zu Kunst und Kultur von Bourdieu
mit Theorieansätzen der Kultur- und Medienökonomie möglich bzw. sinn-
voll?
(cid:1) Welche Steuerungsmechanismen und -systeme sind für bestimmte wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und politische Ereignisse bzw. Ergebnisse im
Mediensektor ursächlich?
(cid:1) Warum erbringen Medien unterschiedlicher Organisationsformen unter-
schiedliche Leistungen?
(cid:1) Können mit den hier diskutierten Medienorganisationsmodellen (privat vs.
öffentlich-rechtlich) normative publizistische Werte und Ziele erfüllt wer-
den?
(cid:1) Welche Bedeutung haben öffentliche Subventionen für die Medienproduk-
tion?
Notwendig zur Beantwortung dieser Fragestellungen ist u.a. eine vergleichende
Analyse von Medienorganisationsmodellen und unterschiedlichen institutionel-
len Arrangements zur Bereitstellung von Medieninhalten sowie eine Hierarchi-
sierung und Gewichtung der vorgegebenen Leistungsziele von Medien. Ist in der
vorliegenden Arbeit von „Medien“ die Rede, fallen darunter überwiegend die
„traditionellen“ elektronischen Medien (Rundfunk).
Priddat beklagt, dass die Ökonomie eine analytische Wissenschaftskultur
geworden ist, die sich zu wenig mit Kultur beschäftigt und die großen Themen
der historischen Schule der deutschen Nationalökonomie vernachlässigt. Unter-
sucht werden in einer Kulturökonomie zwar Kunstmärkte, dennoch ist das Ver-
hältnis von Ökonomie und Kultur (zu der die Medien in dieser Arbeit zählen) in
der Ökonomie unterbestimmt.15 In Bezug auf eine Verbindung von Kultur und
Ökonomie steht die kulturwissenschaftliche Sichtweise der wirtschaftswissen-
schaftlichen Betrachtung gegenüber. Die einen halten eine wirtschaftswissen-
15 Vgl. Priddat 2003, S. 195