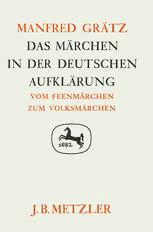Table Of Content1682
GERMANISTISCHE ABHANDLUNGEN
DAS MÄRCHEN IN DER DEUTSCHEN AUFKLÄRUNG
MANFRED GRÄTZ
Das Märchen
in der deutschen Aufklärung
Vom Feenmärchen zum Volksmärchen
J. B. METZLERSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
STUTTGART
GERMANISTISCHE ABHANDLUNGEN BAND 63
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Grätz, Manfred:
Das Märchen in der deutschen Aufklärung vomFeenmärchen zum Volksmärchen / Manfred
Grätz.-Stuttgart :Metzler, 1988
(Germanistische Abhandlungen ; Bd. 63)
ISBN 978-3-476-00618-9
ISBN 978-3-476-03244-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-476-03244-7
NE:GT
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzu
lässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfil-
mungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 1988 Springer-Verlag GmbH Deutschland
Ursprünglich erschienen bei J.R Metzlersehe Verlagsbuchhandlung
und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 1988
INHALTSVERZEICHNIS
Vorbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
DAS BILD VOM >VOLKSMÄRCHEN< IN DER WISSENSCHAFTLICHEN LITERATUR • • • 1
EINE GATTUNG ENTSTEHT: DIE GEBURT DER >CONTES DE FEES< • . . . . . . . • . 19
EIN JAHRHUNDERT FRANZÖSISCHER EINFLUSS ........•.. 31
Übertragungen orientalischer, pseudo-orientalischer und anderer
exotischer Stoffe . . . . . . . . . . . . . 33
Erste Übersetzungen von Feenmärchen 45
Die Bedeutung der Anthologien .... 60
Märchenhafte moralische Erzählungen . 63
Unmoralische Märchen und galante Erzählung 71
Tendenzen zur Eindeutschung und selbständige Beiträge
zum orientalisierenden Märchen . . . . . . . . . . . . . . 76
DER BLICK ZURÜCK: DIE WIEDERENTDECKUNG DES >VOLKSBUCHS< •. 88
Vom Gehörnten Siegfried zu Zachariäs wegweisenden Bearbeitungen 89
Reichard, Vulpius und die Bibliothek der Romane . . . . . . . . . . . 101
Andere Bearbeitungen, aufklärerisches und romantisches Volksbuchinteresse 112
VOM BAROCKEN KOMPILATOR ZUM DEISTISCHEN MYTHOLOGEN:
REFLEXIONEN ÜBER DAS MÄRCHEN . • . • . . . . . . • • • • • • . 125
VI Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Aussagen über das Märchen als Gattung 125
Einzelbeobachtungen theoretischer Natur 141
0 0 0 0 0 0
DIE ALLMÄHLICHE EMANZIPATION VOM FRANZÖSISCHEN VORBILD 152
o o o o o o o o
Sagenhaftes und erste Spuren märchenhaften Materials in der Schönen Literatur 153
0
Wielands Beitrag zur Anerkennung des Märchens 160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eine Vertauschung der Sphären: Durch mündlichen Vortrag
wird das Märchen dem kindlichen Auffassungsvermögen augepaßt 171
0
Musäus, die Volksmährehen der Deutschen und seine Nachahmer 188
0
DAs VoLK ALS DICHTER 207
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herders Konzeption von >Naturpoesie< und ihre Folgen 207
Rationalistische Kritik an der Konzeption der Volkstümlichkeit 220
MÄRCHENHAFTE VoRZEIT 225
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veit Webers Konzept des Mittelalters und die Geburt des Ritterromans 226
Die Erneuerung der >Volksmärchen<-Tradition in der Manier von Musäus
durch Benedikte Naubert und andere 233
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDIERUNG 241
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Märchenhaftes in späten Sammlungen des 18o Jahrhunderts 241
Das Märchen auf der Bühne und die Wien er Freude am Romantischen 252
0
DAS RESULTAT EINES JAHRHUNDERTS:
DIE WISSENSCHAFTLICHEN SAGENSAMMLUNG NACHTIGALS
UND HERDERS GEISTESGESCHICHTLICHER RüCKBLICK 258
o o o o
RESUMEE 265
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANMERKUNGEN 273
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inhaltsverzeichnis VII
329
ANHANG
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abkürzungsverzeichnis 330
0
Primärliteratur 331
0 0 0 0 0
Sekundärliteratur des 17 Jhos bis frühen 19 Jhos 397
0
Moderne Sekundärliteratur 408
Namenregister 426
0 0 0 0 0 0 0
VoRBEMERKUNG
Ziel dieser Arbeit ist es, das Märchen in der Epoche der deutschen Aufklärung, das
heißt während des 18.Jahrhunderts, zu untersuchen. Die Arbeit stellt sich dabei vor
allem zwei Aufgaben: Sie will einerseits Darstellung sein, das Gefundene ausbreiten;
andererseits soll das gewonnene Material kritisch gesichtet werden, vor allem in Hin
blick auf Herkunft, Alter, Vermittlungswege, -art und -träger.
Dabei werden sich schnell Zweifel an der bisher allgemein akzeptierten Aussage
einstellen, es habe im Deutschland des 18.Jahrhunderts zwar eine große Menge soge
nannter >Volksmärchen< gegeben, aber deren allgegenwärtige Existenz habe wegen der
damaligen Märchen- und Volksfeindlichkeit der gebildeten Schichten so gut wie keine
Spuren in der zeitgenössischen Literatur hinterlassen. Diese Hypothese von der apo
kryphen Existenz des >Volksmärchens< im Zeitalter der Aufklärung zu überprüfen,
wurde daher zum zentralen Thema dieser Arbeit.
Das vorliegende Werk stellt somit den Versuch einer Geschichte der Entwicklung
des Märchens im 18.Jahrhundert dar, wobei der Verfasser bemüht war, Entwicklungs
linien herauszuarbeiten, nicht hineinzudeuten. Um die Ergebnisse nachprüfbar zu ge
stalten, wurden in der Bibliographie die Standorte der benutzten Werke angezeigt.
Diese Arbeit möchte dazu beitragen, die Lücke zwischen den neueren Forschungen zu
Exempeln und Schwänken des Barocks und der modernen Grimm-Philologie zu
schließen.
DAS BILD VOM >VOLKSMÄRCHEN< IN DER WISSENSCHAFTLICHEN LITERATUR
Im folgenden soll skizziert werden, welches Bild sich die Wissenschaft, in erster Linie
also Germanistik und Volkskunde, vom sogenannten >Volksmärchen< machen. [1] Da
bei soll darauf verzichtet werden, die geistesgeschichtlichen Wurzeln der verschiedenen
Theoreme über das Märchen jeweils lückenlos zurückzuverfolgen, weil schon eine
kurze Lektüre der einschlägigen Zitate beweist, daß diese durchgängig in der Romantik
und besonders bei den Brüdern Grimm zu suchen sind. Auch ist es nicht beabsichtigt,
hier einen Kurzabriß über die diversen Märchentheorien in ihrer Gänze zu geben, über
deren Abfolge, Abhängigkeiten und Kontroversen bereits Literatur zur Genüge exi
stiert; am leichtesten zugänglich in der immer wieder aktualisierten Bibliographie Max
Lüthis in den >Realien zur Literatur< der >Sammlung Metzlers> [2], geraffter im Artikel
>Deutschland< der >Enzyklopädie des Märchens<. Weiterhin sei darauf hingewiesen, daß
viele der zitierten Autoren keineswegs durchgängig den hervorgehobenen Standpunkt
vertreten haben, sondern daß sie gelegentlich angesichts irgendwelcher Spezialproble
me in ihrer Meinung über die Wege der Märchentradition schwanken. Andererseits
finden sich die zitierten Meinungen auch bei zahlreichen hier nicht genannten Autoren
fast wortwörtlich wieder, und noch öfter liegen die gleichen Theorien unausgesprochen
den verschiedensten Märchenuntersuchungen, -darstellungen und -ausgaben zugrunde.
Nicht die Entwicklung des Gesamtbildes vom Märchen innerhalb der Erzählfor
schung steht hier aber zur Deabttte, sondern es soll ein Überblick über typische Aussa
gen zur Tradition des >Volksmärchens< im allgemeinen und zur Tradierung während
des Zeitalters der Aufklärung im besonderen gegeben werden. Dabei ist schon bald eine
solch erstaunliche Konstanz der Aussagen zu beobachten, daß es nahezu gleichgültig
ist, welche Arbeit der letzten beiden Jahrhunderte zu dieser Problematik herangezogen
wird: immer wieder stößt man auf die gleichen Grundaussagen. Diese Gleichförmigkeit
der Märchentheorien ist Resultat einer ausgesprochen statischen Auffassung vom Mär
chen, die davon ausgeht, daß sich das sogenannte >Volksmärchen< seit seiner Entste
hung in unbestimmter Vorzeit im Grunde nie verändert habe. Als einziger Gattung
wird dem Märchen mithin ein überzeitlicher, ahistorischer Charakter zugeschrieben,
der das Forschen nach wesentlichen Veränderungen im Erscheinungsbild dieser Gat
tung von vornherein als irrelevant erscheinen läßt. Je statischer aber das Märchen
aufgefaßt wird, um so überflüssiger wird demgemäß die Beschäftigung des Literaturhi
storikers mit dieser Gattung: nicht eine Entwicklung gilt es ja nachzuzeichnen, sondern
das >Wesen< gilt es zu ergründen.
2 Das Bild vom >Volksmärchen<
Die Theorie vom mythischen Alter des Märchens wurde schon früh von den Brüdern
Grimm vertreten. So schreibt Jacob Grimm am 29. Oktober 1812 in einem Brief an
Achim von Arnim, er sei fest überzeugt, »daß alle Märchen unserer Sammlung ohne
Ausnahme mit allen Umständen schon vor Jahrhunderten erzählt worden sind.<< [3]
Aus dieser Kontinuitäts-Hypothese folgte natürlich, daß man auch umgekehrt unbese
hen aus modernen Sagen- oder Märchenaufzeichnungen auf ältere, schlechter bezeugte
Zeiten zurückschließen könne, wie es dann vor allem in Jacob Grimms >Deutscher
Mythologie< von 1835 ständig geschah und wie es beispielsweise heute noch in den
Untersuchungen August Nitschkes durchexerziert wird. [4 ] Ein solches wechselseitiges
Deuten moderner Aufzeichnungen mit Hilfe alter mythischer Vorstellungen, wie sie in
antiken oder frühmittelalterlichen Quellen überliefert sind, und die gleichzeitige Inter
pretation dieser vorchristlichen, germanischen Mythen durch Jahrhunderte später ge
machte Beobachtungen ist methodisch recht problematisch. Doch noch bedenklicher
ist beispielsweise Wilhelm Grimms Schluß, neben der Heldensage habe das Märchen
gewiß ununterbrochen fortbestanden, >>schon in der heutigen oder einer ihr nahekom
menden Gestalt, nur weniger lückenhaft und gestört«. [5] Impliziert ist nämlich unaus
gesprochen die These, daß das Märchen eine Gattung sei, die sich seit ihrem Entstehen
in nicht beobachtbarer Vorzeit in ständigem Zerfall befinde. Dies führte bekanntlich
schon bei den Grimms zu einer recht bedenkenlosen >Verbesserung< unvollkommener
Aufzeichnungen aufgrund von Parallelversionen oder einfach aufgrund des eigenen
Märchenideals. Es gab aber gleichzeitig auch Anstoß zur Suche oder zur Rekonstruk
tion des sogenannten >Archetypus<, der angeblich einem jeden Märchen zugrunde gele
gen haben soll. Hierbei wurden häufig mit bedenkenloser Freizügigkeit auch andere
Gattungen herangezogen, denn vielen Erzählforschern gilt als ausgemacht: >>Je weiter
zurück, desto geringer müssen die Unterschiede der Gattungen gewesen sein. Es hat
allenthalben einmal eine Zeit gegeben, deren Denkform das Märchen war.<< [6] Die
Behauptung vom mythischen Alter des Märchens, das >>in die Kindheitstage der
Menschheit zurückreicht<< [7], und von seiner inhaltlichen und formalen Konstanz
hatte sich schon bald verfestigt, und so konnte nach der philologischen Erschließung
immer neuer Kulturen im Laufe des vorigen Jahrhunderts 1905 unbekümmert festge
stellt werden:
>>Bei Römern und Griechen, bei Indern und im alten Ägypten haben sich Märchen gefunden,
und immer wieder sind's dieselben schönen Geschichten, wie im indischen und deutschen
Märchen, im arabischen und lettischen.« [8]
Gelegentliche, Jahrhunderte umfassende Traditionslücken werden demgegenüber als
unwesentlich erachtet, denn unsere Literaturkenntnis für die Zeit der Kreuzzüge bei
spielsweise sei nun einmal äußerst dürftig, »und die Erwähnung eines oder des anderen
Märchenmotivs sind daher natürlich so vereinzelt und zufällig, daß man aus dem Feh
len eines Belegs für ein Märchen aus dieser Zeit keineswegs schließen darf, dasselbe
habe damals nicht bei uns existiert.<< [9] Abgesehen davon, daß hier Märchenmotiv und
vollständiges Märchen einfach parallel gesetzt werden, ist es auf jeden Fall noch weitaus
unzulässiger, wenn man-wie es nicht nur der ebengenannte Autor im weiteren Verlauf
seiner Untersuchung tut-aus dem Fehlen von Belegen geradezu auf die Existenz einer