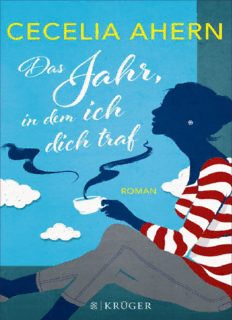Table Of ContentCecelia Ahern
Das Jahr, in dem ich dich traf
Roman
Inhalt
Für meine Freundin Lucy [...]
Der größte Ruhm liegt [...]
Winter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Frühling
14
15
16
17
18
19
Sommer
20
21
22
23
24
25
26
Herbst
27
28
Dank
Für meine Freundin Lucy Stack
Gerade als die Raupe dachte, alles sei vorbei, verwandelte
sie sich in einen Schmetterling …
Der größte Ruhm liegt nicht darin, niemals zu fallen,
sondern jedes Mal wieder aufzustehen.
Konfuzius
Winter
Die Zeit zwischen Herbst und Frühling, die auf der
nördlichen Halbkugel die kältesten Monate des Jahres
umfasst:
Dezember, Januar und Februar.
Eine Zeit der Untätigkeit oder des Zerfalls.
1
Ich war fünf Jahre alt, als ich erfuhr, dass ich irgendwann
einmal sterben würde.
Dass ich nicht ewig leben würde, war mir bis dahin nie in
den Sinn gekommen, warum auch? Niemand hatte je ein Wort
darüber verloren, nicht einmal flüchtig. Dabei wusste ich schon
einiges über den Tod. Goldfische starben, das hatte ich
hautnah miterlebt. Sie starben, wenn man sie nicht fütterte,
aber manchmal auch, wenn man sie zu viel fütterte. Hunde
starben, wenn sie vor fahrende Autos liefen, Mäuse starben,
wenn wir sie mit Schokokeksen in die Mausefalle lockten, die
wir in der kleinen Toilette aufgestellt hatten. Kaninchen
starben, wenn sie aus dem Stall ausrissen und von den bösen
Füchsen erwischt wurden. Doch die Erkenntnis, dass all diese
Wesen unter bestimmten Bedingungen sterben konnten,
versetzte mich keineswegs in Panik, denn selbst mit meinen
fünf Jahren wusste ich, = dass pelzige Tiere dumme Dinge
taten – Dinge, die mir niemals einfallen würden.
So war es ein ziemlicher Schock für mich, als ich erfuhr,
dass der Tod auch mich irgendwann einmal erwischen würde.
Meiner Quelle zufolge würde ich, wenn ich Glück hatte, auf
die gleiche Weise sterben wie mein Großvater. Nämlich alt.
Nach Pfeifenrauch und Fürzen riechend, mit
Taschentuchklümpchen vom Naseputzen auf der Oberlippe.
Mit Dreck unter den Fingernägeln von der Gartenarbeit. Mit
Augen, die sich in den Winkeln gelblich verfärbten und mich an
die Murmeln aus der Sammlung meines Onkels erinnerten, auf
denen meine Schwester so gern herumlutschte, bis sie mal eine
verschluckte, so dass mein Vater herbeistürzte und ihr so lange
auf den Bauch drückte, bis das Ding wieder herausgehopst
kam. Alt. Mit bis an seine wabblige Titten-Brust
hochgezogenen braunen Hosen, die sich über dem weichen
Wanst spannten, so dass darunter seine von der Hosennaht zur
Seite gedrückten Eier zu sehen waren. Alt. Nein, ich wollte
absolut nicht so sterben wie mein Großvater, aber meiner
Quelle zufolge war es das Beste, worauf ich hoffen konnte.
Es war am Tag der Beerdigung meines Großvaters, als ich
von meinem Cousin Kevin über meinen bevorstehenden Tod
aufgeklärt wurde. An diesem heißesten Tag des Jahres saßen
wir im Gras ganz hinten im langgezogenen Garten meines
Großvaters – so weit wie möglich von unseren trauernden
Eltern entfernt, die in ihren schwarzen Klamotten aussahen wie
Mistkäfer – und tranken rote Limonade aus Plastikbechern. Die
Wiese war übersät mit Löwenzahn und Gänseblümchen und
viel höher als sonst, denn aufgrund seiner Krankheit hatte
Großvater es in seinen letzten Wochen nicht mehr geschafft,
den Garten richtig zu pflegen. Ich erinnere mich, dass ich
traurig war und Großvater gern davor bewahrt hätte, dass sein
wunderschöner Garten ausgerechnet an diesem Tag, an dem er
sich nicht in dem von ihm stets angestrebten perfekten
Zustand befand, so vielen Nachbarn und Freunden präsentiert
wurde. Dass er heute nicht dabei sein konnte, hätte ihn sicher
nicht gestört – Reden war nicht seine Lieblingsbeschäftigung –,
aber er hätte sich garantiert bemüht, den Garten für die Gäste
angemessen zurechtzumachen. Dann wäre er verschwunden
und hätte sich von weitem die lobenden Bemerkungen
angehört, vielleicht am offenen Fenster oben im Haus. Er hätte
so getan, als wäre ihm die allgemeine Bewunderung egal, aber
das wäre sie ihm keineswegs gewesen, und er hätte mit seinen
grasfleckigen Knien und seinen schwarzgeränderten
Fingernägeln dort gestanden, ein zufriedenes Lächeln im
Gesicht. Eine ältere Dame, die sich ihren Rosenkranz ganz fest
um die Fingerknöchel geschnürt hatte, behauptete, sie fühle
seine Präsenz im Garten, aber ich merkte nichts davon. Ich war
ganz sicher, dass mein Großvater nicht anwesend war. Der
Zustand des Gartens hätte ihn geärgert, er wäre ihm
unerträglich gewesen.
Immer wieder füllte Großmutter eine Gesprächspause mit
Bemerkungen wie: »Aber seine Sonnenblumen gedeihen ganz
prächtig, Gott hab ihn selig«, oder: »Jetzt hat er die Petunien
gar nicht mehr blühen sehen«, worauf der Klugschwätzer
Kevin murmelte: »Ja, jetzt ist er selber der Dünger.«
Alle lachten leise. Über Kevins Kommentare wurde immer
gelacht, denn Kevin war cool. Er war der Älteste, fünf Jahre
älter als ich, und als reifer Zehnjähriger sagte er gemeine und
grausame Dinge, die sich kein anderer von uns Kindern getraut
hätte. Selbst wenn wir etwas gar nicht lustig fanden, lachten
wir, denn wir wussten, dass wir sonst umgehend zur
Zielscheibe seiner Gemeinheiten wurden. An jenem Tag traf es
mich. Ich fand es einfach nicht witzig, dass mein toter
Großvater unter der Erde lag und den Petunien beim Wachsen
half. Ich fand es auch nicht schrecklich. Nein, für mich war es
eher eine schöne, irgendwie bereichernde Vorstellung – und
vor allem schien es mir richtig. Genau das hätte mein
Großvater gewollt, jetzt, wo er nicht mehr mit seinen dicken
Wurstfingern zum Blühen und Gedeihen seines wundervollen