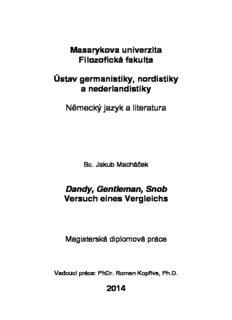Table Of ContentMasarykova univerzita
Filozofická fakulta
Ústav germanistiky, nordistiky
a nederlandistiky
Německý jazyk a literatura
Bc. Jakub Macháček
Dandy, Gentleman, Snob
Versuch eines Vergleichs
Magisterská diplomová práce
Vedoucí práce: PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D.
2014
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval
samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.
Ich versichere, die Magisterarbeit selbständig und lediglich unter Benutzung der
angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst zu haben.
...................................................
Podpis autora práce
2
Poděkování
Chtěl bych poděkovat vedoucímu této práce panu PhDr. Romanu Kopřivovi, Ph.D.
za pomoc, podnětné rady, ochotu a trpělivost.
Ich möchte mich bei dem Betreuer dieser Arbeit Herrn PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D.
für seine Hilfe, aufschlussreiche Ratschläge, Bereitwilligkeit und Duldsamkeit bedanken.
3
INHALT
1 EINFÜHRUNG .................................................................................................................................................. 5
1.1 HISTORISCHER HINTERGRUND ............................................................................................................... 5
1.2 LEBENSSTIL UM DIE JAHRHUNDERTWENDE ...................................................................................... 6
1.3 GESELLSCHAFTSTYPEN ............................................................................................................................. 8
2 SNOB UND SNOBISMUS ................................................................................................................................. 9
2.1 MODE UM DIE JAHRHUNDERTWENDE .................................................................................................. 9
2.2 SNOBISMUS UND SEIN URSPRUNG ....................................................................................................... 11
2.3 WESEN UND TYPEN DES SNOBISMUS ................................................................................................... 14
3 DANDY UND DANDYISMUS ........................................................................................................................ 20
3.1 LITERATUR VON UND ÜBER DANDY ..................................................................................................... 20
3.2 DANDYISMUS UND FIN DE SIÈCLE ....................................................................................................... 21
3.3 DANDY ALS KÜNSTLER ............................................................................................................................. 23
3.4 DANDY ALS KONSERVATOR .................................................................................................................... 25
4 DANDY VERSUS SNOB ................................................................................................................................. 27
4.1 DANDY IM DEUTSCHSPRACHIGEN KONTEXT .................................................................................... 27
4.2 DANDYISMUS – EINE ART DES SNOBISMUS? ..................................................................................... 29
4.3 DANDYISMUS UND EINZIGARTIGKEIT ................................................................................................. 30
5 GENTLEMAN ................................................................................................................................................. 33
5.1 GENTLEMAN ALS GEGENBILD DES SNOBS ........................................................................................ 33
5.2 GENTLEMAN UND DANDY ....................................................................................................................... 34
6 DANDY, GENTLEMAN, SNOB BEI RICHARD VON SCHAUKAL ....................................................... 37
6.1 ANDREAS VON BALTHESSER, VOM GESCHMACK ............................................................................. 37
6.2 DANDY BEI RICHARD VON SCHAUKAL ................................................................................................ 39
6.3 SNOB BEI RICHARD VON SCHAUKAL ................................................................................................... 41
6.4 GENTLEMAN BEI RICHARD VON SCHAUKAL ..................................................................................... 44
6.5 FORMALE SEITE SCHAUKALS WERKEN .............................................................................................. 46
7 FAZIT ............................................................................................................................................................... 51
7.1 ZUSAMMENFASSUNG DER GESELLSCHAFTSTYPEN ....................................................................... 51
7.2 GESELLSCHAFTSTYPEN UND RICHARD VON SCHAUKAL .............................................................. 56
LITERATURVERZEICHNISS ......................................................................................................................... 60
4
1 EINFÜHRUNG
1.1 Historischer Hintergrund
Das Ende des 19. und der Anfang des 20. Jahrhunderts stellen
für die deutsche und österreichische Gesellschaft eine
veränderungsvolle Epoche dar. Die immer weiter zunehmende
Industrialisierung bringt einerseits steigende Ansprüche der unteren
Gesellschaftsschichten mit sich, die mit der Demokratisierung und
der sozialen Nivellierung der Gesellschaft verbunden sind,
demgegenüber stehen die Interessen der oberen Schichten, die zwar
finanziell völlig saturiert sind, sich jedoch zugleich von der
steigenden Macht der niederen Gesellschaftsschichten bedroht
fühlen. Im Habsburgerreich kommt noch ein immer stärker
werdender Nationalismus und Partikularismus der einzelnen
Nationalgruppen hinzu, der nicht nur das politische Leben der
Monarchie paralysiert. Es ist bemerkenswert, dass die Gestalten von
einigen Politikern, die zu diesem Zustand beitrugen, auch mit dem
Thema dieser Arbeit zusammenhängen:
Auf politisch-sozialem Gebiet korrespondiert dieser Auflösung der Erfahrungswelt die
Desintegration desjenigen gesellschaftlichen Konsenses, der gemeinhin mit dem Stichwort
Liberalismus bezeichnet wird. In Österreich sind die partikularistischen Strömungen, für die
die Namen Karl Lueger, Georg von Schönerer und Theodor Herzl stehen können, Signale und
Symptome dieser Zersplitterung. Bezeichnenderweise gerieten sich zwei der erwähnten
politischen Führer als Dandys: Theodor Herzl ruft Brummels Namen auf, um seine Kritik an
Schnitzlers Kleidung zu pointieren; Georg von Schönerer rückt durch Bezeichnungen wie
Grandseigneur und Pseudoaristokrat in die Nähe des Dandyhaften.1
Ähnliche Zersplitterungstendenzen spiegeln sich auch in der
Kunst wider – manche künstlerische Strömungen streben nach der
Verbreitung und Demokratisierung der Kunst, sie suchen ihr Vorbild
im alltäglichen Leben. Andere kämpfen um die Exklusivität der
Kunst, die Gestalt des Künstlers stellt für sie ein Genie, einen
1 KROBB, Florian. Denn Begriffe begraben das Leben der Erscheinungen. Über Richard von Schaukals Andreas
von Balthesser und die Eindeutschung des Dandy. In: Eros Thanatos. Jahrbuch der Richard-von-Schaukal-
Gesellschaft. Kassel: 1997, S. 94.
5
Aristokraten des Geistes dar. Die Kunst dringt in ihrer
schematisierten Form, zu der auch die Dekoration gezählt werden
kann, auch in die Massenproduktion ein:
Obwohl Wien sich gleichfalls als Kunststadt, ja als Kunststadt par excellence fühlte, war die
Atmosphäre hier eine ganz andere. Es war nämlich weit weniger eine Stadt der Kunst als der
Dekoration par excellence.2
Die Gesellschaft steht an der Schwelle ihrer Entwicklung, in
der Luft ist das Erwarten eines Umbruchs zu spüren, über dessen
Charakter jedoch keine einheitliche Vorstellung herrscht. „Unser
Jahrhundert dürstet nach einer Tat“3 heißt eine der bekannten
Sentenzen aus Musils Roman. Seit dem Beginn einer solchen großen
Tat, die fast die ganze damalige Welt betraf und deren
Konsequenzen bis heute zu sehen sind, sind bereits hundert Jahre
vergangen. Diese Ereignisse beziehen sich jedoch nicht mehr auf das
Thema dieser Arbeit, die sich mit der vorhergehenden Periode
beschäftigen soll.
1.2 Lebensstil um die Jahrhundertwende
In den Großstädten des deutschsprachigen Raumes – vor allem
in Berlin, München und Wien – entsteht in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts eine neue Gruppe der Bevölkerung, die sich aus
dem Milieu der Großfabrikanten, erfolgreichen Händler und
hochgestellten Staatsbeamten etabliert und deren Mitglieder sich
langsam jene Manieren aneignen, die früher nur den aristokratischen
Kreisen vorbehalten waren. Mit der Eisenbahn sind jetzt auch die
westeuropäischen Metropolen leicht erreichbar, in denen die oben
erwähnte gesellschaftliche Entwicklung einen markanten Vorsprung
2 WUNBERG, Gotthard [Hrsg.]. Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910.
Stuttgart: Reclam, 1995, S. 101.
3 MUSIL, Robert. Der Mann ohne Eigenschaften: Roman. Neu durchgesehene und verbesserte Ausgabe.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988, S. 444.
6
aufweist und die als natürliche Vorbilder des Lebensstils der
Neureichen gelten.
Diejenigen, die sich nicht mit dem alltäglichen Geldverdienen
beschäftigen müssen, suchen einen alternativen Lebensinhalt, eine
Ersatzarbeit. Das eigentliche Vermögen schränkt solche Aktivitäten
keinesfalls ein, ganz im Gegenteil: Es ist eher ihr Initiator, denn die
reichen Mitmenschen müssen ihren Besitz in der Gesellschaft
entsprechend zur Schau stellen.
Es war eine Gesellschaft des exzessiven Konsums und der demonstrativen Verschwendung,
die der Renaissance des Dandytums den Weg bereitete. Die neuen Superreichen erstürmten die
Zitadellen gesellschaftlicher Exklusivität und stellten ihren neu erworbenen Reichtum mit
ausschweifender und unwiderstehlicher Vulgarität zur Schau.4
So wächst die Nachfrage nach Luxuswaren, die Zahlen der Mäzene
steigen, die „bessere Gesellschaft“ trifft sich in zahlreichen Salons
mit den berühmten Künstlern und Persönlichkeiten ihrer Zeit. Die
Salonkultur bietet eine gute Gelegenheit zum gesellschaftlichen
Verkehr, ihre Beteiligten haben zugleich gute
Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Menschen.
Mit dem Inhalt – in diesem Fall dem Vermögen, zu dem nur
eine bedeutende Geldsumme nötig ist – ist jedoch immer auch die
Form verbunden, nämlich die Verhaltensweise der Menschen. In den
aristokratischen Familien werden die Nachkommen schon im zarten
Alter zum guten Benehmen geführt, die Manieren werden „vererbt“.
In den nun in diese Gesellschaft gelangten Familien müssen sie
zuerst erworben werden – diese Tatsache führt zur Nachahmung,
deren Erfolg nicht ganz eindeutig sein muss. Dazu ist beim alten
Adel zu bemerken, dass er dies zu übersehen versucht oder eine
Verteidigungsposition einnimmt, die sich oft gegen die neu
entstandene, aus den kapitalistischen Kreisen stammende
Aristokratie richtet.
4 ERBE, Günter. Dandys – Virtuosen der Lebenskunst. Eine Geschichte des mondänen Lebens. Köln, Wien:
Böhlau, 2002, S. 195.
7
Diese neuen kapitalistischen Mächte aber, die begonnen hatten, den Geist Frankreichs
entscheidend zu beeinflussen, besaßen nicht die Instinktsicherheit, nicht das echte
Kulturbedürfnis der älteren, in langer Tradition verfeinerten Generationen; sie nahmen die
Kunst snobistisch als guten Ton auf und suchten in ihr prächtige Repräsentation ihrer
Geldmacht.5
In das Bewusstsein der oberen Klassen geraten im Rahmen dieser
Entwicklung auch neue Gesellschaftstypen.
1.3 Gesellschaftstypen
Diese Arbeit sollte sich mit drei Gesellschaftstypen befassen.
Das Phänomen des Dandyismus beschränkt sich nur auf eine kleine
Gruppe von Einzelnen, meist Künstlern oder Literaten, die einen
großen Teil ihres privaten Lebens ihrer Selbststilisierung widmeten.
Der Gentleman ist ein Typ, der in der Gesellschaft schon stärker
verbreitet ist. Es handelt sich um einen Menschen mit korrektem
Verhalten, es ist jedoch nicht einfach, ihn genauer zu definieren.
Der Snobismus ist ferner eine Massenerscheinung und hat viele
Arten und Formen.
Die Grenzen zwischen diesen drei Typen wie auch ihre
eindeutige Definitionen sind manchmal sehr problematisch, obwohl
man bei ihrer Komparation sowohl auf gewisse Unterschiede als
auch gemeinsame Merkmale stößt. Diese Arbeit sollte auch die
Genese dieser Typen beleuchten und ihre Beispiele in der
ausgewählten Literatur analysieren.
5 MANN, Otto. Der dandy. Ein Kulturproblem der Moderne. Heidelberg: Rothe, 1962, S. 27-28.
8
2 SNOB UND SNOBISMUS
2.1 Mode um die Jahrhundertwende
Der berühmte Wiener Architekt mährischer Herkunft Adolf
Loos widmet der Wiener Jubiläums-Ausstellung 1898 einen
Zeitungsartikel mit dem Titel Die Herrenmode. Unter seiner
subjektiven Sichtweise beschäftigt er sich mit dem Niveau des
Kleidungsstils im deutschsprachigen Raum, an manchen Stellen des
Textes beschreibt er auch allgemeinere gesellschaftliche und
ästhetische Erscheinungen der Zeit. Als Vorbild des erlesenen Stils
bezeichnet er England, die Kleidung soll seiner Ansicht nach
(ähnlich wie in seinem architektonischen Schaffen) möglichst
einfach sein – man solle „am wenigsten auffallen“, das
entscheidende Merkmal seien ausgewählte Stoffe und eine
hochwertige Verarbeitung.
Correct angezogen sein! Mir ist, als hätte ich mit diesen Worten das Geheimnis gelüftet, mit
dem unsere Kleidermode bisher umgeben war. Mit Worten wie schön, chic, elegant, fesch und
forsch wollte man der Mode beikommen. Darum handelt es sich aber gar nicht. Es handelt
sich darum, so angezogen zu sein, daß man am wenigsten auffällt.6
Die bereits in Deutschland und Österreich getragene Kleidung stößt
bei ihm für ihre Geziertheit und Ornamentalität auf harte Kritik:
Der große Dichter, der große Maler, der große Architekt kleiden sich wie diese [Engländer].
Der Dichter-, Maler- und Architektling aber macht aus seinem Körper einen Altar, auf dem
der Schönheit in Form von Sammtkragen, ästhetischen Hosenstoffen und secessionistischen
Cravaten geopfert werden soll.7
Schließlich widmet er sich der Mode und dem Prozess ihrer
Verbreitung. Die Menschen teilt er dabei in zwei Gruppen: Die erste
hat einen natürlichen, fast angeborenen guten Geschmack. Ihre
Mitglieder müssen zwar nicht notwendigerweise zur Aristokratie
gehören, trotzdem sind bei ihnen die aristokratischen Züge
6 LOOS, Adolf. Die Herrenmode. In: Neue Freie Presse. Morgenblatt, Nr. 12121, 22. Mai 1898, S. 16.
7 Ebd.
9
vorzufinden. In die zweite gehören die bloßen Nachahmer, die er als
„Gigerl“8 bezeichnet: „Das Gigerl trägt eben das, was seine
Umgebung für modern hält.“9 Das „Gigerltum“ beschränkt sich Loos
zufolge nicht nur auf die Kleidung, es ist eher ein Komplex von
typischen Eigenschaften, die dem „Gigerl“ zugeschrieben werden
können. Kennzeichnend ist für sie vor allem das Streben nach
sozialem Aufstieg, der durch die Abgrenzung von ihrem bestehenden
Umfeld erreicht werden soll.
Ein Kleidungsstück ist modern, wenn man im demselben im Culturcentrum bei einer
bestimmten Gelegenheit in der besten Gesellschaft möglichst wenig auffällt. Dieser englische
Gesichtspunkt, der jedem vornehm Denkenden, dem kleinlichen Abholden zusagen dürfte,
begegnet aber in den deutschen Mittel- und Niederkreisen lebhaftem Widerspruch. Kein Volk
hat so viele Gigerl wie die Deutschen. Ein Gigerl ist ein Mensch, dem die Kleidung nur dazu
dient, sich von seiner Umgebung abzuheben. Bald wird die Ethik, bald die Hygiene, bald die
Aesthetik herangezogen, um dieses hanswurstartige Gebahren erklären zu helfen. Vom
Meister Diefenbach bis zu Professor Jäger, von den „modernen“ Dichterlingen bis zum
Wiener Hausherrnsohn geht ein gemeinsames Band, das sie alle geistig mit einander
verbindet. Und trotzdem vertragen sie sich nicht mit einander. Kein Gigerl gibt zu, eines zu
sein. Ein Gigerl macht sich über das andere lustig, und unter dem Vorwande, das Gigerlthum
auszurotten, begeht nun immer neue Gigerliaden. Das moderne Gigerl oder das Gigerl
schlechtweg, ist nur eine Species aus dieser weit verzweigten Familie.10
Loos’ Definition des „Gigerltums“ erinnert den Leser in manchen
Merkmalen auffällig an eine andere gesellschaftliche Erscheinung in
ihrer grundsätzlichen Auffassung – an den Snobismus. Auch der
Snob will zu der höchsten sozialen Gruppe gehören und wendet
große Mühe auf, um dieses Ziel zu erreichen:
Gewiß, jener historisch fixierbare Typ des Snobs ist nicht mehr, den das englische
Großbürgertum im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts gebar, als es während seines Aufstiegs
den untergehenden Stern der Aristokratie zum Maß aller Dinge für das eigene Sozialprestige
erhob, getreu dem Gesetz, daß sich neu aufsteigende ökonomische Klassen und Schichten zur
Stillung ihres Prestigehungers immer an Gestus und Habitus der nächsthöheren orientieren,
um sich dadurch von den nachdrängenden umso stärker distanzieren zu können.11
8 Vgl. PAUL, Herrmann. Deutsches Wörterbuch. Tübingen: Max Niemeier Verlag, 1966, S. 264: „Gigerl,
mundartliche Bezeichnung des Hahns, dann übertragen auf einen jungen Stutzer und in diesem Sinne 1885 durch
E. Pötzl von Wien aus weiter verbreitet.“
9 LOOS, Adolf. Die Herrenmode, S. 16.
10 Ebd.
11 SCHUMANN, Hans-Gerd. Snob-Dandy-Playboy. Typen kultureller Transformation oder gesellschaftlicher
Restauration? In: Archiv für Kulturgeschichte 45, Heft 1. Köln, Wien: Böhlau Verlag, 1963, S. 120.
10
Description:28 HUXLEY, Aldous. Ausgewählte Snobismen. In: Über den Snob. München: R. Piper u. Co. Verlag, 1962,. S. 88. 29 KOESTLER, Arthur. Anatomie