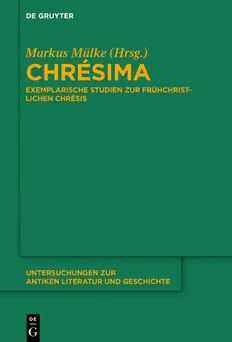Table Of ContentChrésima
Untersuchungen zur antiken
Literatur und Geschichte
Herausgegeben von
Marcus Deufert, Heinz-Günther Nesselrath
und Peter Scholz
Band 138
Chrésima
Exemplarische Studien
zur frühchristlichen Chrêsis
Herausgegeben von
Markus Mülke
ISBN 978-3-11-064641-2
e-ISBN (PDF) 978-3-11-065016-7
e-ISBN (EPUB) 978-3-11-064658-0
ISSN 1862-1112
Library of Congress Control Number: 2019939557
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2019 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
www.degruyter.com
Inhalt
Vorwort | 1
Chrêsis in der Bibel
Holger Gzella (Leiden)
Der theologische Gebrauch aramäischer Verwaltungsterminologie
im Danielbuch | 7
Christliche Apologeten
Heinz-Günther Nesselrath (Göttingen)
Wie man pagane Geschichtsschreibung ad maiorem Dei gloriam verwendet:
Der Altersbeweis in Tatians Rede an die Griechen | 21
Manabu Akiyama (Tsukuba)
Lo „gnostico“ e Chrêsis secondo Clemente Alessandrino | 45
Leonardo Lugaresi (Bologna)
Qualche osservazione su krisis e „giusto uso“ della cultura pagana
in Tertulliano | 57
Raban von Haehling (Aachen)
Vom Verlierer zum Vorbild: M. Atilius Regulus in der antiken
Geschichtsschreibung und christlichen Apologetik | 73
Kappadokier
Giulio Maspero (Rom)
Fantasie pagane e immaginazione cristiana nella teologia cappadoce | 95
VI | Inhalt
Hieronymus
Markus Mülke (Neuendettelsau)
Auf Studienreise? Apollonius von Tyana und Paulus bei Hieronymus
(epist. 53, 1–3 an Paulinus) | 115
Augustinus
Maria Becker (Münster)
„Verstehst Du auch, was Du liest?“ Möglichkeiten und Grenzen der
Bibelexegese nach Augustinus | 147
Maria Vittoria Cerutti (Milano)
Usus iustus e „monoteismo pagano“. Suggestioni storico-religiose a partire da
Augustinus doctr. 2, 40, 60 | 165
Giuseppe Fidelibus (Chieti)
La correlazione uti-frui nel De civitate Dei di Sant’Agostino. Apporti filosofici da
una controversia antica | 195
Christian Tornau (Würzburg)
Socrates christianus: Augustinus als Dialektiker im Briefwechsel mit
Longinianus (epist. 233–235) | 229
Christliche Dichtung
Wilhelm Blümer (Mainz)
Penthesilea – Camilla – Fides: Pagane Rezeption und christliche
Nutzung | 249
Bildende Kunst
Paolo Liverani (Florenz)
I vescovi e lʼuso del ritratto in età paleocristiana | 289
Inhalt | VII
Spätantike und Mittelalter
Nikolaus Staubach (Münster)
Omne quod vobis apponitur manducate. Speisegebote in der multireligiösen
Gesellschaft der Spätantike und im christlichen Mittelalter | 319
Register
1. Bibelstellen | 349
2. Werkstellen antiker und frühchristlicher Autoren | 351
3. Griechische Wörter | 358
4. Lateinische Wörter | 358
5. Namen, Wörter und Sachen | 359
Vorwort
Diejenigen Kulturgüter der antiken Welt, welche die Väter des frühen Christen-
tums nach dem Maßstab christlicher Wahrheit als nutzbar anerkannten, be-
zeichneten sie gern als χρήσιμα. Deren Χρῆσις (Chrêsis; lateinisch: usus iustus)
selbst, also die Methode diakritischer Beurteilung und selektiver Nutzung, prak-
tizierten sie dabei nicht nur im Vollzug, sondern durchdachten sie immer wie-
der auch theoretisch, ohne freilich jemals aus ihr ein vom konkreten Gegen-
stand losgelöstes, nur abstraktes Konzept zu machen. Wer die Chrêsis, eine der
entscheidenden Kräfte jener weltverändernden Transformation, welche die
Verwandlung der antiken Kultur in die frühchristliche darstellt, erforscht, geht
daher stets von der Erforschung eines χρήσιμον aus.
Die maßgeblichen Untersuchungen zur frühchristlichen Chrêsis hat Christian
Gnilka vorgelegt. Anstelle einer ausführlichen Einleitung zum Thema kann des-
halb hier auf die zweite, im Jahr 2012 erschienene Auflage des ersten Bands der
von ihm im Jahr 1984 begründeten Publikationsreihe ΧΡΗΣΙΣ. CHRÊSIS verwie-
sen werden. In dieser erheblich vermehrten Neufassung hat Gnilka die theoreti-
sche Durchdringung des rechten Gebrauchs antiker Kulturgüter, welchen die
Denker und Künstler der frühen Christenheit leisteten, nocheinmal auf eine
breitere Grundlage gestellt. Wie er selbst in den vergangenen Dezennien wieder-
holt hervorgehoben hat, sind jedoch weitere aussagekräftige Einzelstudien, in
denen das Prinzip des usus iustus in praxi nachgewiesen und vorgeführt wird,
dringend erwünscht.
Diesem Desiderat soll der vorliegende Band nachkommen, dessen Beiträge
die Autorinnen und Autoren Christian Gnilka anläßlich seines 80. Geburtstags
am 20. Dezember 2016 zugeeignet haben.1 Den Wert seines forscherlichen An-
satzes erweisen die hier vorgelegten Aufsätze auch dadurch, daß sie einerseits,
beginnend mit einer alttestamentlichen Schrift, den gesamten Zeitraum des
frühen Christentums bis zur Spätantike, andererseits neben der Literatur auch
archäologische und kunstgeschichtliche Denkmäler behandeln:
Holger Gzella (Leiden) legt eine begriffsgeschichtliche Studie der theologi-
schen Umdeutung altorientalischer Rechts- und Verwaltungsterminologie im
Buch Daniel und in aramäischen Qumrantexten vor und zeigt, daß eine frucht-
bare Anwendung der Methode vom „rechten Gebrauch“ nicht auf den Umgang
der Kirchenväter mit der klassischen Antike beschränkt bleibt. Durch einen Be-
||
1 Den Herausgebern der Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte sei hier für die
Aufnahme des Bands in die Reihe herzlich gedankt, ebenso den Herren Torben Behm und Flo-
rian Ruppenstein aus dem Haus De Gruyter für die zuvorkommende Betreuung der Herstellung.
https://doi.org/10.1515/9783110650167-001
2 | Markus Mülke
zug auf das göttliche Wesen und Handeln wurden bereits im Frühjudentum Be-
griffe wie „König“, „Herr“, „Richter“, „Gericht“, „verfügungsberechtigt“, „Edikt“,
„Staatsgesetz“ und andere ihrem eigentlichen Sinn zugeführt und im Gegenzug
Topoi der traditionellen Königstypologie polemisch entkräftet. Mit der Gestalt
Daniels, der sich bei Hof die babylonische Weisheit aneignete, hat die Chrêsis
sogar ein biblisches Urbild.
Der Beitrag von Heinz-Günther Nesselrath (Göttingen) befaßt sich mit dem
sogenannten Altersbeweis – d.h. dem Nachweis, daß Moses als Verfasser des
Pentateuch erheblich älter ist als die ersten Autoren der griechischen Literatur
(namentlich Homer) und damit auch die jüdisch-christliche Lehre älter und
damit besser ist als die griechische Religion und Philosophie – in der Rede an
die Griechen des Apologeten Tatian und dokumentiert, wie Tatian dabei gerade
das Zeugnis von griechischen Autoren (darunter auch solchen, über die Tatian
die Inhalte älterer nichtgriechischer Quellen einzubeziehen versuchte) einsetzt,
um dieses Darstellungsziel zu erreichen.
Manabu Akiyama (Tsukuba) widmet sich Clemens von Alexandria. Dessen
Haltung zum „Gebrauch (Chrêsis) weltlicher Güter“ zeigt sich insbesondere in
seiner Interpretation des Passah. In der Exodus schreibt das Gesetz des Herrn
dem Volk vor, zu essen als die, die „hinwegeilen“, und ein jedes Haus mit dem
Blut eines Lamms zu bestreichen, als „Zeichen“, auf daß der Herr „vorüberge-
he“. Clemens gebraucht das Wort „Zeichen“ im Sinn von „Kreuz“; der „Gnosti-
ker“, der die Auferstehung des Herrn in sich selbst verherrliche (strom. 7, 12, 76,
4), habe sich vorzubereiten auf den Auszug aus dieser Welt (vgl. strom. 4, 3, 12,
5–6). Das Sakrament der Konfirmation, das von Clemens bezeugt wird (päd. 1, 6,
45, 1), könnte dabei auf das Bestreichen mit dem Blut des Lamms zurückgehen.
Clemens betont den Wert der Kontemplation für den „Gnostiker“ (strom. 4, 6,
40, 1), die ihren Höhepunkt erreicht im Vergießen des Bluts (von ihm mit der
„Gnosis“ identifiziert, vgl. fr. 24) und des Wassers an Jesu Seite. Nach Clemens
muß der „Gnostiker“ danach streben, in dieser Welt all das aufzugeben, was
ihm nicht „nützlich“ sein wird (strom. 7, 7, 40, 3). Angezeigt sei es daher, Mo-
ses, den „Gnostiker“, anzuhören (strom. 5, 11, 74, 4).
Leonardo Lugaresi (Bologna) thematisiert das Verhältnis von krisis und
chrêsis aus dem Blickwinkel Tertullians: Das Christentum ist als „kritisches Fak-
tum“ fähig, die sozialen und kulturellen Systeme der griechisch-römischen
Welt, mit der es in Kontakt tritt, „kritischer“ Prüfung zu unterziehen. Aus die-
sem Blickwinkel erweist sich der retorsive Charakter der Apologetik Tertullians
gerade nicht als bloß defensive Taktik, sondern als wirksames Instrument solch
christlicher krisis, deren Auseinandersetzung mit dem römischen Rechtswesen