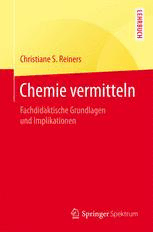Table Of ContentChristiane S. Reiners
Chemie vermitteln
Fachdidaktische Grundlagen
und Implikationen
Chemie vermitteln
Christiane S. Reiners
Chemie vermitteln
Fachdidaktische Grundlagen und Implikationen
Christiane S. Reiners
Universität zu Köln
Mathematisch-Naturwiss. Fakultät
Köln, Deutschland
ISBN 978-3-662-52646-0 ISBN 978-3-662-52647-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-52647-7
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Spektrum
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikro verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und
Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt
sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.
Planung: Margit Maly
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Spektrum ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg
V
Vorwort
Eine Vorlesung zum Thema „Einführung in die Chemiedidaktik“ oder „Grundlagen
der Chemiedidaktik“ ist an nahezu allen lehrerbildenden Universitäten in Deutsch-
land vorgesehen, und zwar unabhängig vom Studienprogramm. Sie war Bestandteil
der ehemaligen Studiengänge, die mit einem Staatsexamen abschlossen, und gehört
auch zum Curriculum der Lehrerbildung in den neuen Bachelor-/ Master-Struktu-
ren. Auch wenn die Inhalte der Vorlesung von Standort zu Standort leicht variieren
mögen, ist das grundsätzliche Ziel dieser Lehrveranstaltung, Studierende in eine
theoriegeleitete Analyse und Reflexion ihres späteren Berufsfeldes einzuführen,
wobei dies mehr oder weniger praxisorientiert erfolgen kann.
Grundlage dieses Buches sind sowohl die Erfahrungen einer zwanzigjährigen Lehre
in diesem Bereich als auch die Überzeugung, dass die Gestaltung von Vermittlungs-
prozessen alle betrifft, die um ein Verständnis von Chemie bemüht sind – sei es in
der Forschung, der Fachdidaktik oder im Unterricht. Diese Erfahrungen können
und wollen nicht frei sein von biografischen Einflüssen, die auch in diesem Werk
ihren Niederschlag finden.
Sie können auch nie abgeschlossen sein, da die Entwicklung der Chemiedidaktik ein
grundsätzlich offener Prozess ist, der hier nur als eine Art Momentaufnahme unter
Berücksichtigung bisheriger Problemstellungen wiedergegeben werden kann. Die
Entwicklung wird auch in Zukunft weitergehen und sich den verändernden Bedin-
gungen anpassen müssen, die durch bildungspolitische Vorgaben, Veränderungen
im Medienzeitalter, Änderungen in den Lerngruppen und Dingen, die derzeit kaum
abschätzbar sind, neue Herausforderungen mit sich bringen werden.
Bei allem Wandel werden aber grundsätzliche Betrachtungen weiterhin für das Ver-
ständnis der Chemie Bestand haben. So finden sich auch viele der in diesem Buch
behandelten Themen in anderen Lehr- und Studienbüchern zur Chemiedidaktik
wieder. Sie zeigen, dass man die Chemiedidaktik nicht neu erfinden, aber in Abhän-
gigkeit von dem eigenen Selbstverständnis unterschiedlich beleuchten kann. In die-
sem Buch geschieht dies auf der Grundlage des Transformationsmodells, das als eine
Art Leitlinie die Chemiedidaktik als eine Vermittlungswissenschaft zu begründen
versucht und hoffentlich nicht nur – wenn auch primär – den Lehramtsstudieren-
den, sondern auch allen an Vermittlungsprozessen Interessierten eine Orientierung
zu geben vermag.
Um die potenziellen Adressaten über die Inhalte der zu Beginn allgemeinen und am
Ende speziellen Kapitel zu informieren, werden eingangs Fragen aufgeworfen, die
in dem jeweiligen Kapitel behandelt und am Ende des Kapitels zusammenfassend
beantwortet werden. Auch die Literatur ist unterteilt in eine umfassende Liste am
Ende eines jeden Kapitels und eine grundlegende, die speziell den Lehramtskandi-
daten bei der Vorbereitung auf bestimmte Teilaspekte zur Lektüre empfohlen wird.
VI Vorwort
Die aktuellen Herausforderungen des derzeitigen Chemieunterrichts deuten darauf
hin, dass nicht nur chemiedidaktische Forschung, sondern auch chemiedidaktische
Lehre einem stetigen Wandel unterworfen ist, der nicht nur durch Reformen in
der Lehrerbildung, sondern maßgeblich auch durch neue Herausforderungen in
der Unterrichtspraxis bedingt wird. Der enge Zusammenhang zwischen Forschung
und Lehre wird auch in den Beiträgen meiner ehemaligen Doktorandinnen und
Doktoranden1 deutlich, die aus der Perspektive ihrer jeweiligen Forschungsprojekte
den Blick auf die Unterrichtspraxis fokussieren, um daraus wiederum neue Impulse
für die chemiedidaktische Lehre abzuleiten. Ihnen allen sei an dieser Stelle sehr
herzlich dafür gedankt, dass sie sich neben den beruflichen Aufgaben an diesem
Buchprojekt beteiligt haben!
Mein ganz besonderer Dank geht an Jörg Saborowski, der durch Rat und Kritik die
Entstehung des Buches unterstützt und mir in zahlreichen Gesprächen und Diskus-
sionen wertvolle Anregungen gegeben hat.
Mein großer Dank geht auch an meinen Doktoranden, Karl Marniok, der nicht nur
in unermüdlicher Kleinarbeit bei der Formatierung dieses Buches mitwirkte und
sämtliche Abbildungen erstellte, sondern auch „pingeligst“ die Literaturangaben
überprüfte.
Darüber hinaus danke ich auch meinem gesamten Kölner Team, das mir während
meines Forschungssemesters den Rücken frei gehalten hat, damit ich mich möglichst
uneingeschränkt diesem Buchprojekt widmen konnte.
Bedanken möchte ich mich auch bei Markus Narres und dem Team des Medienla-
bors für die Unterstützung bei der Erstellung vieler Fotos.
Schließlich danke ich Frau Stella Schmoll und Frau Margit Maly für die konstruktive
und kompetente redaktionelle Unterstützung während der gesamten Zeit.
Es würde mich sehr freuen, wenn dieses Lehrbuch allen Lehramtskandidaten den
Einstieg ins Studium erleichtern und all jenen, die an der Vermittlung einer natur-
wissenschaftlichen Grundbildung interessiert sind, den Weg in die Chemiedidaktik
ebnen könnte.
Christiane S. Reiners
Köln im Frühjahr 2016
1 Auch wenn im Verlauf des Buches aus Gründen der Lesbarkeit die männliche Form bevorzugt
werden wird, sind derartige Formulierungen geschlechtsneutral zu verstehen.
VII
Inhaltsverzeichnis
1 Von der Lehrkunst zur Vermittlungswissenschaft .......................1
Christiane S. Reiners
1.1 Entwicklung der Fachdidaktik ................................................2
1.2 Fachdidaktik im Spannungsfeld zwischen Allgemeiner Didaktik und
Fachwissenschaft.............................................................6
1.3 Chemiedidaktik auf dem Weg zur Professionswissenschaft ...................8
1.4 Fachdidaktik als Vermittlungswissenschaft ..................................12
1.5 Wissensvermittlung als Transformationsprozess .............................15
Literatur......................................................................18
2 Wissensvermittlung als Bildungsauftrag ............................... 21
Christiane S. Reiners
2.1 Das Bildende der Naturwissenschaften ......................................22
2.2 Das Wesen der Chemie.......................................................25
2.3 Das Lernen von Chemie......................................................29
Literatur......................................................................31
3 Wissensvermittlung durch Transformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Christiane S. Reiners, Jörg Saborowski
3.1 Naturwissenschaft Chemie als Vermittlungsgegenstand.....................34
3.1.1 Chemiespezifische Inhalte.....................................................34
3.1.2 Chemiespezifische Methoden .................................................37
3.2 Voraussetzungen der Lernenden ............................................54
3.2.1 Denkstrukturen...............................................................54
3.2.2 Wissensstrukturen ............................................................58
3.2.3 Verfahren zur Erhebung kognitiver Voraussetzungen ...........................60
3.2.4 Mögliche Lernwege...........................................................64
3.3 Ziele der Vermittlung ........................................................68
3.3.1 Von der Inhaltsorientierung zur Lernzielorientierung ...........................68
3.3.2 Von der Lernzielorientierung zur Kompetenzorientierung.......................72
3.3.3 Kompetenzentwicklungsmodelle..............................................75
3.4 Die Transformation am Beispiel von „Nature of Science“ (NOS)...............77
3.4.1 Was ist NOS?..................................................................77
3.4.2 Warum soll NOS vermittelt werden?............................................78
3.4.3 Welche Voraussetzungen bringen die Lernenden zu NOS mit?...................81
3.4.4 Wie kann ein Verständnis von NOS gefördert werden? ..........................83
Literatur......................................................................85
4 Auf dem Weg zum Chemieunterricht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Christiane S. Reiners, Jörg Saborowski
4.1 Medien ......................................................................92
4.1.1 Fachsprache..................................................................96
4.1.2 Experimente.................................................................105
VIII Inhaltsverzeichnis
4.1.3 Modelle .....................................................................111
4.1.4 Weitere Medien..............................................................121
4.2 Methoden ..................................................................124
4.2.1 Methodische Entscheidungen in prinzipiellen Schritten........................125
4.2.2 Methodische Entscheidungen in konkreten Schritten..........................133
4.2.3 Methodenwerkzeuge ........................................................137
Literatur.....................................................................143
5 Aktuelle Herausforderungen für den Chemieunterricht .............147
Christiane S. Reiners, Katharina Groß,
Adejoke Adesokan, Andrea Schumacher
5.1 Individuelle Förderung im Chemieunterricht................................148
5.1.1 Diagnose im Chemieunterricht ...............................................149
5.1.2 Differenzierung im Chemieunterricht .........................................156
5.1.3 Differenzierungsmöglichkeiten im Chemieunterricht ..........................158
5.1.4 Konsequenzen der Diagnose und der inneren Differenzierung im
Chemieunterricht............................................................166
5.2 Inklusion im Chemieunterricht..............................................167
5.2.1 Von der Exklusion zur Inklusion...............................................167
5.2.2 Gestaltungsmöglichkeiten ...................................................172
5.2.3 Probleme und Problemverkürzungen .........................................174
5.2.4 Chemiedidaktische Lösungsansätze ..........................................175
5.2.5 Ausblick.....................................................................177
5.3 Forschendes Lernen im Chemieunterricht...................................177
5.3.1 Forschendes Lernen als Ziel des Chemieunterrichts............................178
5.3.2 Forschung und Schule .......................................................179
5.3.3 Konzepte und Möglichkeiten zum Forschenden Lernen in der Schule...........180
5.3.4 Darstellung eines Unterrichtsbeispiels ........................................183
5.3.5 Konsequenzen...............................................................185
Literatur.....................................................................185
Serviceteil ................................................................193
Ausgewählte Literatur zur Vertiefung .........................................194
Stichwortverzeichnis.........................................................197
1
1
Von der Lehrkunst zur
Vermittlungswissenschaft
Christiane S. Reiners
1.1 Entwicklung der Fachdidaktik – 2
1.2 Fachdidaktik im Spannungsfeld zwischen
Allgemeiner Didaktik und Fachwissenschaft – 6
1.3 Chemiedidaktik auf dem Weg zur
Professionswissenschaft – 8
1.4 Fachdidaktik als Vermittlungswissenschaft – 12
1.5 Wissensvermittlung als Transformationsprozess – 15
Literatur – 18
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017
C. S. Reiners, Chemie vermitteln, DOI 10.1007/978-3-662-52647-7_1
2 Kapitel 1 • Von der Lehrkunst zur Vermittlungswissenschaft
-
-
? Was sind die Wurzeln des Begriffs Didaktik?
1
Wie kann Fachdidaktik zwischen Fachwissenschaft und Allgemeiner Didaktik verortet wer-
-
den?
2 - Was zeichnet die Fachdidaktik als Vermittlungswissenschaft im weiteren Sinne aus?
Wie lässt sich Fachdidaktik als Vermittlungswissenschaft im engeren Sinne kennzeichnen?
3
1.1 Entwicklung der Fachdidaktik
4
Während der Überfahrt nach Frauenchiemsee (. Abb. 1.1) fragte mich der Fährmann in bes-
5 tem bayerischen Dialekt: „Fahren Sie zur Arbeit oder zum Urlaub auf die Insel?“ „Zur Arbeit“,
antwortete ich. „Als was arbeiten Sie denn?“, fragte der Fährmann weiter. „Ich bin Chemiedi-
daktikerin“, antwortete ich, ahnte jedoch, dass ihm diese Berufsbezeichnung nicht viel sagen
6
würde. Und so ergänzte ich schnell: „Ich bilde Chemielehrer aus.“ Nach einer kurzen Bedenk-
zeit antwortete der Fährmann: „Das heißt, Sie bringen den Lehrern bei, wie sie den Schülern
7
Chemie beibringen sollen.“
Eine eher technische Vorstellung des Bei-Bringens kam auch vor wenigen Jahren im Zeit-
8 Magazin zum Ausdruck, in dem „Über den Wahn, dass Kinder alles können müssen“ berichtet
wurde (Zeit-Magazin 2009, . Abb. 1.2). Aus der Abbildung lässt sich die Botschaft ableiten, dass
Lerngegenstände (hier Klötze) an die Voraussetzungen der Lernenden (hier Löcher) angepasst
9
werden müssen. Die Anpassung muss notfalls erzwungen werden (hier durch Hammer und
Schrauber).
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
. Abb. 1.1 Auf dem Weg zum Bayerischen Forschungskolloquium auf Frauenchiemsee (2013)