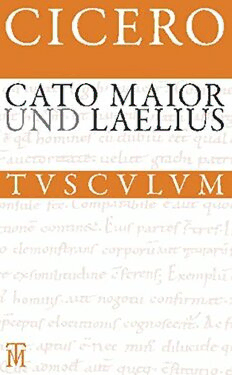Table Of ContentS A M M L U NG T U S C U L UM
In Tusculum, vor den Toren
Roms, hatte Cicero sein Land-
haus. In Zeiten der Muße, aber
auch der politischen Isolation
zog er sich dorthin zurück.
Tusculum wurde zum Inbegriff
für Refugium, fiir Muße, für
wertvolle Fluchten aus einem
fordernden Alltag.
In der ersten Phase des Rück-
zugs aus der Politik schrieb
Cicero in Tusculum die
sogenannten Tuskulanen,
eine lateinische Einführung in
die Welt der (griechischen)
Philosophie.
Wissenschaftliche Beratung
Niklas Holzberg,
Rainer Nickel,
Karl-Wilhelm Weeber,
Bernhard Zimmermann
CICERO | CATO MAIOR& LAELIUS
Marcus Tullius Cicero
Cato Maior de senectute
Über das Alter
&
Laelius de amicitia
Über die Freundschaft
Lateinisch-deutsch
Aus dem Lateinischen
übersetzt von Max Faltner
Mt einer neuen Einführung
herausgegeben von
Rainer Nickel
Mt einem Register von
Gerhard Fink
5., komplett überarbeitete
Auflage
SAMMLUNG TUSCULUM
AKADEMIE VERLAG
Bibliographische Information der
Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek
verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen National-
bibliographie; detaillierte bibliographische
Daten sind im Internet über
http:/ / dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2011 Akademie Verlag GmbH, Berlin
Ein Wissenschaftsverlag der Oldenbourg Gruppe
www.akademie-verlag.de
Das Werk einschließlich aller Abbildungen ist
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und
strafbar. Das gilt insbesondere iur Vervielfältigun-
gen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen
Systemen.
Umschlaggestaltung und graphisches Konzept:
Gabriele Bürde, Berlin
Satz: Dörlemann Satz, Lemförde
Druck: Pustet Grafischer Großbetrieb, Regensburg
Dieses Papier ist alterungsbeständig nach
DIN/ISO 9706.
ISBN 978-3-05-005274-8
INHALT
Einleitung 7
Text und Übersetzung 37
CatoMaior 37
Laelius 133
Anhang 239
Anmerkungen 241
Register 261
Literaturhinweise 279
EINLEITUNG
In seiner Schrift über die Zeichendeutung (De divinatione)
stellt Cicero sich selbst die Frage, womit er möglichst vielen
Menschen nützlich sein könne, um in seinem Einsatz für den
Staat nicht nachzulassen. Da sei ihm keine größere Aufgabe
vor Augen getreten, als seinen Mitbürgern die Wege der wich-
tigsten Wissenschaften darzustellen. So habe er unter anderem
mit dem Hortensius zum Studium der Philosophie aufgefordert
und in den vier Büchern der Académica die philosophisch-
skeptische Methode des Erkenntnisgewinns dargestellt. Da die
Grundlage der Philosophie auf den Gedanken Über das höchste
Gut und über das größte Übel beruhe, habe er auch dieses Thema
behandelt. Darauf seien die Tuskulanischen Gespräche gefolgt, die
die unabdingbaren Voraussetzungen eines glücklichen Lebens
klären sollen: Das erste Buch befasse sich mit der Verachtung
des Todes, das zweite mit dem Ertragen von Schmerzen, das
dritte mit der Linderung von Kummer, das vierte mit den üb-
rigen Affekten, und das fünfte gehe auf das Thema ein, das die
Zielsetzung der Philosophie umfassend veranschauliche: auf
die Überzeugung, dass Glück auf Exzellenz (virtus) beruhe, die
sich selbst genüge.
Cicero zählt im Anschluss daran noch weitere wichtige
Werke seiner schriftstellerischen Arbeit au£ bis er schließlich
kurz auf seine Trostschriß1 zu sprechen kommt: »Sie verschafft
mir selbst jedenfalls Trost, und ich glaube, dass sie auch anderen
i Cicero verfasste diese Schrift nach dem Tod seiner Tochter Tullia im Februar 45
v. Chr.; der Text war schon am 8. März abgeschlossen (Cicero, Ad Atticum 12,
11,5)-
101 EINLEITUNG
Menschen gut helfen kann. Neulich habe ich hier auch noch
die Schrift Über das Alter eingereiht, die ich unserem Freund
Atticus widmete.2 Weil die Philosophie manchmal einen tapfe-
ren und tüchtigen Mann hervorbringt, muss man ganz beson-
ders auch unseren Cato zu unseren philosophischen Schriften
zählen.«3
In einem Brief an Atticus4 vom 12. Mai 44 v. Chr. bezeichnet
Cicero seine Schrift De senectute als Cato Maior.s Er schreibt an
Atticus, er müsse seinen Cato Maior selbst öfter lesen, den er
ihm, dem Freund, gewidmet habe: Denn das Alter mache ihn
manchmal ziemlich bitter. »Ich ärgere mich über alles. Aber ich
habe mein Leben gelebt. Jetzt mögen die jungen Leute zusehen,
dass sie sich bewähren!«
Zu Beginn des Cato Maior (1-3) begründet Cicero diese
Widmung an Atticus ausfuhrlich. Er kenne ihn als einen be-
2 Zur Person des Atticus vgl. Olaf Perlwitz: Titus Pomponius Atticus, Stuttgart
1992.
3 Karl Büchner setzt die Schrift Cato Maior de senectute irrtümlich mit dem Cato
gleich. Der in De divinatione i, 3 erwähnte Cato ist aber eine in nur wenigen
Fragmenten erhaltene Lobschrift auf den jüngeren Cato, der im Jahr 46 v. Chr.
Selbstmord beging. Vgl. dazu auch A. S. Pease: M. Tulli Ciceronis de divinatione
(1920/1921), Darmstadt 1963,351 f
4 Ad Atticum 14,21,3. Cicero hatte den Cato Maior wahrscheinlich schon vor Cae-
sars Tod (15. März 44 v. Chr.) geschrieben. Sicher ist jedenfalls, dass die Schrift vor
dem 12. Mai 44, vor De divinatione und nach De natura deorum entstand.
5 Als Titel für die Schrift ist die Doppelung Cato Maior de senectute üblich geworden.
Das Adjektiv maior war ursprünglich kein Namensbestandteil des Marcus Por-
cius Cato Censorius. Cicero selbst nennt seine Schrift in dem zitierten Atticus-
Brief »Cato Maior«, um zu verdeutlichen, dass es sich in der vorliegenden Schrift
um den älteren Cato und nicht um seinen Urenkel, den jüngeren Marcus Porcius
Cato Uticensis, handelt.