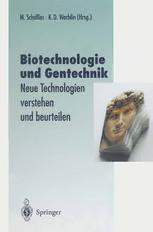Table Of ContentM. Schallies . K. D. Wachlin (Hrsg.) Biotechnologie und Gentechnik
Springer
Berlin
Heidelberg
New York
Barcelona
Hongkong
London
Mailand
Paris
Singapur
Tokio
Michael Schallies . Klaus D. Wachlin (Hrsg.)
Biotechnologie
und Gentechnik
Neue Technologien verstehen und beurteilen
Unter der Mitarbeit von Ulrike Hafner
Mit 3 Abbildungen und 16 Tabellen
Springer
Professor Dr. MICHAEL SCHALLIES
Padagogische Hochschule Heidelberg
KeplerstraBe 87
69120 Heidelberg
KLAUS D. WA CHLIN
Akademie fUr Technikfolgenabschatzung
in Baden-Wtirttemberg
IndustriestraBe 5
70565 Stuttgart
Danksagung. Fiir wertvolle Anregungen und ihre Unterstiitzung bei der Er
stellung des Werkes sei Dr. Anneliese Wellensiek und Anja Lembens von der
Arbeitsgruppe VIT an der Padagogischen Hochschule Heidelberg herzlich ge
dankt.
ISBN-13: 978-3-642-64225-8 Springer-Vedag Berlin Heidelberg New York
Die Deutsche Bibliothek -CIP-Einheitsaufnahme
Biotechnologie und Gentechnik: neue Technologien verstehen und
beurteilen I Hrsg.: Michael Schallies ; Klaus D. Wachlin. -Berlin ;
Heidelberg; New York; Barcelona; Budapest; Hongkong ; London;
Mailand; Paris; Singapur; Tokio: Springer, 1999
ISBN-13: 978-3-642-64225-8 e-ISBN-13: 978-3-642-60028-9
DOl: 10.1007/978-3-642-60028-9
Dieses Werk ist urheberreehtlieh gesehutzt. Die dadurch begriindeten Rechte. insbesondere die der 'Ober
setzung des Naehdrucks,des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der
Mikroverfilmung oder der Vervielfliltigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenver
arbeitungsanlagen. bleiben auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfliltigung die
ses Werkes oder von Teilen dieses Werkes is1: auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen
Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland Yom 9. September 1965 in der
jeweils geltenden Fassung zulassig. Sie ist grundsiitzlich vergiitungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterlie
gen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
@ Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1999
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezekhnungen usw. in diesem Werk berech
tigt auch ohne besondere Kennzeichnung nieht zu der Annahme, daB so1che Namen im Sinne der
Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von jedermann
benutzt werden durften.
Ptbdukthaftung: Fiir Angaben uber Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag
keine Gewahr iibernommen werden. Derartige Angaben miissen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall
anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit uberpriift werden.
Satz: Druckfertige Vorlagen der Herausgeber
Einbandgestaltung: Struve & Partner, Heidelberg
SPIN 10677427 31/3137 -5 4 3 210 -Gedruckt auf saurefreiem Papier
Vorwort
Das Werk "Biotechnologie und Gentechnik .. Neue Tedmologien verstehen und
beurteilen" wendet sieh einem hachst aktuellen Thema zu. Es ist aus den Beitra
gen einer Ringvorlesung hervorgegangen, die von del' Padagogischen Hochschule
Heidelberg und der Akademie flir Technikfolgenabschatzung in Baden
Wtirttemberg gemeinsam geplant und mit dem lnstitut flir Weiterbildung an der
Padagogischen Hochschule Heidelberg im Wintersemester 1997/98 durchgefiihrt
wurde. Die Einzelbeitrage einer Gruppe von Autoren unterschiedlichster Herkunft
zielen nieht primiir auf die .d etaiIlierte Erweiterung des aerzeitigen Expertenwis
sens tiber Bioteclmologie und Gentechnik ab, sondem beschaftig,en sich mit der
Fragestellung, welcher Voraussetzungen zum Verstehen und BeurteiIen dieser
modemen Schlusseltechnologie die interessierten Burger bedilrfen. Das Verstehen
neuer Technologien umfaBt dabei - plakativ gesagt - wissensbasierte Standpunkte
und begriindete Ansichten, verknilpftes und anwendungsbezogenes Wissen, inte
grierte Siehtweisen der Realitat und der Wechselwirkungen zwischen Wissen
schaft, Technik und Gesellschaft.
Zweifellos spielt das allgemeine Bildungswesen beim Aufbau von Technolo
gieverstandnis in diesem Sinne eine tragende RoUe: Die grundlegenden naturwis
senschaftlichen Sachverhalte werden im Vedauf der Schulzeit behandelt, Denk
und Handlungsstrukturen werden in der Auseinandersetzung mit naturwissen
schaftlichen und technologischen Wissensbestanden erworben und dabei an sub
jektive und intersubjektive Bewertungen in ihrer aJtersgemaBen Auspriigung ge
bunden. Wobei ein reifes, entwickeltes Technologieverstiindnis auch die Hihigkeit
der lndividuen erfordert, einander sich widersprechende Faktoren abzuwagen und
Entscheidungen rucht nur im Hinblick auf eigene Werte und Auffassungen, son
dem auch im Hinblick auf das, was anderen wiehtig und wertvoU ist, zu rechtfer
tigen. Mit diesen Fragestellungen beschaftigen sich die Beitriige von M Brumlik
und A. Wellensiek aus der Sieht der Erziehungswissenschaften unter entwick
lungspsychologischen Aspekten im Licht vorhandener Theorien und Erkenntnisse
sowie der Beitrag von M Schallies aus dem Blickwinkel der Naturwissenschafts
didaktik unter Beriicksichtigung empirischer Untersuchungen tiber neue Curricu
la, die sich insbesondere Lemzielen auf dies em Feld zuwenden.
Direkt hat das Thema Biotechnologie und Gentedmik in seinen unterschiedli
chen Dimensionen bereits in die Lehrplane von allgemeinbildenden Schularten
Einzug gehalten. Dies gilt sowohl fur die naturwissenschaftlichen Facher, insbe
sondere die Biologie (Beitrag von U. Harms und H Bayrhuber) sowie Religions
lehre bzw. das neue Fach "Ethik", mit dessen Gegenstand und Zielsetzung sich
die Beitrage von M Sanger und R. Wimmer beschaftigen. Darilber hinaus fmden
VI Vorwort
die aktuellen Entwicklungen auf diesem Gebiet vielfach bereits vor der Haustilr
der Schulen - so beispieisweise in einer der sich rasch entwickeInden
"Bioregionen" wie dem Rhein-Neckar-Dreieck - statt und geben AnIaB, sich auf
der Ebene von Aktualitlit und AUtagsbezug mit der Thematik auseinanderzuset
zen. 1m vorliegenden Buch wird eine authentische Sichtweise von Akteuren auf
dem Gebiet des untemehmerischen Denkens und Handelns durch den Beitrag von
U. Abshagen eingebracht, der deutlich macht, daB die Umsetzung von wissen
schaftlichen Erkenntnissen in praktische Anwendungen ein komplexes Unterfan
gen ist, "bei dem das Wesentliche in den Kopfen passieren muS".
Die schulische Behandlung der mit den Anwendungen von Biotechnologie und
Gentechnik einbergehenden Fragestellungen steHt wegen ihrer Zukunftsbedeutung
eine Herausforderung dar. Sie ist gIeichzeitig so schwierig, da es zur Beurteilung
modemer Technologien mit ihrer typischen Komplexitllt verschiedener Befiihi
gungen von Individuen bedarf. FUr die Beurteilung von Biotechnologie und Gen
technik sind erforderlich:
• Sachwissen auf einem Gebiet modemer Technologj.eentwicklung. das sich mit
einer enormen Geschwindigkeit weiterentwickelt. -
• Strategisches Denken in bezug auf die Zielsetzungen und die Wahlm~glich
keiten, die fUr die Losung komplexer Probleme, z. B. im Bereich der Landwirt
schaft, der Pharmazit: oder der Medizin, bestehen.
• Die Rejlexion und PrUfung der damit verbundenen ZieIsetzungen, Werte und
Normen, die der BiIdung eines eigenen selbstlindigen Urteiles und dem ent
sprechenden Handeln zugrunde gelegt werden konnen.
Beispielhaft hierzu sind die Beitrllge von K Platzer und B. Skorupinsld.
Die beschriebene Vielschichtigkeit wird leicht aIs Uberforderung empfunden,
so daB die Versuchung naheliegt, Fragestellungen modemer Technologieent
wicklung ausschlieBlich an Experten der verschiedenen Fachgebiete zu delegie
ren. Wie J. Bugl in seinem einleitenden Beitrag ausfilhrt, sind in der Demokratie
jedoch keine "Entscheidungseliten" gefragt, sondem die Bereitstellung von adres
satengerechten Informationen fUr die selbstandige Entscheidungsfindung der BUr
ger. Eine modeme Technikfolgenabschlitzung bescMftigt sich daher auch mit der
Frage der Organisation von l)ffentlichen Diskursen, in denen Expertenwissen mit
Laienwissen zusammentritR und an konkreten Aufgabenstellungen Technikent
wicklung gestaltet wird. Der Beitrag von H J. Bremme und L von dem Bussche
Hiinnefeld nimmt das Thema Offentlichkeit und Gentechnik: aus der Sicht eines
Betriebes der chemischen GroBindustrie auf und erganzt so die allgemeineren
Ausfilhrungen J. Bug/s.
1m Rahmen des allgemeinen Bildungsauftrages zur Vorbereitung junger Men
schen auf die Erfordemisse der modemen Lebens-und Arbeitswelt muB bereits in
der Schule ein Beitrag dazu geleistet werden, den Umgang mit der Komplexitlit
solcher Probleme zu Oben. Dies geschieht jedoch keineswegs ausschlieBlich auf
einer rein rationalen Ebene, vielmehr beeinflussen die bei Jugendlichen und Kin
dem bereits vorliegenden Vorstellungen und Alltagsmythen den rationalen Dis
kurs zur Gentechnik:, wie der Beitrag von U. Gebhard deutlich macht. Einstellun
gen zur Gentechnik, so das Ergebnis aus der empirischen Untersuchung mit Gym-
Vorwort VII
nasial- und GewerbeschOlem von G. Keck und 0. Rerm, werden von moralischen
Erw!gungen als bedeutsamster EinfluBgri)Be determiniert. Zur Beantwortung der
aIlgemeinen und tlbergeordneten Frage, wie ein angemessenes Technologiever
stlindnis im Verlauf der Schulzeit entwickelt werden kann, ist daher eine aus
schlieBlich als Faktenvennittlung konzipierte UIliterrichtliche Behandlung der
Thematik "Biotechnologie UIlid Gentechnik" ungeeignet.
AbschlieBend mOchten wir darauf hinweisen, daB aIle in diesem Buch verwen
deten Personalbegriffe, wie beispielsweise SchOler, Lehrer, Studenten usw., aus
GrUnden der besseren Lesbarkeit einheitlich gewlhlt wurden und sich in gleicher
Weise auf AngehOrige beider Geschlechter beziehen.
Heidelberg/Stuttgart, September 1998 Michael Schalliesl
Klaus D. Wachlin
Inhaltsverzeichnis
1 Technikfolgenabschiitzung - Aufgaben und Perspektiven
J. Bugl. ................................................................................................................ 1
1.1 Einleitung ................................................................................................... 1
1.2 Technikakzeptanz - Technikkritik heute .................................................... 3
1.3 Verantwortbar gestaltete Technik .............................................................. 5
1.4 Die Befriedigung menschlicber BedOrfnisse als Ziel jeder technischen
Entwicklung ............................................................................................... 6
1.5 Technikfolgenabscbatzung als Schltlssel zur TecMikgestaltung .............. 8
1.6 Technikfolgenabscbatzung als gesellscbaftliche Aufgabe ....................... l0
1.7 Wie'seben Politik und Wirtscbaft Technikfolgenabscbatzung? ............... 12
Literatur ................................................................................................... 13
2 Das BioRegio-Konzept des Rheio-Neckar-Dreieckes: Vision und Strategie
U. Abshagen ...................................................................................................... 15
2.1 Ziele des Bundeswettbewerhes ,,BioRegio" ............................................ 15
2.2 Die Bioregion Rhein-Neckar-Dreieck ..................................................... 15
2.3 Von der innovativen Idee zur Umsetzung in Produkte ............................ 17
2.4 Wer sind die Akteure der Umsetzung des BioRegio-Konzeptes im
Rhein-Neckar-Dreieck? ........................................................................... 18
2.5 Biotechnologieentwicklung und Gesellscbaft .......................................... 22
3 Biotechnologie und Gentechnik - Implikationen fUr das Bildungsweseo
M Schallies ....................................................................................................... 25
3.1 Einleitung ................................................................................................. 25
3.2 Naturwissenschaftlicber Unterricbt - genereUe Trends und
Erfabrungen ............................................................................................. 26
3.3 Neue Curricula als Antwort auf gesellschaftliche Entwicklungen ............ 28
3.4 Zusammenfassung und Ausblick ............................................................. 33
Literatur ................................................................................................... 35
4 Ethik der Tugend uod Soziobiologie - eine realistische Perspektive?
M Brumlik ........................................................................................................ 39
4.1 Eine Theorierenaissance .......................................................................... 39
4.2 Motivation, Charakter und Eigenliebe ...................................................... 40
4.3 Wirkliche Menschen und empirische Forschung ..................................... 41
4.4 Moralhegriffe ........................................................................................... 42
4.5 Evolutionsbiologie ................................................................................... 43
X Inhaltsverzeichnis
4.6 Eine universelle Entwicklung der moralischen Urteilsflihigkeit? ........... .47
4.7 Zur evolutionaren Bedeutung des universeUen Vorkommens einer
universalistischen Moral .......................................................................... 49
4.8 Theoretische Schlussigkeit und Materialismus .......................................... 52
Literatur .................................................................................................... 52
5 Entwicklung moralischer Urteils-und Handlungsflihigkeit im Bereicb
neuer Tecbnologien
A. Wellensiek ...................................................................................................... 55
5.1 Bestimmung des Gegenstandes ................................................................. 55
5.2 Zielebenen fUr das Untersuchungsfeld "Technologieverstllndnis" ......... 5(j
5.2.1 Was ist allgemein unter einem angemessenen
Technologieverstlindnis zu verstehen? ........................................... 56
5.2.1.1 Verantwortlichkeit als zentrale moralische Kategorie im
Bereich modemer Technologien ........................................ 57
5.3 Wie ist ein angemessenes Technologieverstlindnis zu erreichen? ........... 59
5.3.1 Entwicklu,lgstheorien ..................................................................... 59"
5.3 .1.1 Interpersonales Verstehen und Verhandeln ........................ 60
5.3.1.2 Valuing in Technology ....................................................... 61
5.4 MaBnabmen zut' Initiierung soziomoralischer Lemprozesse ................... 62
5.4.1 Der Forschungsbaustein "Modellversuch" ..................................... 63
5.4.2 Gemeinsame didaktische Reflexion und konkreter Unterricht
am Beispiel der Gelelektrophorese ................................................. 64
5.4.2.1 Didaktische Reflexion: der Lambda-Ki~ .............................. 65
5.4.2.2 Diskussion von methodischen Zugangen ............................ 66
5.4.2.3 Metakognitives Verfahren als Zugangsvariante ................. 66
5.4.3 Bewertung im Zusammenhang ....................................................... 66
Literatur .................................................................................................... 67
6 Die Rolle der Wissenscbaftsetbik im Ethikunterricht
R. Wimmer ........................................................................................................ 69
6.1 Einleitung ................................................................................................. 69
6.2 Die verschiedenen Bedeutungen von Wissenschaftsethik ....................... 69
6.3 Die schulische Vermittlung wissenschaftsethischer Urteils-und
Handlungskompetenz .............................................................................. 73
Literatur ................................................................................................... 76
7 Verantwortung ais Zielsetzung und Gegenstand des Etbikunterrichtes
M Sanger ........................................................................................................ 77
7.1 Die Bedeutung des Verantwortungsbegriffes .......................................... 77
7.2 Verantwortung in der padagogischen Diskussion ..................................... 78
7.3 Inhalte des Ethikunterrichtes ................................................................... 79
1.4 Elemente der Verantwortungsrelation ..................................................... 80
7.5 Grundarten der Verantwortung ................................................................ 81
7.6 Die Verantwortungsethik im 20. Jahrhundert ........................................... 82
7.7 Ausblick ................................................................................................... 84
Iohaltsverzeicbois Xl
Literatur ....................................................................................................... 84
8 Biotechnologie im Unterricht
U Harms, H Bayrhuher ..................................................................................... 87
8.1 Einleitung .................................................................................................. 87
8.2 Beispiele fUr den Biologieunterricht tiber Biotechnologie ....................... 88
8.3 Unterrichtsmaterialien der European Initiative for Biotechnology
Education ................................................................................................ 89
8.4 Wissenschaftliche Untersuchungen uber Interessen und EinsteUungen
von Jugendlichen zum Thema Gentechnik ................................................ 91
8.5 Ein didaktisches Konzept fUr den Unterricht rum Thema Gentecl:mik
und die ethische Analyse ......................................................................... 93
8.6 Entwicklung von Unterrichtsmaterialien rum Thema Gentechnik
fUr den Biologieunterricht im Rahmen des BMBF-Projektes
"Wissenschaftliche Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten zur
unterrichtlichen Behandlung der Gentechnik unter besonderer
Berucksichtigung ethischer Fragen" ....................................................... 94
8.7 Das ACGT des Lebens - die Kartierung und Sequenzierung des
menschlichen Genoms ............................................................................. 96
Literatur ..................................................................................................... 98
9 Alltagsmythen und Metapbern - Phantasien von JugendUcben zur
Gentecbnik
U Gebhard ....................................................................................................... 99
9.1 Latente Sinnstrukturen beeinflussen den rationalen Diskurs zur
Gentechnik ............................................................................................... 99
9.2 Vorstellungen von Jugendlichen zur Gentechnologie-
Zusammenfassung der Ergebnisse einer Fragebogenstudie ....................... 100
9.3 Phantasien, Alltagsmythen und Metapnem ........................................... 102
9.4 "Der Doppelg1inger« - eine Gruppendiskussion zum Kionen ............... 106
9.5 "leh denke, 11inger leben hat schon seine Vorteile." - Interpretation
ausgewiihlter Passagen ........................................................................... 111
Literatur ................................................................................................. 115
10 Gentechnik aus der Sicht von Scbiilern
G. Keck, O. Renn ............................................................................................ 117
10.1 Zielsetzung der Stuilie ........................................................................... 117
10.2 Untersuchungsdesign und Methode ........................................................ 119
10.3 Deskriptive Ergebnisse .......................................................................... 120
10.3.1 Segen-Fluch-Indikator ................................................................ 120
10.3.2 Gentechnik im Alltag .................................................................. 120
10.3.3 Subjektives und objektives Wissen fiber Gentechnik ................. 120
10.3.4 InformationsqueUen zur Gentechnik und deren
Glaubwllrdigkeit ......................................................................... 121
10.3.5 Schulische Beschliftigung mit Gentechnik ................................. 122
10.3.6 AuBerungen verschiedener F achlehrer gegenuber Gentechnik .. 122