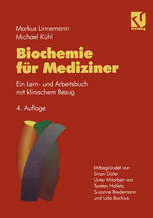Table Of ContentVIlla ~He 4 00260 10 Ne 20 179 ; 18 ! Ar 39948 36 Kr 83.80 54 Xe 131.29 86 Rn 12221 71 Lu ~4.96-=-J 103 Lr 12601
VIIa 9 F lB9984 17 CI 35453 35 Br 79.904 53 I 126905 85 At 12101
VIa H 0 159994 16 S 3206 34 Se 7896 52 Te 12760 84 Po 12091
Va 7 N 14 0067 15 P 309736 33 As 749216 51 Sb 121 75 83 Bi 208980
IVa 6 C 12 011 14 Si B 0855 32 Ge 72 59 50 Sn 118 71 82 Pb 207 2
2
lIla 5 B 10 Hl 13 AI 26 9H 15 31 Ga 6972 49 In 11482 81 Ti 204.383
nte IIb 30 Zn 6539 48 Cd 112 41 80 Hg 20059
eme Ib 29 Cu 63546 47 Ag 107 868 79 Au 196967
l
E
er . 28 Ni 5869 46 Pd 10642 78 Pt 195.08
d -
em VIllb .-J' 27 Co 589332 45 Rh 102906 77 Ir 19222
t .
nsys , 26 Fe 55347 44 Ru 101 07 76 Os 1902
iode VIIb 25 Mn 549380 43 Tc '98' 75 Re 186207 3 107 Uns 12621
r
Pe Vlb 24 Cr 51996 42 Mo 9594 74 W 183.85 1063 Unn 12631 ---
Vb 23 V 09415 41 Nb 29064 73 Ta 80948 1053 Unp 12621
5 9 1
IVb Illb 22 21 Ti Sc 88 449559 47 40 39 Zr Y 91 224 889059 72 57 * La Hf 138906'1'17849 I 89 1043 Ac.Unq 0l81_~611_ 227 Lanthanoide Actinoide
e IIa 4 Be 9 0121 P, 12 Mg 24305 20 Ca 4008 38 Sr 87 62 56 Ba 137 33 88 Ra 226025 * •
GruppIa 1 H 1 0079 3 Li 6941 11 Na 22 9898 19 K 390983 37 Rb 654678 55 Cs 132905 87 Fr '2231 --
Markus Linnemann
Michael Kühl
Biochemie
für Mediziner
Lernen mit neuen Medien: _____________ ___..
Aktiv und Effizient
Heinz Schmidkunz
Edition CyberMedia: Biochemie
Lern- und Übungssoftware
Edition CyberMedia ist das neue Medium für Schüler und
Studenten, um auf dem Bildschirm zu lernen, Erlerntes effizient
einzuüben und über Informationssysteme das Wissen zu erweitern.
Alle in dieser Reihe erscheinenden Anwendungen sind miteinander
verknüpft. Sie können im gesamten Wissensraum auf ihrem
Rechner schnelle Stichwort- und Volltextsuche betreiben.
Individuelle Notizzettel, Lesezeichen und Ankerfunktionen helfen
dem kreativ Lernenden bei der Orientierung. Erfahren Sie diese
neue Dimension des Lernens!
In der Edition CyberMedia liegt eine Einführung in die Bio
chemie vor, die alle wesentlichen Aspekte der Grundlagen dieser
Disziplin umfaßt. Der gesamte Kurs gliedert sich in sieben
Programmteile, die jeweils einen bestimmten Bereich der statischen
und dynamischen Biochemie beinhalten. Bei der Darstellung der
Inhalte wurde besonderer Wert auf die lernwirksame Vermittlung
mit modernen Methoden gelegt. Die einzelne Lerneinheit (ent
sprechend einer Bildschirmseite ) ist nach wahrnehmungs
psychologischen Erkenntnissen im Informationsgehalt so gewählt,
daß sie mit dem Gegenwartsgedächtnis gut erfaßt wird. Durch das
anschließende aktive Verarbeiten gelingt es leicht, diesen Infor
mationsanteil in das Kurzzeitgedächtnis zu überführen. Durch
immanente Wiederholung gelingt auch das Training des Langzeit
gedächtnisses.
Der Kurs richtet sich sowohl an alle Naturwissenschaftler im
Grundstudium als auch an alle Schüler in naturwissenschaftlichen
Ausbildungen und Medizinstudenten.
Vieweg ___________________
~
Markus Linnemann
Michael Kühl
Biochemie
für Mediziner
Ein Lern- und Arbeitsbuch
mit klinischem Bezug
4. Auflage
Mitbegründet von Sinan Güler
Unter Mitarbeit von
Torsten Holletz, Susanne Bredemann
und Udo Bockius
IJ
Vleweg
Die 1.-3. Auflage ist im Selbstverlag erschienen.
4. Auflage 1995
Das vorliegende Werk wurde sorgfaltig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor und Verlag für die Richtigkeit von
Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung. Die Wiedergabe von
Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere
Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Warenschutz
gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Alle Rechte vorbehalten
© Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1995
Der Verlag Vieweg ist ein Unternehmen der Bertelsmann Fachinformation GmbH.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim
mung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für VervieWiltigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeiiung in
elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-528-06671-0 ISBN 978-3-322-92912-9 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-92912-9
v
Vorwort zur vierten Auflage
Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Studentinnen und Studenten medizinischer Fä
cher in der Vorklinik. Erfahrungsgemäß stellt die Biochemie eine der großen Hürden vor
dem Physikum dar, die viele durch das Auswendiglernen aneinandergereihter Fakten zu be
wältigen suchen. Häufig bleibt zwischen Praktika und Prüfungen wenig Zeit, sich mit den
umfassenden, "großen" Lehrbüchern auseinanderzusetzen. So bleibt in vielen Fällen nur der
Ausweg über die sogenannten Repetitorien, die in geraffter Form Faktenwissen auflisten,
ohne dem Leser ein Verständnis für Zusammenhänge zu vermitteln. Diese Art des Lernens
ist lästig, die gespeicherten Fakten werden nach den Prüfungen schneller vergessen, als sie
erlernt wurden. Die Biochemie bleibt leider all zu oft als ein Fach in Erinnerung, an das
man nur mit Schaudern zurückdenkt, zumal die Relevanz für den Klinikalltag leider oft ge
nug undeutlich bleibt.
Das vorliegende, nunmehr in der 4. Auflage erscheinende Buch, trägt einerseits dem Zeit
mangel von Studentinnen und Studenten Rechnung, andererseits wird - wo nötig - Erklä
rungen angemessen Platz eingeräumt.
In der Regel bauen die Kapitel dieses Buches aufeinander auf. Bisweilen ließen sich Vor
griffe nicht vermeiden, so daß in diesen Passagen auf nachfolgende Abschnitte verwiesen
werden mußte. An vielen Stellen wird dem Leser das Faktenwissen zusätzlich zum Text
noch einmal in einer Tabelle präsentiert. Insbesondere trifft dies auf die einzelnen Vitamine
zu.
Was ist neu an der 4. Auflage? Zunächst wurden die meisten Abbildungen überarbeitet und
zum Teil durch bessere ersetzt. Im Kapitel 3 wird insbesondere die Säulenchromatographie
ausführlicher anhand neuer Graphiken dargestellt. In Kapitel 4 wurde die Substratüber
schußhemmung eingefügt, Kapitel 7 beinhaltet nun einen ausführlichen Abschnitt zum
Thema Karies. Er wurde von Herrn Udo Bockius aus Gießen verfaßt. In Kapitel 9 ist als
klinischer Bezug die Choledocholithisasis aufgenommen worden, die Themen Multiple
Sklerose und "Rinderwahnsinn" wurden aus aktuellem Anlaß in das Buch eingefügt (Kapitel
13 und 17). Insgesamt wird auch der Anatomie mehr Aufmerksamkeit zuteil, insbesondere
in den Kapiteln 12, 13 und 14. Im Kapitel I, das im wesentlichen von Torsten Holletz
bearbeitet wurde, findet man neue Diagramme zum Säure-Base-Haushalt. Der Anhang (Ka
pitel 18) wird ab dieser Auflage von einem Abschnitt über logarithmisches Rechnen einge
leitet, die Fragensammlung entfällt.
Die Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften manifestiert sich in ihren wich
tigsten Protagonisten. Aus diesem Grunde haben zu den bedeutendsten Personen bio
graphische Daten in Fußnotenform Eingang in diese Auflage gefunden.
Wir möchten abschließend allen danken, die an der Fertigstellung dieser Auflage mitgewirkt
haben, ganz besonders Torsten Holletz, Susanne Bredemann, Udo Bockius und Frau Dr. A.
Schulz vom Vieweg-Verlag.
Möge dieses Buch ein Hilfe für alle diejenigen sein, die aus Interesse oder notgedrungen
mit einer der dynamischsten Wissenschaften unserer Zeit, der Biochemie, in Berührung
kommen.
Berlin und Ulm, im Februar 1995
VI
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeine chemische Grundlagen .......................................... 1
1.1 Atombau und Periodensystem der Elemente ............................................................ 1
1.1.1 Der Aufbau der Atome .................................................................................................. 1
1.1.2 Die Elektronenstruktur der Atome ................................................................................ 3
1.1.3 Das Periodensystem der Elemente ................................................................................ 7
1.2 Die Grundtypen der chemischen Bindung ................................................................ 9
1.2.1 Die Ionenbeziehung ...................................................................................................... 9
1.2.2 Die metallische Bindung ............................................................................................. 10
1.2.3 Die Atombindung ....................................................................................................... 10
1.2.4 Koordinative Bindungen ............................................................................................. 17
1.2.5 Wasserstoffbrückenbindung ....................................................................................... 18
1.2.6 Van-der-Waals-Bindung ............................................................................................. 19
1.3 Stereochemie. ............................................................................................................. 19
1.4 Chemische Reaktionen .............................................................................................. 25
1.4.1 Stoffmenge und molare Masse .................................................................................... 26
1.4.2 Konzentration ............................................................................................................. 28
1.4.3 Stöchiometrische Berechnungen ................................................................................. 29
1.4.4 Chemisches Gleichgewicht ......................................................................................... 31
1.4.5 Massenwirkungsgesetz ............................................................................................... 31
1.4.6 Thermodynamik chemischer Reaktionen .................................................................... 33
1.4.6.1 Der Begriff des Systems ............................................................................................. 33
1.4.6.2 Arbeit, Wärme und Energie: Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ...................... 34
1.4.6.3 Die Reaktionsenthalpie ............................................................................................... 35
1.4.6.4 Der zweite Hauptsatz oder: Immer diese Unordnung ................................................. 36
1.4.6.5 Gibbs-Helmholtz-Gleichung oder: Die Freiwilligkeit chemischer Reaktionen ........... 37
1.4.7 Kinetik chemischer Reaktionen .................................................................................. 38
1.5 Säuren und Basen ..................................................................................................... 43
1.5.1 Säuren und Basen nach Brönsted ............................................................................... 43
1.5.2 Definition des pH-und des pK-Begriffes, Ionenprodukt des Wassers ........................ 45
1.5.3 pH-Wert-Berechnungen starker und schwacher Säuren ............................................. 49
1.5.4 Säure/Base-Titrationen ............................................................................................... 50
1.5.5 Puffer und Pufferkapazität .......................................................................................... 51
1.5.6 Klinischer Bezug: Azidose und Alkalose ................................................................... 55
1.5.6.1 Respiratorische Azidose ............................................................................................. 56
1.5.6.2 Nicht-respiratorische Azidose ..................................................................................... 57
1.5.6.3 Respiratorische Alkalose ............................................................................................ 58
1.5.6.4 Nicht-respiratorische Alkalose .................................................................................... 58
1.6 Redoxreaktionen ....................................................................................................... 58
1.6.1 Oxidation und Reduktion -Definition der Begriffe .................................................... 58
1.6.2 Die Oxidationszahlen .................................................................................................. 60
1.6.3 Das Elektrodenpotential und die elektrochemische Spannungsreihe .......................... 61
1.6.4 Die Nernstsche Gleichung .......................................................................................... 65
VII
2 Aminosäuren, Peptide und Proteine ...................................... 67
2.1 Die allgemeine Struktur der Aminosäuren. .....................••.•...•.•..•....•••••.•.........••••... 67
2.2 Chemische Einteilung der Aminosäuren ................................................................. 68
2.3 Seltene Aminosäuren ................................................................................................ 72
2.4 Definition des isoelektrischen Punktes pI, Titrationskurven von Aminosäuren ... 73
2.5 Essentielle Aminosäuren ........................................................................................... 77
2.6 Autbau der Peptidbindung ....................................................................................... 78
2.7 Wichtige Peptide ....................................................................................................... 78
2.8 Peptidgifte .................................................................................................................. 82
2.9 Proteine ...................................................................................................................... 82
2.9.1 Einteilung und Bedeutung der Proteine ...................................................................... 82
2.9.2 Primär-, Sekundär-, Tertiär-und Quartärstruktur ....................................................... 84
2.9.3 Hämoglobin und Myoglobin: Ein Vergleich .............................................................. 90
2.9.4 Das Sauerstoffbindungsverhalten von Hämo-und Myoglobin ................................... 94
2.9.5 Die Beeinflussung der Hämoglobinallosterie durch äußere Faktoren ....................... 101
3 Experimentelle Methoden ..................................................... 10 7
3.1 Trenn-und Reinigungsverfahren für Proteine und Nukleinsäuren .................... 107
3.2 Elektrophoretische Trennmethoden ...................................................................... 108
3.3 Chromatographische Trennmethoden ................................................................... 113
3.3.1 Gelchromatographie .................................................................................................. 114
3.3.2 Ionenaustauschchromatographie ............................................................................... 117
3.3.3 Affinitätschromatographie ........................................................................................ 119
3.3.4 Dünnschichtchromatographie ................................................................................... 121
4 Enzyme und Coenzyme ......................................................... 123
4.1 Definitionen ............................................................................................................. 123
4.2 Benennung und Einteilung der Enzyme ................................................................ 125
4.3 Der Begriff des Coenzyms ...................................................................................... 126
4.3.1 Definition .................................................................................................................. 126
4.3.2 Der Vitaminbegriff ................................................................................................... 129
4.4 Aktivierungsenergie und Übergangszustand ........................................................ 130
4.5 Das aktive Zentrum ................................................................................................. 135
4.6 Die Triosephosphat-Isomerasereaktion als Beispiel einer Enzyrokatalyse ........ 136
4.7 Michaelis-Menten-Kinetik und ihre lineare Transformation .............................. 139
4.7.1 Die Michaelis-Menten-Gleichung ............................................................................ 139
4.7.2 Die Michaelis-Konstante .......................................................................................... 142
4.7.3 Die Michaelis-Menten-Auftragung ........................................................................... 143
4.7.4 Die Lineweaver-Burk-Gleichung und ihre Auftragung ............................................. 143
4.7.5 Die Eadie-Hofstee-Gleichung und ihre Auftragung .................................................. 144
4.8 Die Hemmung enzymatisch katalysierter Reaktionen .......................................... 145
4.8.1 Die kompetitive Hemmung ....................................................................................... 145
4.8.2 Die nichtkompetitive Hemmung ............................................................................... 148
4.8.3 Die unkompetitive Hemmung ................................................................................... 152
VIII
4.8.4 Die Substratüberschußhemmung .............................................................................. 155
4.8.5 Die irreversible Hemmung ........................................................................................ 157
4.9 Die Regulation der Enzymaktivität ....................................................................... 158
4.9.1 Regulation durch Rückkopplung .............................................................................. 158
4.9.2 Die allosterische Regulation von Enzymen .............................................................. 159
4.9.3 Regulation durch Interkonversion ............................................................................ 161
4.9.4 Die regulierte Aktivierung von Enzymen durch Proteolyse ...................................... 161
4.10 Isoenzyme und Multi-Enyzm-Komplexe ............................................................... 162
4.11 Enzymeinheiten ....................................................................................................... 163
4.12 Klinischer Bezug ..................................................................................................... 164
5 Kohlenhydrate I ..................................................................... 168
5.1 Begriffe und Definitionen ....................................................................................... 168
5.2 Darstellungsformen ................................................................................................. 171
5.3 Disaccharide und Polysaccharide .......................................................................... 17 5
5.4 Abgeleitete Verbindungen ...................................................................................... 179
5.5 Die Biotransformation ............................................................................................ 185
5.6 Glucosediagnostik in der Klinik: Der optische Test ............................................. 191
5.7 Heteroglykane: Glykoproteine ............................................................................... 196
5.8 Klinischer Bezug ..................................................................................................... 199
5.8.1 Melliturie .................................................................................................................. 199
6 Lipide I .................................................................................... 200
6.1 Definition und Einteilung der Lipide ..................................................................... 200
6.2 Fettsäuren und Triglyceride ................................................................................... 201
6.2.1 Struktur und physikalische Eigenschaften der Fettsäu ren .. .'. .................................... 201
6.2.2 Bedeutung der Fettsäuren ......................................................................................... 206
6.2.3 Triglyceride (Triacylglycerole) ................................................................................. 208
6.2.4 Wachse ..................................................................................................................... 211
6.3 Phosphatide ............................................................................................................. 212
6.4 Sphingolipide ........................................................................................................... 220
6.5 Glykolipide .............................................................................................................. 222
6.6 Cholesterol. .............................................................................................................. 223
6.6.1 Bedeutung ................................................................................................................. 223
6.6.2 Struktur, Isomerie und Nomenklatur des Cholesterols ............................................. 225
6.6.3 Die Synthese des Cholesterols .................................................................................. 228
6.6.4 Die Regulation der Cholesterol-Synthese ................................................................. 230
6.7 Vitamin A ................................................................................................................ 232
6.8 Die Plasmamembran ............................................................................................... 236
6.8.1 Allgemeine Eigenschaften der Plasmamembran ....................................................... 236
6.8.2 Die Lipide der Membranen ....................................................................................... 237
6.8.3 Die Membranproteine ............................................................................................... 238
6.8.4 Die Kohlenhydrate der Membran ............................................................................. 239
6.9 Transportvorgänge durch Membranen ................................................................. 240
6.9.1 Begriffsdefinitionen .................................................................................................. 240
IX
6.9.2 Passiver Transport .................................................................................................... 241
6.9.3 Aktiver Transport ...................................................................................................... 243
6.9.4 Klinischer Bezug ...................................................................................................... 245
7 Kohlenhydrate 11 ................................................................... 247
7.1 Verdauung und Resorption von Kohlenhydraten ................................................. 247
7.2 Glykolyse ................................................................................................................. 248
7.2.1 Definiton und Bedeutung der Glykolyse ................................................................... 248
7.2.2 Übersicht und Einteilung der Glykolyse ................................................................... 249
7.2.3 Die Bilanz der Glykolyse .......................................................................................... 251
7.2.4 Die Schritte der Glykolyse ........................................................................................ 252
7.2.5 Die Regulation der Glykolyse ................................................................................... 258
7.2.6 Die alkoholische Gärung .......................................................................................... 259
7.2.7 Stoffwechsel von Galactose, Fructose und Mannose ................................................ 261
7.3 Gluconeogenese ....................................................................................................... 263
7.3.1 Definition der Gluconeogenese und ihre Bedeutung für den Organismus ............... 263
7.3.2 Überblick über die Gluconeogenese ......................................................................... 264
7.3.3 Wichtige Schritte der Gluconeogenese im Einzelnen ............................................... 266
7.3.4 Die Bilanz der Gluconeogenese ................................................................................ 268
7.3.5 Die Regulation der Gluconeogenese ......................................................................... 268
7.3.6 Cori-und Alanin-Zyklus ........................................................................................... 270
7.4 Die oxidative Decarboxylierung und ihre Coenzyme ........................................... 270
7.4.1 Definition und Lokalisation der oxidativen Decarboxy lierung ................................ 270
7.4.2 Die Coenzyme der oxidativen Decarboxylierung und ihre zugehörigen Vitamine .. 272
7.4.3 Die Enzyme der oxidativen Decarboxylierung ......................................................... 277
7.4.4 Die Regulation der oxidativen Decarboxylierung ..................................................... 278
7.5 Der Pentosephosphatweg ........................................................................................ 279
7.5.1 Definition und Bedeutung des Pentosephosphatweges ............................................. 279
7.5.2 Der Pentosephosphatweg im Überblick .................................................................... 279
7.6 Glykogenstoffwechsel ............................................................................................. 282
7.6.1 Bedeutung des Glykogens ......................................................................................... 282
7.6.2 Der Aufbau des Glykogens ....................................................................................... 283
7.6.3 Der Abbau des Glykogens ........................................................................................ 286
7.6.4 Die Regulation des Glykogenstoffwechsels .............................................................. 287
7.7 Die Synthese der Aminozucker .............................................................................. 289
7.8 Klinischer Bezug ..................................................................................................... 291
7.9 Kariogenese und die Anatomie des Zahnes ........................................................... 294
7.9.1 Der Aufbau des Zahnes ............................................................................................. 294
7.9.2 Kariogenese (U. Bockius) ......................................................................................... 296
8 Citratzyklus und Atmungskette ........................................... 298
8.1 Der Citratzyklus ...................................................................................................... 298
8.1.1 Bedeutung und Lokalisation des Citratzyklus' .......................................................... 298
8.1.2 Die Reaktionen des Citratzyklus' im Überblick ........................................................ 299
8.1.3 Die Schritte des Citratzyklus' im Einzelnen .............................................................. 301