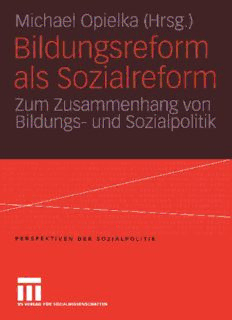Table Of ContentMichael Opielka (Hrsg.)
Bildungsreform als Sozialreform
Perspektiven der Sozialpolitik
Herausgegeben von
Michael Opielka
Michael Opielka (Hrsg.)
Bildungsreform
als Sozial reform
Zum zusammenhang von
Bildungs- und Sozialpolitik
I
VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
1. Auflage November 2005
Alle Rechte vorbehalten
© VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005
Der VS verlag für Sozialwissenschaften ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media.
www.vs-verlag.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung des verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere
für vervielfältigungen, übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspei
cherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg
ISBN 978-3-531-14853-3 ISBN 978-3-322-91642-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-91642-6
Inhalt
Einleitung 7
Michael Opielka
Bildung heute - Erfahrungen in Jena
Zur Aktualität des klassischen Bildungsbegriffs 11
Bir;git Sandkaulen
Bildungspolitik nach Pisa 23
Michael Winkler
Bildungs armut
Zum Zusammenhang von Sozialpolitik und Bildung 45
] utta Allmendinger und 5 tephan Leibjried
Soziale Benachteiligung im Bildungswesen
Die Reduktion von Ungleichheit als pädagogischer Auftrag 61
Wo!li!,ang Biittcher
Von Generation zu Generation?
Kleine Kinder und soziale Ungleichheit in Deutschland 77
Ursula Rabe-Kleber;g
6 Inhalt
Konturen einer neuen sozialen Bildungspraxis?
Bildung, Erziehung und Betreuung in der offenen
Ganztagsschule 89
Thomas Rauschenbach
Hochschul- und Arbeitsmarktpolitik -
Komplexe (In)Kompatibilitäten 113
Ger! G. Wagner
Bildungsreform und Sozialreform
Der Zusammenhang von Bildungs- und Sozialpolitik 127
Michael Opielka
Autorenverzeichnis 156
Einleitung
Michael Opielka
Der Zugang zu Bildungsressourcen wird in einer Wissens gesellschaft zur zentralen
Gerechtigkeitsfrage und folglich zum Gegenstand der Sozialpolitik, die in demokra
tischen Gesellschaften die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an allen Funkti
onssysternen der Gesellschaft garantiert. Diese systemfunktionale Überlegung hat
erstmals Talcott Parsons in den 1960er Jahren unter dem Begriff "Inklusion" for
muliert, Niklas Luhmann griff sie auf. Sie trifft analytisch nach wie vor zu. Dass wir
nicht in einer theoretischen, sondern zunächst in einer realen Welt leben, zeigt die
seit den durchaus spektakulären "PISA"-Resultaten unbestreitbare Tatsache, dass
der Zugang zu formaler Bildung insbesondere in Deutschland eben nicht allen
Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen offen steht. Ein Zuschlag der Bildungspo
litik zur Sozialpolitik, der im angelsächsischen Raum zumindest konzeptionell üb
lich ist, würde in Deutschland das Ungleichheits- und damit das Gerechtigkeits
problem nicht unbedingt lösen. Denn jenes Parsons-Luhmannsche Paradigma der
Inklusion Aller in alle Funktionssysteme einer demokratischen Gesellschaft kann
zumindest von der deutschen Sozialpolitik keineswegs als erfüllt gelten.
Derart skeptische Gedanken, die im vorliegenden Buch aus verschiedener Per
spektive dominieren, regten die Sozial- und die Erziehungswissenschaften schon
früh zu explizit politisch-reformerischen Überlegungen an. Die oder der Intellektu
elle benötigt zwar den kontemplativen Rückzug wie die methodisch akribische
Forschung zur Gewinnung neuer Einsichten. Doch ein Rückzug aus der Gesell
schaft ist für die Kulturwissenschaften nicht nur methodisch unmöglich - sie sind
stets ein Teil der Kraft, die sie erschafft -, er wird von einem beträchtlichen Teil
ihrer Angehörigen auch nicht gewollt. Trotz resignativer, melancholischer Anwand
lungen, die den Deutschen nicht ohne Anhaltspunkte als Kulturcharakter bisweilen
nachgesagt werden, mischten sich Sozial- und Erziehungswissenschaftler durchaus
in die Bildungsreformdebatten der letzten Jahrzehnte ein, ob nun in der Diskussion
um die Gesamt- und Ganztagsschule oder um das Recht auf Kindertagesstätten
plätze und die Pflicht zu Studiengebühren. Neu ist allerdings, dass sich die Sozialpo
litikwissenschaft systematischer mit bildungspolitischen Themen befasst. Dieses
Buch dokumentiert einen ersten Versuch, die neue Debatte um Bildungsreformen
als Sozialreformen zu dokumentieren und womöglich zu impulsieren.
Erleichtert wird dieser Versuch sicher dadurch, dass die prominentesten und
ausdrucksstärksten Vertreterinnen und Vertreter dieser Debatte hier versammelt
8 Michael Opielka
sind. Man mag einwenden, dass explizit an Bildungsungleichheit interessierte Kolle
ginnen und Kollegen nicht vorkommen. Da sich die Idee der Ungleichheit mit
Demokratie systematisch nicht verträgt - auch wenn dies von Seiten eines sozialphi
losophischen Konformismus bis heute bestritten wird -, kann die Einschränkung
zwar nicht wissenschaftlich, aber historisch wie ethisch gerechtfertigt werden. Diese
eher kryptischen Überlegungen ziehen sich natürlich nicht durch das ganze Buch.
Die Beiträge sind vielmehr von erfrischender Klarheit und verbinden analytische
Prägnanz mit reformerischer Reflexivität, bisweilen auch mit stilistischer Eleganz.
Es erscheint nicht erforderlich, die hier gesammelten Beiträge in dieser Einleitung
zusammen zu fassen oder gar zu kommentieren. Eine argumentative Linie kann
aber nachgezeichnet werden, ohne die für sich stehenden Texte zu verbiegen.
Der Beitrag von Birgit Sandkaulen konzentriert sich auf den Bildungsbegriff
selbst, auf die Idee einer "Bildung zur Freiheit", wie sie in den Jenaer Schlüsseljah
ren der Humboldtschen und damit zunächst spezifisch deutschen, unterdessen aber
weltweit reüssierenden Bildungskonzeption angelegt wurde. Dass dieses Bildungs
ideal gleichwohl gefährdet scheint, wird in ihrer Analyse nicht kulturpessimistisch
zur Verlustgeschichte vernebelt, sondern zur intellektuellen und demokratischen
Aufforderung: "Bildung, die auf Freiheit der Mitglieder einer Gesellschaft zielt,
kostet den Preis einer zumutbaren Anstrengung."
Dieser Anstrengung, so die engagierten und bisweilen zuspitzenden Überle
gungen von Michael Winkler, unterziehen sich die gesellschaftlichen Eliten "nach
PISA" derzeit nicht. Bildungspolitik erscheint in Deutschland zunehmend ein Feld
voluntaristischer Beliebigkeit. Das mag mit der Komplexität von Anforderungen
und institutionellen Mängeln zu tun haben. Betrüblich ist aber, dass die allenthalben
betriebene Modernisierung des Bildungswesens zu einer "Bildungspolitik als Aus
grenzung" mutiert, ohne Kenntnisnahme der Ungleichverteilung des kulturellen
Kapitals in der Gesellschaft. Seine Überlegungen haben einen pessimistischen Ton,
der freilich, indem er ausdrücklich wird, zugleich seine Transformation ermöglicht.
Das Problem der Ungleichheit wird in den beiden folgenden Beiträgen unter
soziologisch-sozialpolitischen und bildungsökonomischen Gesichtspunkten thema
tisiert. Jutta Allmendinger und Stephan Leibfried widmen sich der Bildungsarmut
als einem Schnittfeld von Bildungs- und Sozialpolitik. Hier treten neben diversen
Messproblemen auch erstmals systematische Fragen der Wohlfahrts regime auf. Ist
es doch bemerkenswert, wie unterschiedlich die Kompetenzverteilung in den inter
nationalen Bildungsvergleichsstudien auf die sozialpolitischen Regimeformen rea
giert. Bildungsarmut, so ihr Fazit, ist politisch verhinderbar - wenn es politisch
gewollt wird.
Wolfg ang Böttcher beleuchtet das Problem der Bildungsungleichheit aus der
Perspektive einer ökonomisch grundierten Bildungsforschung. Dabei zeichnet er
die Konjunkturen der Erklärung dieser Ungleichheit durch die letzten vier Jahr
zehnte nach. Trotz durchaus vorhandener, empirisch untermauerter Erkenntnisse
Einleitung 9
ist das Ausbleiben von Maßnahmen zur Reduktion von Chancenungleichheit er
schütternd und zugleich deutungsbedürftig. Die hohe soziale Selektion der deut
schen Schule, ein zentrales Resultat der PISA-Studien, hätte "eigentlich niemanden
überraschen dürfen". Dass es auch anders geht und was dafür künftig erforderlich
wäre, erläutert er an "Vier E" der Bildungsreform: Effektivität, Effizienz, Evidenz
und Erfolgsorientierung.
In den drei folgenden Beiträgen wird die biographische Trias des deutschen
Bildungswesens untersucht: Die Vorschulpädagogik (Rabe-Kleberg), das Schulsys
tem und sein Kontext (Rauschenbach) und die Hochschulen in ihrem Bezug zum
Arbeitsmarkt (Wagner). Alle drei Felder wurden in den letzten Jahren teils weit
reichenden Reformen unterzogen oder stehen davor.
Die vorschulische Erziehung wird von Ursula Rabe-Kleberg mit den neueren
Befunden der Kindheitsforschung verknüpft. Der "grundsätzlich positive Blick auf
Kinder als eigenständige und eigensinnige Wesen" darf freilich nicht den Blick
darauf trüben, dass gesellschaftliche Strukturen immer mehr an Ungleichheit gerade
auch für Kinder bedeuten. Kinder- und Jugendarmut erschwert für immer mehr
Heranwachsende den Einstieg in die geforderte Normalität. Die pädagogischen
Institutionen können dies freilich nur begrenzt kompensieren. Dass sie dies auch
noch unzureichend leisten, nicht nur, aber besonders auch für Kinder mit Migrati
onshintergrund, verweist auf institutionelle wie professionelle Mängel. Der Erzie
herberuf benötigt deshalb nicht nur einen "Zuwachs an inhaltlich-fachlichen Kom
petenzen", sondern weiters einen "Zuwachs an sozialpolitischer Potenz".
Thomas Rauschenbach knüpft mit seinem Beitrag an der noch vor wenigen
Jahren, zumindest in Westdeutschland, beinahe verteufelten Praxis der "offenen
Ganztagsschule" an, die neuerdings parteiübergreifenden Zuspruch zu genießen
scheint. Ausgehend von den modellhaften Erfahrungen vor allem in Nordrhein
Westfalen macht er aber deutlich, dass dieser "folgenreichste Eingriff in das System
Schule in der Geschichte der Bundesrepublik" doch noch erhebliche intellektuelle
und praktische Anstrengungen erfordert. Vor allem die Bildungsprozesse "vor und
neben der Schule" werden von den bisherigen Schul- und Unterrichtskonzepten
vernachlässigt. In einem breiten, zugleich pädagogischen, bildungs- wie sozialpoliti
schen Panorama zeigt er auf, was erforderlich ist und durchaus geleistet werden
könnte, wenn die Akteure, also Professionelle, Eltern und Politiker wollen.
Der Beitrag von Gert G. Wagner konzentriert sich auf die Reformbemühun
gen innerhalb der Hochschulpolitik, die einerseits die Autonomie der Hochschulen,
andererseits die Anforderungen eines im schnellen Wandel befindlichen Arbeits
marktes berücksichtigen müssen. Er offeriert ein breites Spektrum teils in der Dis
kussion bekannter, teils innovativer Vorschläge bis in die Organisation von For
schung und Lehre. Sein bildungsökonomischer Zugriff strukturiert die Reformim
pulse und bietet damit eine erfrischende Konsequenz, die natürlich nicht unumstrit-
Description:Die Bildungspolitik ist Bestandteil eines zeitgemäßen Konzeptes von Sozialpolitik. Was in der angloamerikanischen Welt seit langem wissenschaftlich geläufig ist, wird seit dem "PISA-Schock" auch in Deutschland unabweisbar. Kein anderes OECD-Mitgliedsland hat ein Bildungssystem, das soziale Unglei