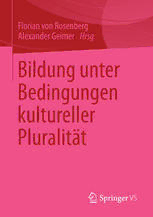Table Of ContentBildung unter Bedingungen kultureller
Pluralität
Florian von Rosenberg · Alexander Geimer
(Hrsg.)
Bildung unter
Bedingungen kultureller
Pluralität
Herausgeber
Florian von Rosenberg Alexander Geimer
Lehrstuhl für Allgemeine Fakultät Wirtschafts- und
Erziehungswissenschaft Sozialwissenschaften
Universität Erfurt Universität Hamburg
Erfurt Hamburg
Deutschland Deutschland
ISBN 978-3-531-18414-2 ISBN 978-3-531-19038-9 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-531-19038-9
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio-
nalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung,
die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die-
sem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass
solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu be-
trachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Lektorat: Stefanie Laux, Yvonne Homann
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe
Springer Science+Business Media
www.springer-vs.de
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Bildung unter Bedingungen kultureller Pluralität . . . . . . . . . . . 1
Alexander Geimer und Florian von Rosenberg
Zwischenraum: Kultur „Bildung“ aus kulturwissenschaftlicher Sicht . . . . . . 9
Christiane Thompson und Kerstin Jergus
Bildung und konjunktive Transaktionsräume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Arnd-Michael Nohl
Bildung unter den Bedingungen kultureller Pluralität.
Zur Darstellung von Bildungsprozessen in Wolfgang Herrndorfs
Roman „Tschick“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Hans-Christoph Koller
Das Bildungsreformprojekt von Mbouo, Kamerun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Rainer Kokemohr
Einer Praxis einen Sinn zu verleihen, heißt sie zu kontextualiseren.
Methodologie kulturwissenschaftlicher Bildungsforschung . . . . . . . . . . . . . 87
Susanne Gottuck und Paul Mecheril
Weder fremd noch integriert – kulturalisierungskritische Bildung
im Kontext von Migration und Globalisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Astrid Messerschmidt
Individualitätsperformanz. Bildungsbiographische
Anspruchsindividualitäten in sich wandelnden Kontexten . . . . . . . . . . . . . . 125
Jochen Kade und Sigrid Nolda
V
VI Inhaltsverzeichnis
Bildung als Randerscheinung? Zum Umgang mit Wissen
in Lebenswelten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Juliane Giese und Jürgen Wittpoth
Bildung unter Bedingungen kultureller Pluralität. Perspektiven einer
praxeologischen Bildungsforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Florian von Rosenberg
Zur Unwahrscheinlichkeit von Bildung: Potenzielle
Subjektivierungskrisen vor dem Hintergrund der Relation von
Habitus, Identität und diskursiven Subjektfiguren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Alexander Geimer
Autorenverzeichnis
JProf. Dr. Alexander Geimer Arbeitsbereich Soziologie, insb. Methoden qualita-
tiver Sozialforschung, Universität Hamburg.
Dr. Juliane Giese Institut für Erziehungswissenschaft Erwachsenenbildung
Weiterbildung, Ruhr-Universität Bochum.
Dipl. Päd. Susanne Gottuck AG 10 - Migrationspädagogik und Kulturarbeit,
Universität Bielefeld.
Dr. Kerstein Jergus Institut für Pädagogik, Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberge.
Prof. Dr. Jochen Kade Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung,
Goethe Universität Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Rainer Kokemohr Arbeitsbereich Bildungs- und Transformationsfor-
schung, Universität Hamburg.
Prof. Dr. Hans-Christoph Koller Arbeitsbereich Bildungs- und Transformations-
forschung, Universität Hamburg.
Prof. Dr. Astrit Messerschmidt Institut für Erziehungswissenschaft mit Schwer-
punkt in außerschulischen Feldern, PH Karlsruhe.
Prof. Dr. Arnd-Michael Nohl Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft,
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg.
Prof. Dr. Sigrid Nolda Institut für Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung &
Pädagogik der Kindheit, TU Dortmund.
JProf. Dr. Florian von Rosenberg Professur für Allgemeine Erziehungswissen-
schaft, Universität Erfurt.
VII
VIII Autorenverzeichnis
Prof. Dr. Christiane Thompson Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft,
Goethe-Universität Frankfurt/M.
Prof. Dr. Jürgen Wittpoth Institut für Erziehungswissenschaft Erwachsenenbil-
dung Weiterbildung, Ruhr-Universität Bochum.
Einleitung: Bildung unter
Bedingungen kultureller Pluralität
Alexander Geimer und Florian von Rosenberg
Wenn man davon ausgeht, dass gegenwärtig die „Pluralität kultureller Orientie-
rungen (…) als grundlegende Bedingung für die Lebensgeschichten aller Gesell-
schaftsmitglieder verstanden werden“ (Wulf 1998; Koller 2002a, S. 97) muss, dann
zeigt sich das Thema von Bildung unter Bedingungen kultureller Pluralität nicht
als Spezialthema einer Subdisziplin, sondern als ein sozial- und erziehungswissen-
schaftliches Schlüsselproblem. Daher rückt dieser Band den Zusammenhang von
unterschiedlichen Bildungs- und Kulturbegriffen und deren Rahmungen von Plu-
ralität in den Blick.
Sucht man zunächst nach den Bedeutungsursprüngen des Kulturbegriffs, stößt
man auf frühe und bis heute bestehende Verwendungen wie agriculture welche sich
noch auf den eingeschränkten Bereich des Ackerbaus und der Viehzucht beziehen.
Im 16. Jhd. ereignet sich ein einschneidender Bedeutungswandel, indem die Idee
der Kultivierung von Pflanzen und Tieren auf den Menschen übertragen wird (vgl.
Kramer 1997, S. 80 f.). Semantiken von Kultur werden zu Distinktionswerkzeugen,
denn nur bestimmten Akteuren oder Akteursgruppen wurde zugestanden als ent-
sprechend kultiviert zu gelten (vgl. Moebius 2010, S. 16). Die Einengung des Be-
griffs vollzog sich vor allem durch die Begrenzung von Kultur auf die Lebensweise
Für die Hilfe bei der Erstellung des Manuskriptes bedanken wir uns bei Jana Starkloff.
A. Geimer ()
Soziologie, insb. Methoden qualitativer Sozialforschung, Universität Hamburg,
Allende-Platz 1, 20146 Hamburg, Deutschland
E-Mail: [email protected]
F. von Rosenberg
Allgemeine Erziehungswissenschaft, Universität Erfurt, Nordhäuser Straße 63,
99089 Erfurt, Deutschland
E-Mail: [email protected]
F. von Rosenberg, A. Geimer (Hrsg.), Bildung unter Bedingungen kultureller Pluralität, 1
DOI 10.1007/978-3-531-19038-9_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
2 A. Geimer und F. von Rosenberg
der Mitglieder der sozialen Eliten, die Kunst produzierten und rezipierten. Kultur
wird so zu einem „state or process of human perfection“ (Williams 2001[1961],
S. 57) und dient der Veredelung des Menschen; entsprechend finden wir noch heu-
te die Konnotation von Kulturprogramm als Kunstprogramm in Zeitschriften und
Zeitungen, womit Sparten wie Theater, Kino, Museen usw. gefasst sind. Unter ande-
rem durch den Rückgriff auf Herder wurden wertende Differenzierungen in einem
anthropologischen Kulturbegriff zurückgenommen, der nur im Plural zu denken
ist (vgl. Kramer 1997, S. 50). Kultur bezieht sich demnach auf die symbolischen wie
materiellen Grundlagen der Lebensweise sozialer Gruppen: „Im weiteren Gefolge
Herders verliert der Kulturbegriff seine wertende, universalistische Orientierung
und wird historisiert: Kultur ist keine ausgezeichnete Lebensform mehr, sondern
die spezifische Lebensform eines Kollektivs in einer historischen Epoche“ (Reck-
witz 2008, S. 72).
Infolge der Entnormativierung des Kulturbegriffs können alle sozialen Einhei-
ten prinzipiell auf ihre Kultur hin analysiert werden und es ist heute etwa die Rede
von Alltags-, Schul-, Lern-, Organisations- und Populärkultur(en)“, welche die
Perspektive der Sozial-, Kultur- und Erziehungswissenschaften teilweise erheblich
transformiert. Kultur ist als grundlegendes System der Repräsentation (vgl. Hall
1996, 2009) so gewendet kein (Sub)System der Gesellschaft (etwa im Sinne von
Parsons), in dem motivationale Antriebsstrukturen über Erziehungs- und Soziali-
sationsprozesse in Subjekten ausgebildet werden, sondern Kultur ist umfassend und
allgegenwärtig; entsprechend fasst Hall unter Kultur sämtliche „systems or codes of
meaning“ (Hall 1997, S. 209). Diese Sinnuniversen erlauben uns „to interpret mea-
ningfully the actions of others. Taken together they constitute our ‚cultures‘. They
help to ensure […] that all social practices express or communicate meaning and,
in that sense, are ‚signifying practices‘“ (ebd.). In jüngster Zeit hat insbesondere die
Auffassung von Kultur als Praxis (Bourdieu 1979; Taylor 1985; Knorr-Cetina 2002;
Schatzki 1996; Reckwitz 2000) eine weite Verbreitung gefunden. Praxistheoreti-
sche Ansätze verstehen Kultur als Tun bzw. „Doing Culture“ (Hörning und Reuter
2004), wobei Kontexte und Ressourcen dieses Tuns verschieden gefasst werden;
insbesondere hinsichtlich der Kopplung makrosozialer (etwa diskursiver, institu-
tioneller, normativer, historischer) Strukturen an mikrosoziale Prozesse der Praxis
und lokal-situativen Hervorbringung, Anwendung, Übersetzung oder Enaktierung
kultureller und kollektiver Ordnungen. Entsprechend vielfältig sind auch die Posi-
tionen in diesem Band, welche Kultur auf unterschiedlichen Ebenen fassen und die
unterschiedliche erziehungs- und bildungswissenschaftliche Debatten zum Anlass
nehmen, Bildung unter Bedingungen kultureller Pluralität zu denken.
Innerhalb eines erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Diskussionszu-
sammenhanges, der sich damals – und teilweise heute noch – als „interkulturell“