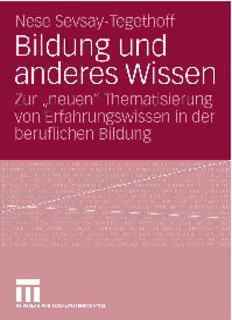Table Of ContentNese Sevsay-Tegethoff
Bildung und anderes Wissen
Nese Sevsay-Tegethoff
Bildung und
anderes Wissen
Zur „neuen“ Thematisierung
von Erfahrungswissen in der
beruflichen Bildung
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
1.Auflage Januar 2007
Alle Rechte vorbehalten
©VSVerlag für Sozialwissenschaften | GWVFachverlage GmbH,Wiesbaden 2007
Lektorat:Monika Mülhausen / Tanja Köhler
Der VS Verlag für Sozialwissenschaften ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media.
www.vs-verlag.de
Das Werkeinschließlichallerseiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohneZustimmungdes Verlags unzulässig und strafbar.Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen,Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspei-
cherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen,Handelsnamen,Warenbezeichnungen usw.in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung:KünkelLopka Medienentwicklung,Heidelberg
Druck und buchbinderische Verarbeitung:Krips b.v.,Meppel
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in the Netherlands
ISBN 978-3-531-15371-1
Meinen Eltern Özkan und Nihal Sevsay
Danksagung
Das vorliegende Buch bzw. die Dissertation ist im wesentlichen ein Ergebnis
meiner Mitarbeit in den Forschungsprojekten SFB 536 „Reflexive Modernisie-
rung“; Teilprojekt A3 und „NAKIF – Neue Anforderungen an Kompetenzen
erfahrungsgeleiteten Arbeitens und selbstgesteuerten Lernens bei industriellen
Fachkräften“* (BMBF FKZ 02PP4201).
Viele Menschen haben mich außerdem auf dem Weg zu dieser Arbeit be-
gleitet. Ihnen allen zu danken ist kaum möglich, wenngleich sie alle auf ihre Art
wichtig für mein Tun waren. Einige aber mögen für all diejenigen stehen, denen
ich für ihre Unterstützung und Zuwendung während des Schreibens dieser Arbeit
danke:
Mein besonders herzlicher Dank gilt meinem Erstgutachter und Teamkolle-
gen Prof. Dr. Fritz Böhle. Bedanken möchte ich mich auch bei meinem Zweit-
gutachter, Herrn apl. Prof. Dr. Dr. Ain Kompa, der den Boden für mein Interesse
an dieser Thematik mit bereitet hat.
Auch wäre die Abschlussphase dieser Arbeit so nicht möglich gewesen oh-
ne die Förderung aus dem Hochschul- und Wissenschaftsprogramm „Chancen-
gleichheit für Frauen in Forschung und Lehre“, die mir durch ein Stipendium
materielle und zeitliche Freiräume ermöglicht hat, um sowohl dieser Arbeit als
auch der Betreuung unserer Tochter gerecht zu werden. Mein Dank gilt hier
stellvertretend der Frauenbeauftragten der Universität Augsburg, Frau Prof. Dr.
Hildegard Macha, und dem Frauenbüro, vertreten durch Frau Marion Magg-
Schwarzbäcker.
Meinen Kolleginnen und Kollegen an der Universität Augsburg sowie am
ISF München danke ich für ihre Unterstützung und ihr Einspringen, wann immer
es notwendig war! Danke auch an Karla Kempgens, Frank Seiß und Lutz Te-
gethoff für ihre Hilfestellungen.
Meinem Mann Christoph und meiner Tochter Selin Leyla gebührt besonde-
rer Dank für ihr Verständnis und ihre Liebe. Ebenso will ich die Zuwendungen
meines Freundeskreises und meiner großen Familie – insbesondere meiner Brü-
der – während des Schreibprozesses nicht missen.
Schließlich möchte ich in ganz besonderer Weise meinen Eltern, Özkan und
Nihal Sevsay, danken. Habt Dank für euer Vertrauen in mich, eure liebevolle
* NAKIF wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
innerhalb des Rahmenkonzepts „Forschung für die Produktion von morgen“ gefördert und vom
Projektträger Produktion und Fertigungstechnologien (PFT), Forschungszentrum Karlsruhe,
betreut.
7
und unschätzbare Unterstützung durch das Offenhalten von Türen und Toren, die
es mir ermöglicht haben, meinen eigenen Weg zwischen zwei Kulturen finden
und gehen zu dürfen!
Augsburg, im August 2006 Ne(cid:250)e Sevsay-Tegethoff
8
Inhalt
I Die gesellschaftliche Wiederentdeckung von Erfahrungswissen............15
1 Erfahrungswissen – ein schillernder Begriff.......................................16
2 Diskriminierung und (Wieder-)Entdeckung von Erfahrungswissen
in der beruflichen Bildung..................................................................20
3 Aufbau und Vorgehen.........................................................................24
II Erfahrungswissen: Geschichte, Begriffsbestimmung und
Bezugsrahmen der Untersuchung...........................................................25
1 Erfahrung(-swissen) in der philosophischen Tradition.......................27
1.1 Sokrates und das Wissen im Handeln.............................................27
1.2 Jean-Jacques Rousseau und die „Entfremdung durch
Erfahrung“......................................................................................28
1.3 John Locke: Erfahrungsschatz als Basis für Denken und
Handeln...........................................................................................29
1.4 John Dewey: Erfahrung als Medium gemeinsamen Tuns...............30
2 Neuere Auseinandersetzungen mit dem Verhältnis von Erfahrung,
Wissen und Handeln...........................................................................35
2.1 Gilbert Ryle: Können und Wissen, „knowing how“ und
„knowing that“................................................................................35
2.2 Dreyfus/Dreyfus: Erfahrungswissen und intelligentes Handeln.....38
2.3 M. Polanyis „tacit knowing”...........................................................40
2.4 Erfahrungswissen in der Berufsbildung: Arbeitsprozesswissen
bei Fischer et al...............................................................................43
2.5 Erfahrungswissen und subjektivierendes Arbeitshandeln (Böhle
et al.)...............................................................................................52
3 Ein erstes Fazit....................................................................................55
4 Das subjektivierende Erfahrungswissen – Eine ‚andere’‚
konzeptuelle Perspektive als Ausgangspunkt.....................................57
9
4.1 Die Unterscheidung traditionelles vs. modernes Verständnis
von Erfahrungswissen....................................................................58
4.2 Objektivierendes und subjektivierendes Arbeitshandeln................61
4.3 Erfahrungswissen im Kontext objektivierenden Handelns.............65
4.4 Erfahrungswissen im Kontext subjektivierenden Handelns............66
III Neue Impulse aus dem Bereich der beruflichen Bildung........................73
1 Erfahrungswissen und das Lernen im Prozess der Arbeit...................75
1.1 Entstehungs- und Verwertungszusammenhänge des Konzeptes
„Lernen im Prozess der Arbeit“ und die neue Berücksichtigung
von Erfahrungswissen....................................................................76
1.2 Erfahrungswissen und informelles Lernen......................................84
2 Formen und Konzepte des Lernens im Prozess der Arbeit.................96
2.1 Dezentrale Lernformen...................................................................98
2.2 Lernförderliche Arbeitsgestaltung................................................112
2.3 Arbeitsprozesswissen....................................................................119
2.4 Erfahrungsgeleites Arbeiten und Lernen......................................122
2.5 Erfahrungswissen im Prozess der Arbeit – ein Fazit.....................133
3 Subjektivierendes Erfahrungswissen und Kompetenzdiskussion.....140
3.1 Entstehungs- und Verwertungszusammenhänge der
Kompetenzdebatte im Hinblick auf subjektivierendes
Erfahrungswissen: Von den Themen „Lernen“,
„Qualifizierung“ und „Schlüsselqualifikation“ zum
Kompetenzbegriff.........................................................................142
3.2 Der Begriff der Kompetenz: „Mehr als Fachwissen“ und
zunehmende Subjektzentrierung...................................................151
3.3 Das Interesse an Gefühl und Gespür als
Entscheidungskompetenz im Zuge der Kompetenzdiskussion.....157
3.4 Erfahrungswissen in der betriebswirtschaftlichen
Kompetenzforschung....................................................................166
3.5 Exkurs: Kompetenzen, Erfahrungswissen und die verborgene
Seite weiblichen Arbeitsvermögens.............................................172
3.6 Erfahrungswissen in der Kompetenzdiskussion – Ein Resümee...186
10
3.7 Verwissenschaftlichung und Erfahrungswissen: Entgrenzung
und neue Grenzziehungen….........................................................192
IV Subjektivierendes Erfahrungswissen: „praktisch nützlich jedoch
schwer akzeptierbar!“...........................................................................195
1 Fragestellungen und Untersuchungsfeld...........................................196
1.1 Merkmale der Betriebe.................................................................196
1.2 Skizzierung der Fallunternehmen und des
Untersuchungssamples..................................................................199
1.3 Übersicht.......................................................................................203
2 Subjektivierendes Erfahrungswissen: Im Spannungsfeld zwischen
persönlicher Wertschätzung und organisatorischer Verdrängung –
Erkenntnisse und Ergebnisse............................................................205
2.1 Persönliche Beurteilung von Erfahrungswissen............................208
2.2 Persönliche Einschätzung der Funktionalität von
Erfahrungswissen..........................................................................211
3 Erfahrungswissen in der Organisation..............................................214
3.1 Erwerb von Erfahrungswissen in der Organisation.......................214
3.2 Hemmnisse für die weitreichende Akzeptanz von
Erfahrungswissen..........................................................................224
4 Misstrauen und ambivalente Anerkennung: Zusammenfassende
Ergebnisse der empirischen Untersuchung.......................................232
V „Schwarz kann doch nicht weiß sein“ – Zur Erfassung der
Widersprüchlichkeiten um das subjektivierende Erfahrungswissen.....239
VI Literatur................................................................................................243
11