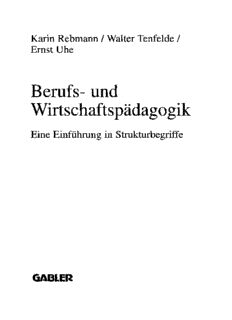Table Of ContentKarin Rebmann / Walter Tenfelde /
Ernst Uhe
Berufs- und
Wirtschaftspädagogik
Eine Einführung in Strukturbegriffe
GABLER
Dr. Karin Rebmann ist wissenschaftliche Assistentin am Institut für Berufs-und Wirtschaftspäda
gogik der Universität Hamburg.
Professor Dr. WaIter Tenfelde ist Professor am Institut für Berufs-und Wirtschaftspädagogik der
Universität Hamburg.
Professor Dr. Ernst Uhe ist Professor am Institut für berufliche Bildung, Hochschulbildung und
Weiterbildungsforschung der Technischen Universität Berlin.
Die Deutsche Bibliothek -CIP-Einheitsaufnahme
Rebmann, Karin:
Berufs-und Wirtschaftspädagogik : eine Einführung in Strukturbegriffe
/ Karin Rebann ; Walter Tenfelde ; Ernst Uhe. -Wiesbaden: Gabler, 1998
ISBN 978-3-409-12302-0 ISBN 978-3-322-91241-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-91241-1
Alle Rechte vorbehalten
© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden, 1998
Lektorat: Ralf Wettlaufer
Der Gabler Verlag ist ein Unternehmen der Bertelsmann Fachinformation GmbH.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtIich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeiche
rung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
http://www.gabler-online.de
Höchste inhaltliche und technische Qualität unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der Produktion und
Auslieferung unserer Bücher wollen wir die Umwelt schonen: Dieses Buch ist auf säurefreiem und
chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne
der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von
jedermann benutzt werden dürften.
ISBN 978-3-409-12302-0
Vorwort
Für Erstsemester ist es erfahrungsgemäß eine große Hilfe, wenn ihnen Teilgebiete ihres
Studiums in knapper, leicht verständlicher und systematischer Form dargeboten werden.
Gleichzeitig müssen sie aber auch sicher sein können, daß alle relevanten Studieninhalte auch
tatsächlich in die ihnen angebotene Systematik eingearbeitet wurden. Unter diesen beiden
Aspekten sollte die Qualität von Studienbüchern für Studienanfänger beurteilt werden.
Die Vorarbeiten zum vorliegenden Studienbuch reichen bis in die 1980er Jahre zurück.
Nachdem die Gewerbe- und Handelslehrerausbildung an der Universität Hamburg im Jahre
1982 über eine Prüfungsordnung im Studiengang "Lehramt Oberstufe-Berufliche Schu1en"
zusammengeführt worden war, mußten auf diesen Studiengang abgestimmte Lehrveranstal
tungen entwickelt werden. Eine Schlüsselstellung im Lehrangebot sollte eine gemeinsame
Einführungsvorlesung einnehmen, in der auch zwei bisher getrennte wissenschaftliche Dis
ziplinen mit unterschiedlichen Selbstverständnissen, Erkenntnisinteressen, Zielsetzungen und
pragmatischen Ansprüchen zusammenzuführen waren. Insofern konnte nur auf Vorleistun
gen der Berufspädagogik zurückgegriffen werden, als sich diese mit den Fragen auseinander
setzte:
1. Welche spezifISchen Probleme, aber auch Chancen ergeben sich durch den Einfluß des
Berufs auf die Erziehung?
2. Wie ist auf den Beruf hin mit dem Ziel der beruflichen Tüchtigkeit zu erziehen bzw. aus-
zubilden?
Allerdings sind unter berufspädagogischen Systematikern nicht diejenigen einzureihen, mit
denen die Reflexion über Berufserziehung begann. Die von Georg Kerschensteiner begonne
ne und von Eduard Spranger, Aloys Fischer, Theodor Litt u. a. fortgeführte sogenannte
klassische Berufsbildungstheorie konnte nicht unter einem systematischen Anspruch entwik
kelt werden. Sie ging statt dessen von der Teilfrage aus, wie der Beruf bildend auf den Men
schen wirkt oder wirken kann.
Es war wohl das Verdienst von Friedrich Schlieper, eine Systematisierung des Gegenstand
bereichs mit seiner Veröffentlichung "Allgemeine Berufspädagogik" (1963) vorgelegt zu
haben. Dies blieb längere Zeit der einzige Versuch. Denn erst in den 1970er Jahren erschie
nen in kurzen Abständen Einführungsschriften mit teilweise sehr unterschiedlich akzentuier
ten Sichtweisen auf Berufs- oder Wirtschaftspädagogik. Sie konnten die jeweiligen Diszipli
nen zwar voranbringen, haben sie aber auch voneinander abgegrenzt
v
Die Entwicklung einführender Vorlesungen für Berufs- und Wirtschafts pädagogen an der
Universität Harnburg war deshalb auf den Versuch einer Neustrukturierung der Berufs- und
Wirtschaftpädagogik angewiesen. Diesen Versuch unternahmen zunächst die beiden Senior
autoren Walter Tenfelde und Ernst Uhe mit Vorlesungen zur Einführung in die Berufs- und
Wirtschaftspädagogik, die bezeichnenderweise unter dem Titel"Strukturbegriffe der Berufs
und Wirtschaftspädagogik" angeboten wurden. Daraus wurde dann das Strukturmodell der
Berufs-und Wirtschaftspädagogik, das auch der vorliegenden Buchveröffentlichung zugrun
de liegt. Entscheidend für die Veröffentlichung der Einführungsschrift auf der Basis von
Strukturbegriffen war jedoch die Unterstützung des Vorhabens durch die Juniorautorin Ka
rin Rebmann, die Strukturbegriffe bearbeitete, die Entwicklung des Strukturmodells voran
brachte und die einzelnen Themen in ihrer Einführungsvorlesung auf den Prüfstand einer
Vermittlung an Erstsemester stellte.
Gleichwohl bedarf auch die vorliegende Einführung in die Berufs- und Wirtschaftspädagogik
der weiteren Systematisierung und Bearbeitung einzelner Aussagenbereiche. Dieser Heraus
forderung werden sich Autorin und Autoren gerne stellen, wenn vor allem Studierende des
Gewerbe- und Handelslehrarnts wie bisher die Strukturbegriffe der Berufs- und Wirtschafts
pädagogik mit ihren kritischen Rückmeldungen nachhaltig beeinflussen.
VI
Inhaltsverzeichnis
Einleitung. ........................................................................................................................ 1
Rahmenbedingungen (R) ................................................................................................ 5
1 Rechtlich-institutionelle Grundlagen der Berufsbildung .................................................. 5
2 Finanzierung .................................. '" ........................................................................... 11
3 Kosten und Nutzen ...................................................................................................... 14
4 Qualifizierungsvoraussetzung und Qualiftkationsverwertung ........................................ 17
5 Berufliche Weiterbildung ............................................................................................. 21
6 Internationalisierung ............................ '" ........... '" ....................................................... 25
literatur ................................ '" ....................................................................................... 31
Berufsbildungspolitik (B) .•••••.••.••••••••••.••••••••••.••.••....••••.•.••••...•••••.••••..•••••••••••.••••••••••••••• 33
1 Institutionen, Organisationen und Konfliktlinien .......................................................... 33
2 Bundesinstitut für Berufsbildung .................................................................................. 37
3 Abstimmung und Koordination .................................................................................... 40
4 Berufsbildungsforschung ............................................................................................. 43
5 Bildungspolitische Streitfälle ....................................................................................... 45
6 Berufsbildungspolitik in komplexen Gesellschaften ...................................................... 48
literatur .......................................................................................................................... 51
Beruf, Wirtschaft, Pädagogik (BWP) ........................................................................... 53
1 Systemzusammenhänge ............................................................................................... 53
2 Beruf: Zwischen Individualisierung und sozialer Integration ......................................... 60
3 Wirtschaft: Ökonomie und Politik beruflicher Bildung ................................................. 68
4 Pädagogik: Bildung und Beruf. .................................................................................... 74
5 Systemische Innovationsleistungen .............................................................................. 78
literatur .......................................................................................................................... 82
VII
Zielsetzungen (Z) ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••..•.••.••.•••••..•..•••••.•..•..•..••...••..••..•••...•••••.••••••••• 85
1 Problematik wissenschaftlicher Zielsetzungen .............................................................. 85
2 Funktionalität und berufliche Tüchtigkeit. .................................................................... 88
3 Vergesellschaftung und soziale Integration .................................................................. 90
4 Subjektivität und Persönlichkeitsentwicklung ............................................................... 92
5 Berufliche Handlungsfähigkeit ..................................................................................... 94
Literatur .......................................................................................................................... 99
Lernort Schule (LS) ..••••.•••..•••.•..•••.••••••.••••..•••..•.••...••••••..•.••..•..........•...•...•....•••••...•...••• 101
1 Berufliches Schulwesen ............................................................................................. 101
2 Berufsschule .............................................................................................................. 107
3 Merkmale schulischen Lernens .................................................................................. 114
4 Konzepte schulischen Lernens ................................................................................... 116
5 Schule und Wirtschaft ............................................................................................... 122
6 In der Diskussion: Doppelqualiftkation ...................................................................... 125
Literatur ........................................................................................................................ 128
Lernort Betrieb (LB) ................................................................................................... 131
1 Betriebliche Lernorte ................................................................................................. 131
2 Lernort "Betriebe der Wirtschaft" .............................................................................. 134
3 Merkmale betrieblichen Lernens ................................................................................ 138
4 Konzepte betrieblichen Lernens ................................................................................. 139
5 Betrieb und Gesellschaft ............................................................................................ 144
6 Arbeiten und Lernen .................................................................................................. 146
Literatur ........................................................................................................................ 151
Didaktik beruflichen Lernens und Lehrens (D) ......................................................... 153
1 Didaktik -Fachdidaktik ............................................................................................. 153
2 Didaktik beruflicher Bildung ...................................................................................... 157
3 Didaktik beruflichen Lernens und Lehrens auf der Grundlage
großer didaktischer Positionen. .... ............ .................. ................................................ 161
4 Didaktik beruflichen Lernens und Lehrens auf der Grundlage
von neuen Leitideen, Ansätzen und Entwürfen ........................................................... 169
5 Berufsschuldidaktik für Lernschwache und Begabte .................................................. 174
Literatur ........................................................................................................................ 179
VIII
Ausbildung der Lehrer und der Ausbilder (LA) ........................................................ 183
1 Lehrer: Fachmann und Pädagoge ............................................................................... 183
2 Professionalisierung der Lehrerausbildung ................................................................. 186
3 Theorie-Praxis-Problem ............................................................................................. 189
4 Betriebliches Ausbildungspersonal ............................................................................. 193
5 Kooperative Selbstqualifizierung ............................. .................................................. 197
Literatur ........................................................................................................................ 202
Perspektiven (P) .......................................................................................••..............•..• 205
1 Perspektiven eines Strukturmodells der Berufs-und
Wirtschaftspädagogik ................................................................................................ 205
2 Modularisierung ........................................................................................................ 208
3 Autonomiebestrebungen ............................................................................................ 211
4 Zielsetzung: Berufliche Handlungsfähigkeit ............................................................... 213
5 Systemische Sichtweise ............................................................................................. 216
6 Entwicklung kognitiver Ansätze in der Didaktik ........................................................ 219
7 Schule als Lern- und Lebensraum .............................................................................. 221
8 Ausbildung erhalten und ausbauen ............................................................................. 224
9 Moderatorenausbildung ............................................................................................. 226
Literatur ........................................................................................................................ 228
Einzelne Strukturbegriffe wurden verlaßt von
Karin Rebmann: -Rahmenbedingungen
-Lernort Schule
-Didaktik beruflichen Lemens und Lehrens
Walter Tenfelde: -Beruf, Wirtschaft, Pädagogik
Ernst Uhe: -Berufsbildungspolitik
IX
Einleitung
Das Erscheinen neuer Bücher wird zumeist damit begründet, daß Entwicklungen in bestimm
ten Bereichen vorangeschritten sind und es nunmehr höchste Zeit wird, diese Entwicklungen
beschreibend, analysierend und reflektierend einzuholen. Sicherlich trifft dies auch für die
Berufs- und Wirtschaftspädagogik zu, bedenkt man die schnell voranschreitenden Verände
rungen von Produktions-, Arbeits- und Organisationsstrukturen. Eine Begründung des vor
liegenden Buches wäre deshalb auch unter diesem Aspekt sinnvoll und möglich, zumal die
derzeitigen Einführungen zumeist älteren Datums sind.
Die vorliegende Einführung in die Berufs- und Wirtschaftsplidagogik verfolgt jedoch noch
ein weiteres Ziel: die Entwicklung einer Berufs- und Wirtschaftspädagogik, in der beide
Teildisziplinen stärker als bisher aufeinander bezogen werden können. Dies könnte einerseits
neue wissenschaftliche Fragestellungen befördern helfen, scheint aber andererseits auch not
wendig, um die Praxis mitgestalten zu können. Beispielhaft seien genannt die Annäherung
und Verschränkung gewerblich-technischer mit kaufmännisch-verwaltender Ausbildung in
Handwerk und Industrie. Neue wissenschaftliche Fragestellungen ergeben sich auch mit der
Annäherung der Lemorte über gemeinsam verfolgte Ziele, Konzepte und Programmatiken,
die gegenseitiges Orientieren auf gemeinsames Handeln im Feld der beruflichen Bildung er
leichtern.
Schließlich sollte auch die Institutionalisierung der beiden Disziplinen Berufs- und Wirt
schaftspädagogik an Universitäten mit der Verpflichtung auf eine gemeinsame Lehrerausbil
dung und mit den Optionen für die Erschließung auch außerschulischer Tätigkeitsfelder er
wähnt werden.
Diese Einführung in die Berufs-und Wirtschaftspädagogik richtet sich an Leser und Leserin
nen, die sich erstmals mit der Berufs- und Wirtschaftspädagogik befassen und daflir einen
Überblick bekommen wollen. Das Buch richtet sich aber auch an diejenigen, die Erfahrungen
im Feld der beruflichen Bildung haben, sich schon mit einzelnen Gebieten, Fragen und Pro
blemstellungen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik auseinandergesetzt haben und diese
mit anderen zu einer Systematik zusammenführen möchten. Unsere Adressaten sind also
Studierende der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Lehrende an beruflichen Schulen, Aus
und Weiterbildende in Betrieben, Fach-und Seminarleiter und -leiterinnen in Studiensemina
ren, aber auch Dozenten und Dozentinnen.
2 Einleitung
Das Buch ist sprachlich einfach gestaltet worden. Es soll auch denen Mut machen, sich mit
Berufs- und Wirtschaftspädagogik zu beschäftigen, die mit ihren bisherigen Annäherungen
an den wissenschaftlichen Diskurs steckengeblieben sind. Auf Formalisierungen wurde des
halb ganz, auf die Präsentation von Datenmaterial in Form von Statistiken großenteils ver
zichtet. Statt dessen sollen Beispiele und Schaubilder den Zugang zu berufs- und wirt
schaftspädagogischen Sichtweisen, Analysen und Erkenntnissen erleichtern.
Dem Buch liegt die Idee zugrunde, diese Annäherung durch Strukturbegriffe zu erleichtern.
Strukturbegriffe vermitteln einen Überblick über ausgewählte Teilgebiete der Berufs- und
Wirtschaftspädagogik, die jedoch den Gegenstandsbereich weitgehend abdecken. Die
Strukturbegriffe sind zwei Ebenen zuzuordnen: Auf der ersten Ebene befmden sich Begriffe,
die sich auf "Objekte" der Berufs- und Wirtschaftspädagogik beziehen, auf der zweiten Ebe
ne befmdet sich das "wissenschaftliche Selbstverständnis", mit dem Fragen einer Theorie der
Wissenschaft sowie Methodenfragen aufgegriffen werden. Letztere haben wir jedoch aus
didaktischen Überlegungen in die "Objektbegriffe" eingearbeitet. Im Abschnitt "Per
spektiven" werden sie wieder hervorgehoben und zur Diskussion gestellt.
Wie soll dieses Buch nun gelesen werden? Sicherlich kann es wie ein Buch von Anfang bis
zum Ende auf einer "Einbahnstraße" gelesen werden. Es läßt sich aber auch im freien Navi
gieren über die Strukturbegriffe und deren Module lesen. Für dieses freie Navigieren über
"Kreuzungen mit Ringverkehr" wurden in die Texte zahlreiche Hinweise für Verknüpfungs
möglichkeiten eingearbeitet. Diese machen einzelne Wiederholungen unumgänglich. Es wur
de jedoch darauf geachtet, daß Sachverhalte nur einmal vertiefend behandelt und an anderen
Stellen im Überblick und komprimiert vorgestellt werden.
Wer sich beispielsweise einen Überblick über die Lernorte der beruflichen Bildung verschaf
fen will, wird auf die Strukturbegriffe "Lernort Betrieb" und "Lernort Schule" verwiesen.
Ein analoger Aufbau der Gliederung dieser Strukturbegriffe erleichtert den Vergleich. Da
nach können dann weitere Strukturbegriffe zur Vertiefung herangezogen werden, beispiels
weise "Didaktik beruflichen Lehrens und Lernens" und/oder "Rahmenbedingungen berufli
cher Bildung".
Eine Verknüpfung ist aber auch auf der zweiten Ebene der Module möglich. Wer mit einer
spezifischen Fragestellung beginnt, z. B. mit Konfliktfeldern in der beruflichen Bildung,
sucht die Module "Schule und Wirtschaft" und "Betrieb und Gesellschaft" auf und erhält
über das Modul "Systemzusarnmenhänge" eine theoriegeleitete Interpretation. In diesen Mo
dulen wird der Leser wiederholt auf den Strukturbegriff "Zielsetzungen beruflicher Bildung"
verwiesen. Sofern das Interesse geweckt wird, mehr über mögliche Annäherungen von Ziel-
Einleitung 3
vorstellungen in den Konfliktfeldern zu erfahren, können weitere Module herangezogen
werden.
Autorin und Autoren des Buches können solche Verknüpfungen durch Hinweise jedoch nur
anregen. In jedem Fall stellen sie einen sehr persönlichen kreativen Akt des Lernenden dar,
in dem dieser sein Wissen in einem eigenen operativen Schema entwickelt. Dieses im ver
netzten Denken erworbene Wissen zu befördern und selbstorganisiertes Lernen in der sinn
gebenden Verknüpfung von Informationsangeboten zu wagen, ist der Verfasserin und den
Verfassern des Buches ein besonderes Anliegen. Ob uns dieses gelungen ist, können wir
nicht allein beurteilen. Über kritische (aber auch ermunternde) Rückmeldungen würden wir
uns deshalb freuen.
Description:BuchhandelstextDas Lehrbuch tr?gt dazu bei, die beiden Teildisziplinen Berufsp?dagogik und Wirtschaftsp?dagogik st?rker als bisher aufeinander zu beziehen. Daf?r wurde ein Theorienmodell mit Hilfe von Strukturbegriffen der Berufs- und Wirtschaftsp?dagogik entworfen. Querverweise gestatten ein freies