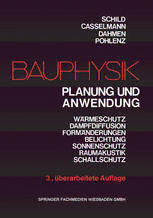Table Of ContentSchild/Casselmann/Dahmen/Pohlenz BAUPHYSIK · PLANUNG UND ANWENDUNG
BAUPHYSIK
PLANUNG UND ANWENDUNG
von
Prof. Dr.-lng. Erich Schild
Dipl.-lng. H.-F. Casselmann
Dip I. -lng. Günter Dahmen
Dipl.-lng. Rainer Pohlenz
3., überarbeitete Auflage
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Cl P-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibi iothek
Bauphysik: Planung u. Anwendung/von Erich
Schild ... - 3., überarb. Aufl.
ISBN 978-3-258-28662-4 ISBN 978-3-322-93778-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-93778-0
NE: Schild, Erich [Mitverf.]
1 . Auflage 1977
2., du rehgesehene Auflage 1979
3., überarbeitete Auflage 1982
©Springer Fachmedien Wiesbaden 1982
Ursprünglich erschienen bei Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig 1982
Alle Rechte vorbehalten
Die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder, auch
für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, gestattet das Urheberrecht nur, wenn sie mit dem Verlag
vorher vereinbart wurden. Im Einzelfall muß über die Zahlung einer Gebühr für die Nutzung
fremden geistigen Eigentums entschieden werden. Das gilt für die Vervielfältigung durch alle
Verfahren einschließlich Speicherung und jede Übertragung auf Papier, Transparente, Filme,
Bänder, Platten und andere Medien.
V
Inhalt
Bauphysik -Planung und Anwendung Konstruktions-und Planungshinweise
zur 3., überarbeiteten Auflage 1 Vermeidung von Oberflächentauwasser 31
2 Vermeidung von Tauwasser im Bauteilquerschnitt
Motivation zur Erstellung des Buches
2.1 Allgemeines 31
Inhalt und Zweck des Buches
2.2 Wände 31
Auswah I des Stoffes 1
2.3 Das einschalige nichtbelüftete Dach(Warmdach) 32
Stellenwert der Bauphysik 2
2.4 Das zweischal ige belüftete Dach ( Kaltdach) 34
Bau physikalische Berechnungen 2
2.5 Das Umkehrdach 34
Verantwortungsbereiche - Rechtsfragen 3
Merkliste 35
Hinweise zur Benutzung des Buches 4
Forderungen und Bewertung
1 Das Fertigteilverfahren 37
Wärmeschutz
2 Die Berechnung mit Monatsmittelwerten 37
3 Berechnung von Oberflächentauwasser 38
Planungsaufgaben 5
4 Anmerkungen zu den Forderungen 1-3 39
Grundüberlegungen
1 Wärmedämmfähigkeit von Einzelbauteilen 5 Beispiele
2 Wärmeverlust der Außenhülle eines Bauwerkes 7 Überprüfung der Tauwasserbildung
3 Bedeutung der Innenoberflächentemperatur 8 A im Querschnitt der Dachkonstruktion 40
B im Querschnitt der Wandkonstruktion 45
Konstruktions-und Planungshinweise 9 C an den Innenoberflächen der Außenwand 49
Forderungen und Bewertung
1 Wärmedämmung eines Einzelbauteils
(Mindestwärmeschutz - Dl N 41 08) 10 Formänderungen
2 Wärmeschutz der Außenhülle des Bauwerks
Planungsaufgaben 51
(Erhöhter Wärmeschutz- Wärmeschutz
verordnung) 11 Grundüberlegungen
3 Gewährleistung einer optimalen Inneneber 1 Begriffe und Einflußgrößen 52
flächentemperatur (Vollwärmeschutz) 12 2 Abschätzung der Formänderungen
4 Anmerkungen zu den Forderungen 1-3 13 2.1 Formänderungen angrenzender Bauteile 53
Beispiele 14 2.2 Durchbiegung von Stahlbetondecken 55
Konstruktions-und Planungshinweise
Wasserdampfdiffusion Vermeidung zu großer Längenänderungen
1.1 Wärmedehnung 56
Planungsaufgaben 18 1.2 Schwinddehnung 57
Gr u ndüberlegu ngen 1.3 Dachdeckenauflager 57
1 Begriffe und Einflußgrößen 2 Vermeidung zu großer Deckendurchbiegungen 57
1.1 Gesetzmäßigkeiten des Wasserdampfes 19 Merkliste 58
1.2 Dampfdiffusion durch Bauteile 20
Forderungen und Bewertung
2 Dampfdrücke und Temperaturen im
Bauteilquerschnitt 21 1 Klimatische Randbedingungen 59
3 Tauwasserbildung im Bauteilquerschnitt 2 Zulässige Dehnungsdifferenzen oLle und
3.1 Einschichtige Bauteile 23 horizontale Verschiebewinkel tan r 59
3.2 Mehrschichtige Bauteile 24 3 Begrenzung der Deckendurchbiegung 60
4 Abtrocknung ausgefallenen Tauwassers 4 Anmerkungen zu den Forderungen 1 ... 3 60
im Sommer
4.1 Einschichtige Bauteile 25 Beispiele
4.2 Mehrsch ichtige Bauteile 26 Überprüfung der Verformungen am Dach-
5 Einfluß des Tauwassers auf die deckenauflager 61
Wärmedämmfähigkeit 28
5.1 Feuchtigkeitszunahme 28 A Dehnungsdifferenzen zwischen Wand
5.2 Veränderung der Wärmeleitzahl der und Dachdecke 62
durchfeuchteten Schicht 28 B Verschiebung zwischen Dachdecke und
6 Tauwasser an der Innenoberfläche von darunter! iegender Geschoßdecke 66
c
Außenbauteilen 29 Rißsicherheit der nichttragenden Trennwand 67
VI
Inhalt
Tageslichtbeleuchtung
Planungsaufgaben 68 Beispiel
Grundüberlegungen Beurteilung der Besonnungs- bzw. Verschattungs
verhältnisse einer Fassade und eines Platzes 85
Begriffe und Einflußgrößen
1.1 Sonnenstrahlung 68 A Beurteilung der Besonnungs- bzw.
1.2 Tageslicht- Kunstlicht 68 Verschattungsverhältnisse der Fassade F 86
1.3 Lichttechnische Grundbegriffe 69 B Beurteilung der Besonnungs- bzw.
1.4 Gleichmäßigkeit 69 Verschattungsverhältnisse des Platzes P 87
1.5 Blendung 70
1 .6 Schattigkeit 70
1.7 Meteorologische Gegebenheiten 70
1.8 Tages I ichtquotient 70
2 Berechnung des Tageslichtquotienten für
Räume mit klarverglasten Seitenfenstern
2.1 Himmelslichtanteil T H 71 Sonnenschutz
2.2 Außenreflexionsanteil T v 72
2.3 Innenreflexionsanteil T R 72
Grundüberlegungen
2.4 Lichtschwächungsfaktoren 72
1 Begriffe und Einflußgrößen
3 Vereinfachte Bestimmung lichttechnisch
1.1 Einfluß der Orientierung von Fenstern auf
ausreichender Fensterabmessungen 73
die Temperaturverhältnisse in Räumen 89
1.2 Sonnenschutzmaßnahmen 90
Konstruktions-und Planungshinweise
2 Energiedurchlässigkeit des Glases 90
1 Fensteranordnung 73 3 Wärmeaufnahme der raumumschließenden
2 Verbauung 74 Bauteile unter stationären Bedingungen 91
3 Raumabmessungen 74 4 Instationäre Wärmeleitung von nichttrans
4 Tages I ichtquotienten 74 parenten Außenbauteilen 92
5 Gleichmäßigkeit der Beleuchtung 74
6 Blendungsfreiheit 75 Konstruktions-und Planungshinweise
7 Schattigkeit und Lichteinfallsrichtung 75
1 Gebäudeorientierung und Grundrißgestaltung 93
Merkliste 75
2 Fensterfläche 93
3 Raumumschließende Bauteile 93
Forderungen und Bewertung
4 Energiedurchlässigkeit des Fensters 93
1 Größe des Tageslichtquotienten 76 5 Sonnenschutzmaßnahmen
2 Gleichmäßigkeit 76 5.1 Allgemeine Anforderungen an Sonnenschutz
einrichtungen 93
Beispiel 5.2 Konstruktive Ausbildung von Sonnen
Überprüfung der ausreichenden Beleuchtung mit schutzsystemen 93
Tageslicht für Räume mit einseitiger Fenster 5.3 Außenliegende Sonnenschutzeinrichtungen 94
anordnung und klarer Verglasung 77 5.4 Sonnenschutzeinrichtungen in der
Fensterebene 96
5.5 Innenliegende Sonnenschutzeinrichtungen 97
6 Natürliche Lüftung 97
7 Klimatisierung 97
Merkliste 97
Besonnung
Forderungen und Bewertung
Planungsaufgaben 81
1 Wärmebelastung des Innenraumes 98
Grundüberlegungen 2 Ermittlung notwendiger Sonnenschutz
1 Sonnenstandsdiagramm 81 maßnahmen 98
2 Schattenwinkelmesser 82 3 Temperaturamplitudendämpfung und
Phasenverzögerung 99
Konstruktions-und Planungshinweise
1 Orientierung des Gebäudes 83 Beispiel
2 Grundrißgestaltung 83 Überprüfung der Maßnahmen zur Vermeidung
Forderungen und Bewertung 84 zu großer Raumaufheizungen im Sommer 100
VII
Inhalt
Schallschutz Luftschallschutz
Physik - Physiologie
Planungsaufgaben 12 9
1 Schall als Wellenbewegung 102
2 Schall als Energieübertrager 103
Grundüberlegungen
3 Schall als physiologisch-psychologische Größe 106
1 Begriffe und Einflußgrößen 130
2 Luftschalldämmung einschaliger Bauteile 132
3 Luftschalldämmung zweischaliger Bauteile 135
Außenlärm 4 Luftschalldämmung mehrschaliger Bauteile 137
5 Einfluß von schlechtdämmenden Teilflächen 138
Planungsaufgaben 109
Konstruktions-und Planungshinweise
Grundüberlegungen 1 Grundrißkonzeption 140
1 Begriffe und Einflußgrößen 109 2 Einschalige Wände 140
2 Lärmquellen und Lärmerfassung 109 3 Zweischal ige Wände 141
3 Lärmausbreitung 110 4 Fugen und Öffnungen 143
5 Fenster 144
Planungshinweise 6 Türen 146
1 Schutzabstände 112 Merkliste 146
2 Abschirmmaßnahmen 112
Merkliste 112 Forderungen und Bewertung 147
Beispiel
Forderungen und Bewertung 113 Planung des Schallschutzes einer Arztpraxis 148
Beispiel
Ermittlung der Lärmbelastung durch eine Straße
Trittschallschutz
mit Wall 114
Planungsaufgaben 149
Raumakustik
Grundüberlegungen
Planungsaufgaben 115 1 Begriffe und Einflußgrößen 150
2 Trittschalldämmung einschal iger Bauteile 153
Grundüberlegungen 3 Trittschalldämmung mehrschaliger Bauteile
3.1 Schwimmende Estriche 154
1 Begriffe und Einflußgrößen 115
3.2 Weichfedernde Gehbeläge 155
2 Elemente zur Regulierung der Raumakustik
3.3 Unterdecken 155
2.1 Reflektoren 118
2.2 Diffusoren 118 3.4 Balkendecken 155
3.5 Einfluß von Schallbrücken 156
2.3 Absorber 118
2.4 Abschirmwände und Teilkapseln 121
Konstruktions-und Planungshinweise
Konstruktions-und Planungshinweise 1 Estriche 157
Räume der Gruppe 1 2 Fußböden 158
1 .1 Raumvolumen 122 3 Unterdecken 158
1.2 Raumform 122 4 Holzbalkendecken 158
Tabellen für den schalltechnischen Nachweis 159
1.3 Raumbegrenzungsflächen 123
1.4 Nachhallzeit 123 Merkliste 159
2 Räume der Gruppe 2 124
Merkliste 124 Forderungen und Bewertung 160
Beispiele
Forderungen und Bewertung 125 A Nachweis durch Prüfzeugnis 161
B Nachweis mit Hilfe der Deckengruppen 161
Beispiele c Nachweis mit Hilfe der Einzahlangaben 162
Entwurf eines kleinen Hörsaals 126 D Nachweis mit Hilfe der Norm-Trittschall-
Akustische Planung eines Büroraumes 128 pegel-und Pegelminderungskurven 163
VIII
Inhalt
Nebenwegübertragung Haustechnik
Grundüberlegungen Planungsaufgaben 170
1 Begriffe und Einflußgrößen 164
2 Flankenschalldämmung von Bauteilen 165 G ru ndüberlegu ngen
1 Geräuschentstehung 170
2 Körperschalldämmung von Maschinenlärm 171
3 Schalldämmung bei Lüftungskanälen,
Schächten und Rohrleitungen 171
Konstruktions-und Planungshinweise Konstruktions-und Planungshinweise
Wände 166 1 Grundrißkonzeption 172
2 Unterdecken 167 2 Sanitärinstallation 173
3 Doppelboden, schwimmende Estriche 168 3 Schächte und Kamine 174
4 Teppichböden 168 4 Heizungs-und Lüftungsanlagen 174
5 Balkone und Treppen 169 5 Maschinenräume 175
Tabelle für den schalltechnischen Nachweis 169 6 Aufzugs-und Müllschluckanlagen 175
Merkliste 169 Merkliste 176
Forderungen und Bewertung 169 Forderungen und Bewertung 176
Tabellenanhang Schallschutz
Schallschutzforderungen nach DIN 4109, T 5E 185
Schallschutzrichtwerte nach DIN 4109, T 2E 185
Materialdaten 177
Schallschutzforderungen nach Dl N 4109, T 2 + 2 E 186
Anhaltswerte für Innengeräuschpegel 188
Schallschutzmaße (Ergänzende Empfehlungen) 188
Zulässige Lärmpegel (Ergänzende Empfehlungen) 189
Schallabsorptionsgradtabellen 190
Schallpegelminderung durch Abschirmwände 193
Stoßstellendämmaße verschiedener Bauweisen 193
Wärme-und Feuchtigkeitsschutz Luftschalldämmung verschiedener Wände 194
Klimatische Randbedingungen für Innenräume Luftschalldämmung von Türen und Fenstern 197
in Abhängigkeit von der Nutzung 182 Schalldämmung von Gesamtdeckenkonstruktionen 198
Monatsmittelwerte der Außenlufttemperatur für Schalldämmung von Rohdecken 201
verschiedene Standorte 184 Verbesserung der Trittschalldämmung durch
Wasserdampfdrücke P 184 Deckenauflagen 203
5
r:J
Literaturverzeichnis 207
Stichwortverzeichnis 214
1
Planung und Anwendung - Bauphysik
Zur 3., überarbeiteten Auflage Neue Baustoffe, bei denen noch keine oder unzurei
chende Anwendungserfahrungen vorlagen, standen Archi
ln die 3., überarbeitete Auflage wurden die Entwürfe zu
tekten und Ingenieuren zur Verfügung. Neue Konstruk
den neuenDIN-Normen 4108E ,,Wärmeschutz im Hoch
tionsarten, oft in engem Zusammenhang mit den neuen
bau" und 4109E .. Schallschutz im Hochbau" in ihrem
Baustoffen, ergaben bisher unbekannte bauphysikalische
inhaltlichen Überarbeitungsstand Februar 1981 der Art
Belastungen. Als Folge ergibt sich die Notwendigkeit
eingearbeitet, daß an allen notwendigen Stellen, an
neuer erweiterter Kenntnisse auf diesem Gebiet, um
denen Forderungen und Bewertungen aufgeführt, Bei
Fehlleistungen, daraus sich ergebende Bauschäden und
spiele berechnet und Konstruktions- und Planungsh in
die sich nachfolgend einstellenden Schwierigkeiten zu
weise gegeben werden, jeweils durch entsprechende er
verhindern.
gänzende Hinweise auf den Inhalt der vorgenannten
Hierzu für wesentliche Teilbereiche der angewandten
Normenentwürfe Bezug genommen wird. Hierbei sind
Bauphysik eine Hilfestellung zu geben ist die Absicht
diese Hinweise deutlich gegenüber den bisher gültigen
der vorgelegten Veröffentlichung.
Werten und Verfahren gekennzeichnet. Ähnlich ver
fahren wurde bei der Anwendung der D IN 18 005
Inhalt und Zweck des Buches
,.Schallschutz im Städtebau". Mit zunehmendem Be
wußtsein für die Bedeutung der Notwendigkeit von ln den drei Hauptabschnitten wird die jeweilige Planungs
Energieeinsparung und für die Fragen des Umwelt aufgabe vorangestellt, nach der Darstellung von Grund
schutzes, inbesondere des Schallschutzes, werden die überlegungen werden prinzipielle Planungs- und Kon
erhöhten Anforderungen der neuen D IN-Entwürfe unab struktionsempfehlungen vermittelt und an Hand eines
hängig von der Frage ihrer allgemein bauaufsichtliehen Anwendungsbeispiels die Arbeitsschritte systematisch
Einführung von Bauherren gewünscht und von planen abgehandelt.
den Architekten und Ingenieuren gekannt und bei der Der Schwerpunkt dieser Veröffentlichung I iegt damit
Planung gegebenenfalls beherrscht werden müssen. Die bewußt nicht in der Darstellung wissenschaftlicher
vorgelegte überarbeitete Auflage stellt hierzu eine Hilfe Grundlagen und möglich er differenzierter Wertungen.
und Arbeitsgrundlage dar. Hierzu wird ergänzend auf entsprechende Literatur
verwiesen.
Motivation zur Erstellung des Buches Nach dem Grundsatz, so wenig Theorie wie möglich und
so viel wie nötig, ist das Schwergewicht auf die syste
Der Lehrstuhl für Baukonstruktion III der RWTH Aachen
matischen Schritte der Anwendung gerichtet, ohne in
beschäftigt sich seit längerer Zeit wissenschaftlich und
rein rezeptive Anweisungen zu verfallen.
praktisch mit Bauschadensproblemen. Seit 1972 wurden
Die vertiefenden Informationen und Quellenangaben
im Rahmen des Forschungsauftrages des Innenministe
sollen es dem Leser in jedem Falle ermöglichen, sich
riums und nachfolgend des Ministeriums für Landes- und selbst vertiefend mit den angesprochenen Problemen
Stadtentwicklung des Landes N RW ., Bauschadensfragen zu beschäftigen.
- Bauschadensverhütung im Wohnungsbau" Unter
suchungen über Ausmaß und Schwerpunkte von Bau Auswahl des Stoffes
schäden durchgeführt und in speziellen Bauteilunter
Der Maßstab, wel eher Stoff in wel ehern Umfang in den
suchungen von Dächern, Dachterrassen und Balkonen,
angesprochenen drei Hauptbereichen
Außenwänden und Öffnungsanschlüssen, Keller und
1. des Wärmeschutzes,
Dränagen, lnnenwänden, Decken und Fußböden sowie
des Wärmedurchgangs und der Tauwasserbildung
Fenster und Außentüren Konstruktions- und Ausfüh
im Querschnitt,
rungsempfehlungen vorgelegt [53, 54]. Zugleich wurden
-der Tauwasserbildung an lnnenoberflächen,
bei der Erstellung zahlreicher Gerichtsgutachten und
- der Längenänderungen,
Beratungen Erfahrungen über Bauschäden, ihr Ausmaß
2. -der Tageslichtbeleuchtung,
und ihre Ursachen gesammelt.
-der Besonnung und des Sonnenschutzes,
Einer der erkennbaren Schwerpunkte, die -sich häufig
3. -des Schallschutzes und der Raumakustik
wiederholend - zu Fehlleistungen bei Planung und Aus
behandelt wird, wurde ausschließlich nach dem Ge
führung von Hochbauten führen, sind unzureichende
sichtspunkt der tatsächlich in der Praxis der Planung
Berücksichtigung bauphysikalischer Beanspruchungen
anfallenden Aufgaben angelegt.
und mangelnde Kenntnis zur Analyse sowie das Unver
mögen zur qualitativen und quantitativen Abschätzung Aus der Tatsache, daß neue DIN-Entwürfe für den
dieser Beanspruchungen und der sich daraus ergebenden Wärme- und Schallschutz vorliegen und zugleich die
konstruktiven und materialtechnischen Konsequenzen. Wärmeschutzverordnung bei Neubauten verbindlich an
Neben der ständigen Reflexion der Forschungsergeb gewandt werden muß, ergab sich eine Schwierigkeit
nisse für die Lehre bei der Ausbildung von Studierenden der Art, daß
hatten die Verfasser Gelegenheit, bei zahlreichen Fort a) bestimmte heute noch gültige und zulässige Grenz
bildungsveranstaltungen für Architekten und Ingenieure werte
deren besondere Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung b) zulässige Beanspruchungen und
von bauphysikalischen Planungsaufgaben kennenzu c) durch Neueinbeziehung bestimmter Beanspruchungen
lernen. der D IN-Entwürfe und des Energieeinsparungsgesetzes
2
Bauphysik- Planung und Anwendung
in den jeweiligen Abschnitten alternative Betrachtungen Ein häufig auftretender Fehler liegt in einem zu späten
bzw. Lösungswege dargestellt werden, oder aber Hinweise Einbeziehen bauphysikalischer Überlegungen im Pla·
auf neue Entwicklungstendenzen gegeben wurden. nungsprozefs. Es ist unrichtig und führt zu nicht not·
Der abzuhandelnde Stoff der drei Hauptabschnitte er· wendigen Zeit· und Arbeitsverlusten, wenn eine schon
fuhr seine Begrenzung dadurch, daß nur solche Gebiete nahezu fertige Planung erst nachträglich auch auf bau
angesprochen wurden, die physikalische Beanspruchungen hin untersucht wird.
entweder zum Problembewußtsein von Ingenieur und/ Die sich aus dieser ,.Überprüfung einer Planung" nach
oder Architekt vorauszusetzen sind bauphysikalischen Gesichtspunkten ggf. ergebenden
oder im Rahmen der eindeutig umschriebenen Aufgaben Änderungen können so einschneidend sein, daß das
von Architekt und/oder Ingenieur erfüllt werden müssen Planungskonzept in Hinblick aut andere Gesichtspunkte
(Berechnungen, Nachweise und Detailkonstruktionen). wie die der Gestaltung, der Nutzung oder der Kosten
einschneidende Änderungen erfahren muß.
Stellenwert der Bauphysik
Bei rechtzeitiger Einbeziehung der Überlegungen bau·
Jede vertiefende und spezielle Beschäftigung mit einer physikalischer Beanspruchungen werden solche Schwie·
technisch-wissenschaftlichen Disziplin, die im Gesamtzu rigkeiten vermieden, Alternativlösungen sind rechtzeitig
sammenhang von Planung und Ausführung von Hoch möglich.
bauten berücksichtigt werden muß, beinhaltet die Ge An den nachstehenden beiden Abbildungen soll ver
fahr einer Überbewertung ihrer tatsächlichen Bedeutung deutlicht werden. daß eine Zusammenschau bauphysi·
oder einer Iosgei ästen Betrachtungsweise. kalischer Fragen nur mit allen anderen zusammen sinn·
voll möglich ist.
Grundlagenforschung hat gerade auf dem Gebiete der
Bauphysik eine große, nicht zu unterschätzende Bedeu
tung; ohne sie wären die neuen Anwendungsmethoden Bauphysikalische Berechnungen
nicht denkbar. Das vorliegende Buch will sich jedoch Bauphysikalische Berechnungsmethoden stellen Pla
mit der angewandten Bauphysik, nicht mit der Grund nungshilfen für den Architekten und Ingenieur dar, die
lagenforschung befassen. Im Mittelpunkt der Aufgaben ihn in den Stand versetzen, durch überschlägliche Be
des Architekten steht der Entwurf des Bauwerkes zur rechnung (bei ZugrundelegunQ eines stationären Zu
Erfüllung der Bedürfnisse der Benutzer, die Erfüllung standes) bauphysikalische Belastungen, wie z.B. Ermitt·
funktionaler Zusammenhänge und die architektonische lung und Beurteilung von Dämmfähigkeit, Schichtgrenz
Gestaltung.
temperaturen, Dampfdrücken. Tauwassermengen, Schall
Die Bauphysik hat dabei ihre nicht zu unterschätzende
dämmwerten, Schallschutzmaßen, Verschattungen oder
Bedeutung im Sinne einer ergänzenden, dienenden tech· Speicherfähigkeiten eines Raumes zu ermitteln.
nischen Disziplin, die die eigentlichen Aufgaben erst
Wichtig ist hierbei der Hinweis. daß es sich bei solchen
mängelfrei ermöglicht und bei Kenntnis der bauphysi
Berechnungsmethoden um übersch lägl iche, zur sicheren
kalischen Probleme und deren angemessene Lösung
Seite hin liegende Ermittlungen handelt, die nicht als
Architekt und Ingenieur erst für seine eigentlichen
quantitativ exakte Rechnungen angesehen werden
Aufgaben freimacht.
dürfen. Da stationäre Zustände zugrunde gelegt werden,
Angewandte Bauphysik kann nur im Zusammenhang
sind die Ergebnisse sehr stark von den angenommenen
mit der Konstruktion und den Baustoffen gesehen wer
Randbedingungen des jeweiligen Be rech nungsverfah rens
den. Denn die Auswirkungen aufeinander sind wechsel
abhängig. Wir verweisen hierzu beispielhaft auf die spe
seitig. Als Beispiele mögen sie für den Schichtaufbau
ziellen Ausführungen zum "Fertigteilverfahren"
einer Wand oder eines Daches gelten.
(-+ S. 37)
Entwurfsbestimmende Verknüpfung der Bauphysik
2.1 Einflußgrößen 2.2 mit anderen Entwurfsaspekten
Formale Nutzungs Umwelt Form Nutzung IJmwelt
Aspekte anforderung bedingungen r8,W~l.,.. .. aOdt"~'W"t QI>I'Mrllhl! ll"O't'llttlhnnl!..lI•Omft• w"l..':":"r'"ll'
Bel'l~locl'lll••l ,__ Fe..,c.P'thglr.e•t
Bei.U(:hiUfliJ rl $f;h.IOIJ
t=:=:J~~:c==~c:::=- "--- Sc:h.·II~I'!8U•il• •~Vf'l•l!uAl"'ntjc! lefb.rlt.eol lultweo;.Etmlo!mo~!.~S-to(llo"i""'4"ol9'l
y ---;;-,. (r~hulterufltj!
Tragverhatten-~
Entwurf ~u
ISt•hkl
Gesetze Statik
BAU-
eines '-..---"' . l•cl'ln•'K"- lk~lornrnu"9f'l"' Tlf9lollfollll.lul
B•t.~IM',.Itmmt.~nqen Mill.l•ill•illlll
lr~ konomische Bauteils ZusammenrliQefl. GOeIN~ ••Nuo t~rl rJ PHYSIK Chme-J~ITiQrt•l'lt"''f•VI~II4•
C)glichkeiten Herstellen I ,., I
II<Oor\Strult.I!Oo"l
Oekonomie - (,,,. Konstruktion
-
~-----....1.../
1-----------1 Ertlt'llt.I"9SkOtlt'fll SuuCP'Itt-r~lolge
LSecbhewnascdhasuteelrle, n Bauphysik UMr~itllt(l-tl'tlPltoe\~~rIlIglIto,.~Oelt'lblg••' d"'• rll Oo.•m••o·n•~t•u•N,rtbbo•an'4rtt"at'.o'•"g•'••9
IS<.ha~''\UI'IIab~gUtl Lt'bet!tsd~t.~t't vorl•'''9"'"9
L.k"'t•rllall""9, Sch~td•'"''~,..,~th9tt.••t