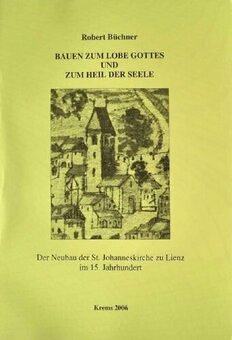Table Of ContentBAUEN ZUM LOBE GOTTES UND ZUM HEIL DER SEELE
Robert Büchner
MEDIUM AEVUM QUOTIDIANUM
HERAUSGEGEBEN VON GERHARD JARITZ
SONDERBAND XVII
Robert Büchner
BAUEN ZUM LOBE GOTTES
UND ZUM HEIL DER SEELE
Der Neubau der St. Johanneskirche zu Lienz im 15. Jahrhundert
(mit einer Edition des Rechnungsbuches 1467–1491)
Mit einem historischen Abriss
von
Meinrad Pizzinini
Krems 2006
GEDRUCKT MIT UNTERSTÜTZUNG
DER ABTEILUNG KULTUR UND WISSENSCHAFT DES AMTES DER
NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
DER ABTEILUNG KULTUR DES AMTES DER TIROLER LANDESREGIERUNG
DER STADTGEMEINDE LIENZ
Umschlagbild: Lienz, Kirche zu Johannes dem Täufer. Ausschnitt aus der ältesten erhaltenen
Ansicht von Lienz, aquarellierte Federzeichnung, 28,3 x 54,3 cm, 1606/1608. Beilage zu
Matthias Burgklechners Geschichtswerk „Tiroler Adler“, Bd. III (Wien, Haus-, Hof- und
Staatsarchiv, Inv.-Nr. Weiß 231, Bd. 9, jetzt Kartensammlung). Foto: Claudia Sporer-Heis
Alle Rechte vorbehalten
– ISBN 3-90 1094 20 2
Herausgeber: Medium Aevum Quotidianum. Gesellschaft zur Erforschung der materiellen
Kultur des Mittelalters, Körnermarkt 13, A–3500 Krems, Österreich. Für den Inhalt verant-
wortlich zeichnen die Autoren, ohne deren ausdrückliche Zustimmung jeglicher Nachdruck,
auch in Auszügen, nicht gestattet ist.
Druck: KOPITU Ges. m. b. H., Wiedner Hauptstraße 8-10, A–1050 Wien.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort .................................................................................................................6
Teil 1: Baugeschichte der St. Johanneskirche zu Lienz 1467-1491
Bauführung, Baufinanzierung, Baubetrieb...............................................10
1. Agunt, St. Andrä und St. Johannes zu Lienz im Überblick..................10
2. Die Anfänge des Baus und seine Organisation.....................................11
3. Maurer und Steinmetzen, Baumeister und Poliere ...............................15
4. Zehnjährige Unterbrechung des Baus (1475-1484)..............................19
5. Die Glocke ............................................................................................20
6. Die Türken vor Lienz............................................................................21
7. Wiederaufnahme und Vollendung des Baus.
Zimmerleute, Meister Hans Huber (Hans von Villach),
der „rechte“ Baumeister von St. Johannes............................................21
8. Baukosten, Einkünfte und Spenden......................................................31
9. Baustoffe...............................................................................................37
10. Arbeitszeit und Beschäftigungsdauer....................................................40
11. Vermutliche Mitglieder der Görzer Bauhütte.......................................41
12. Löhne und Verköstigung der Bauhandwerker und -hilfsarbeiter.........42
13. Werkzeuge und Transportmittel............................................................50
14. Buchführung und Rechnungsprüfung...................................................51
15. Zusammenfassung.................................................................................54
Teil 2: Das Rechnungsbuch der St. Johanneskirche zu Lienz 1467-1491
(Handschrift XXII/V.9 des Pfarrarchivs Lienz)........................................55
1. Beschreibung der Handschrift...............................................................55
2. Editionsgrundsätze................................................................................57
3. Text…..........................................................................................……..60
4. Literaturverzeichnis.............................................................................129
5. Für Worterklärungen und Ortsnamen benutzte Nachschlagewerke...132
6. Ortsregister..........................................................................................134
7. Personenregister..................................................................................136
8. Sachregister.........................................................................................145
Meinrad Pizzinini: Die Kirche zu St. Johannes dem Täufer in Lienz.
Ein kurzer historischer Abriss.................................................................151
Abbildungsteil, zusammengestellt von Meinrad Pizzinini ...............................167
5
Vorwort
Jüngst hat Herbert Knittler1 darauf hingewiesen, dass Österreich im Gegensatz
zu Deutschland und der Schweiz hinsichtlich der Bearbeitung spätmittelalterli-
cher Baurechnungen arg ins Hintertreffen geraten ist. Er konnte lediglich drei
Studien zur Geschichte kommunalen Bauens in Österreich (Krems, Freistadt und
Weitra = seine eigene Untersuchung) anführen, im kirchlichen Bereich gar nur
eine (St. Stephan in Wien). Unter diesem Blickpunkt ist die Veröffentlichung
und Auswertung der (Bau-)Rechnungen von St. Johannes zu Lienz wohl ge-
rechtfertigt, wenn nicht sogar – mit Knittler – „wünschenswert“, mag es sich
auch „nur“ um ein kleineres Gotteshaus handeln.
Kirchenbau hatte im 15. Jahrhundert Konjunktur. Gotisierung alter Kir-
chen war en vogue, wenn man sie nicht überhaupt abriss und etwas völlig Neues
an ihre Stelle setzte. Der Neubau von St. Johannes, mochte er auch durch die
Feuersbrunst unumgänglich gewesen sein, fiel deshalb nicht besonders auf, zu-
mal sich eine Nebenkirche wie St. Johannes in einer gräflichen Residenzstadt
von gerade 1500 Einwohnern (Ende des 15. Jahrhunderts)2 sowieso nicht mit
den stattlichen, mehrschiffigen, mit Querschiff, ausladendem Chor und Neben-
kapellen versehenen Pfarrkirchen und Domen3 der Zeit messen konnte. Aber das
war auch nicht beabsichtigt. Hinter der Errichtung von St. Johannes stand nicht
die Bauwut eines Abtes oder Bischofs, der sich mit einer prächtigen Kirche oder
Kathedrale ein Denkmal für die Ewigkeit setzen wollte. Dahinter stand auch
nicht das Prestigedenken eines hohen Adligen, der seine Macht und seine Res-
sourcen, und sei es um den Preis des Schuldenmachens, zur Schau stellen
wollte. Sie alle unterlagen dem Zwang eines „repräsentativen Anspruchsni-
veaus“4, sie mussten mit ihren Bauten Maßstäbe setzen, die einer Kritik derjeni-
gen standhielten, die sich auf Architektur verstanden. Die Urteilsfähigkeit eines
1 Bauen in der Kleinstadt. Die Baurechnungen der Stadt Weitra von 1431, 1501–09 und 1526
(Medium Aevum Quotidianum, Sonderband XV), Krems 2005, 6. Die neue, fast nur archi-
tektonische, bauanalytische Untersuchung von Walter Bettauer (Die Michaelskapelle in
Neustift bei Brixen. Baugeschichte und Bedeutung eines mittelalterlichen Zentralbaus
[Schlern-Schriften 331]. Innsbruck 2006) betrifft, staatsrechtlich gesehen, nicht mehr Öster-
reich.
2 Meinrad Pizzinini, Lienz, in: Franz-Heinz Hye, Die Städte Tirols, 1. Teil: Bundesland Tirol
(Österreichisches Städtebuch 5,1), Wien 1980, 184.
3 Vgl. allgemein Jean Gimpel, Die Kathedralenbauer, Holm 1996; Norbert Ohler, Die Kathed-
rale. Religion, Politik, Architektur. Eine Kulturgeschichte, Düsseldorf 2002; Ehrenfried
Kluckert, Chorgebet und Handelsmesse. Vom Alltag in den gotischen Kathedralen (Herder-
Spektrum 5613), Freiburg/Br. 2006 (auch baugeschichtlich ausgerichtet, populär).
4 Martin Warnke, Bau und Überbau. Soziologie der mittelalterlichen Architektur nach den
Schriftquellen (stw 468), Frankfurt/M. 1984, 20-27.
6
überregionalen Publikums hatte jeder anspruchsvolle Bauherr ins Kalkül zu zie-
hen, gleich ob es ein profaner oder kirchlicher Bau war. Heute erblicken wir oft
zu Unrecht in älterer Architektur sinnlose Prunksucht und Protzerei, was früher
als angemessen galt.
Solche hochgesteckten Ansprüche stellten sich die „Bauherren“ von St.
Johannes nicht, sie bauten nicht, um vielleicht hören zu können, ihre Kirche sei
unvergleichlich, solche Pracht habe man noch nicht gesehen, hinter ihrem Vor-
haben steckte nicht der Baueifer einer ruhmsüchtigen Bürgerschaft, die durch
eine repräsentative Pfarrkirche ihre eigene Stadt ins rechte Licht zu rücken
suchte5. „Eine Kirche zu bauen, die alles bis dahin Gesehene übertreffen solle“,
wie 1390 der Rat von Bologna beschloss6, wäre ihnen nie in den Sinn gekom-
men. Dazu reichten die Eigenmittel der Kirche und die Spenden der Gläubigen
bei weitem nicht aus, dazu fehlte es an größerer Unterstützung von dritter Seite,
so sehr auch alle Schichten der Stadtbevölkerung zu geldlichen und sonstigen
Opfern bereit gewesen sein mögen. Rattenberg hätte den Neubau seiner St. Vir-
gilkirche (1473-1512), Schwaz den seiner Pfarrkirche (1491-1502) nicht so
prächtig gestalten können, wenn nicht Bürger und Knappen, überhaupt alle
Bergwerksverwandten (Gewerken, Knappen, Hilfskräfte) zusammen gesteuert
hätten. Diese Gemeinsamkeit schlug sich dann an beiden Orten in zwei Chören
nieder, je einen für die Bürger und Knappen7.
Nicht Prestigedenken, nicht lokale Kirchenpolitik, sondern der Wunsch,
einem Gotteshaus, das dem Volk lieb und teuer war, aber unter einem Brand
schwer gelitten hatte, wieder ein würdiges Aussehen zu verleihen, bewog die
Gemeinde von St. Johannes, einen Neubau zu wagen und nach Überwindung ei-
niger Schwierigkeiten glücklich zu beenden. Ob dafür die Erlaubnis der kirch-
lichen Obrigkeit, etwa des Erzbischofs von Salzburg, eingeholt wurde ist nicht
bekannt. Man dürfte aber nicht begonnen haben zu bauen, ohne vorher Rück-
sprache mit den zuständigen Stellen gehalten zu haben. Das könnte auch der
Graf von Görz gewesen sein, der ja nachdrücklich durch Sachleistungen den
Bau unterstützt hat. Zwar gab es in Lienz noch die Pfarrkirche St. Andrä, auf
dem Rindermarkt St. Michael und dazu noch zwei Kloster- und eine Spitalkir-
che, doch heimisch fühlten sich anscheinend viele Bewohner der Stadt nur in St.
Johannes. Hier wie anderswo hat erst der Opferwille und die Spendenfreudigkeit
der Bürger einen Kirchenbau ermöglicht, auch das ein sichtbares Zeichen mit-
telalterlicher Frömmigkeit.
5 Vgl. hierzu Klaus Jan Philipp, Pfarrkirchen. Funktion, Motivation, Architektur. Eine Studie
am Beispiel der Pfarrkirche der schwäbischen Reichsstädte im Spätmittelalter (Studien zur
Kunst- und Kulturgeschichte 4), Marburg 1987.
6 Dietrich Conrad, Kirchenbau im Mittelalter. Bauplanung und Bausausführung, Leipzig
1990, 38.
7 Erich Egg, Die Pfarrkirche zum hl. Virgilius in Rattenberg, in: Festschrift zur Wiedereröff-
nung der Stadtpfarrkirche zum hl. Virgil in Rattenberg, Red. Peter Orlik, Rattenberg 1984,
85-86 (u. 98).
7
Bekanntestes Beispiel dafür ist Straßburg. Abgesehen vom Stephansdom
in Wien ist nirgends ein so großes Bauvermögen von der Bürgerschaft aufge-
bracht worden wie in Straßburg beim gotischen Neubau des Münsters, unge-
achtet aller damaligen Gegensätze zwischen Bistum und Stadt im Spätmittelal-
ter. Wien und Straßburg waren es auch, in denen die Stadt gänzlich Organisation
und Finanzierung des Baus verwaltete, was sonst nur im Zusammenspiel mit an-
deren (kirchlichen) Stellen der Fall war. Ob in Lübeck oder Bremen, Köln oder
Regensburg, die Baulast spätmittelalterlicher Kathedralkirchen wurde in ent-
scheidendem Maße von der Bürgerschaft getragen, die, soweit erkennbar, stets
ein starkes Interesse am Zustandekommen des Dombaus zeigte8.
Sicher war jede Kirche in erster Linie ein Haus Gottes und Bauen zum
Lobe Gottes verdiente ebenso Anerkennung9 wie Spenden dafür. Nur geschah
Letzteres nicht ganz ohne Hintergedanken. In einer Zeit, als das Fegefeuer fröh-
lich loderte, wusste man, dass alle Sünden im Jenseits gebüsst werden mussten.
Gute Taten auf Erden – und dazu zählten auch Spenden für Kirchenbauten (Ab-
lassgelder, Schenkungen, letztwillige Vermächtnisse, Opferstockgelder o. ä) –
konnten die Verweildauer der eigenen Seele im Läuterungsfeuer verkürzen oder
den bereits in den Flammen Leidenden fürbittweise zugewandt werden. Je mehr
gute Werke auf Erden, desto höher das Bonuskapital im Jenseits. Die einen
häuften Frömmigkeitsakte (asketische Übungen wie Gebete, Meditationen, Le-
sungen heiliger Schriften, Fasten, körperliche Züchtigungen bis hin zu Geiße-
lungen) an, die anderen suchten, sich mit einem öfteren Griff in die eigene
Geldbörse einen gnädigen Gott zu verschaffen. Die Gnadenwirkung wurde als
mess- und zählbar angesehen10. Wer für St. Johannes spendete, sorgte auch ge-
zielt für sein Seelenheil, neben aller tiefen Religiosität und echten Frömmigkeit,
die solchem Tun zugrunde lagen.
Im Wesentlichen lief der Betrieb auf großen wie kleinen Baustellen nach
dem gleichen Schema ab. Hier wie da mussten Risse, Bauzeichnungen und
Schablonen entworfen werden, hatte man Fachhandwerker (vor allem Steinmet-
zen, Maurer und Zimmerleute) und Bauhilfsarbeiter anzustellen, zu entlohnen
und bei Gelegenheit zu speisen, galt es, Baumaterial heranzuschaffen, auf Fes-
tigkeit und Standsicherheit der Bauteile zu achten usw. Finanzierungsprobleme
traten nicht nur in Lienz auf, sondern gab es wohl überall, sonst hätte man nicht
an einigen Kirchen jahrhundertelang bauen müssen. Was anderswo im Großen,
kostbarer und mit mehr Aufwand errichtet wurde, das fand sich im Kleinen und
8 Peter Wiek, Das Straßburger Münster. Untersuchungen über die Mitwirkung des Stadtbür-
gertums am Bau bischöflicher Kathedralkirchen im Spätmittelalter, Zeitschrift für die Ge-
schichte des Oberrheins 107 (1959), 40-113, bes. 93-113.
9 Der Abt von Cluny verteidigte Suger von Saint-Denis, dem man als Motiv für sein Bauen
Ruhmsucht unterstellte, damit, Suger baue nicht „für sich selbst, sondern für Gott so viel“
(Warnke, Bau, 63). Der Kölner Stadtrat wollte den Dombau „zu Gottes und unserer Stadt
Ehre“ vollenden, was keine bloße Floskel war (Wiek, Münster, 113).
10 Vgl. Arnold Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 1997, 581-
584: Gezählte Frömmigkeit.
8