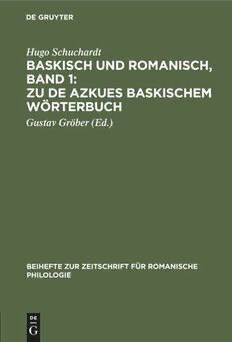Table Of ContentBEIHEFTE
ZUR
ZEITSCHRIFT
FÜR
ROMANISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN
VON
DR. GUSTAV GRÖBER
FROKKSSOR AN DER UNIVERSITÄT STRASBURG 1. K.
VI. HEFT
HUGO SCIIUCIIARDT, BASKISCH UND ROMANISCH (ZU DE AZKUES
BASKISCHEM WÖRTERBUCH I. BAND)
HALLE A. S.
VERLAG VON MAX NIEMEYER
1906
BASKISCH UND ROMANISCH
ZU DE AZKUES BASKISCHEM WÖRTERBUCH
I. BAND
VON
HUGO SCHUCHARDT
HALLE A. S.
VERLAG VON MAX NIEMEYER
1906
Übersicht.
Seite
Beurteilung von de Azkues Wörterbuch i
Basko-romanisches 5
Romano-baskisches 8
Rom.-bask. Parallelismus in den Wortgruppen cusc-, casc-, coc- u. ä. 10
Lautentwicklung 16
•Ng-} •nd- 17
Wechsel zwischen anl. Xenuis und Media 19
Wechsel zwischen ¡D1. Mediae. Schwund und Zutritt solcher
(sowie von -r-, -»-). „Hiatustilgung" 22
Wechsel zwischen anl. Verschlufslauten. Schwund und Zutritt
solcher 29
Das l- des rom. Singularartikels mit dem Subst. verwachsen —
anl. Verschlufslaute ersetzend. L- geschwunden . . .. 34
Das -s des rom. Pluralartikels mit dem Subst. verwachsen
(bask. zverkleinernd [t]s-) — anl. Verschlufslaute ersetzend.
Z- geschwunden 37
Onomatopöie 40
Liste merkwürdiger Lehnwörter 41
Bedeutungsentwicklung 45
Nachträge 59
Romanische Wörter deren Herkunft berührt wird 62
Besurrección María de Azkue, presbitero, profesor de
vascuence en el Instituto de Bilbao Diccionario vasco-español-
francés. [Entsprechender französischer Titel.] Tom. L — (A—L).
Bilbao, Dirección del Autor, 15, Campo Volantín, 15, 1905 [ist
überklebt mit der Angabe: En dépôt à Paris chez Paul Geuthner,
libraire-antiquaire, 10, Rue de Buci, 10]. — Quart, S. XLVII,
(dreispaltig) 561.
Unter den Ursachen die den innern und äufsem Fortschritt
der baskischen Studien bisher gehemmt oder verlangsamt haben,
steht wohl obenan der Mangel eines guten Wörterbuchs, ich meine
eines dem Umfang wie der Beschaffenheit nach völlig befriedigenden.
Was ich darüber Ztschr. XI, 509 f. bemerkte, hat fast für zwei Jahr-
zehnte seine Geltung behalten. In den letzten Jahren stieg zwar
am Himmel der baskischen Lexikographie ein kleiner Stern empor,
aber nur um bald wieder unter den Horizont zu sinken; mit den
guten Hoffnungen die J.-B. Darricarrères Nouveau dictionnaire
basque-français-espagnol (Bayonne, A. Lamaignère) erweckt hatte —
so viel ich sehe, ist es nur bis S. 176 (artzi) gediehen — schien
alle Hoffnung überhaupt für geraume Zeit erloschen. Ich empfand
daher eine grofse Überraschung als man mir die sehr umfangreiche
erste Hälfte1 eines baskischen Wörterbuchs als schon erschienen
(also nicht vom „zitternden Glück" der Lieferungen abhängig) an-
kündigte, und eine noch gröfsere als diese Hälfte vor mir lag.
Denn es ist hier mehr, weit mehr geleistet worden als wir unter
den jetzigen Umständen irgendwie erwarten durften.
Der Urheber dieses Wörterbuchs, der Priester — oder wie er
sich selbst auf französisch nennt, „l'Abbé" — R. M. de Azkue ist
derjenige Baske bei welchem die Liebe zur Muttersprache, zunächst
zu der angestammten Mundart, der bizkayaschen, die reichsten und
gediegensten litterarischen Früchte gezeitigt hat. Er hat in ihr
1 Wenigstens umfassen die Buchstaben A—L, auch nach Ausschaltung
von Ch (das bei A. als S und Ts erscheint), die bei weitem gröfsere Hälfte des
Wortschatzes. Das Werk ist aber auf mehr als zwei Bände berechnet; S. XII f.
ist davon die Rede dafs am Schlufs des dritten Teiles, vielleicht zusammen
mit der „Introducción", der erste Nachtrag veröffentlicht werden soll, S. XXIII
hingegen wird der fünfte Band als derjenige bezeichnet der diese Einleitung
enthalten werde.
Beiheft z. Zeitschr. f. rom. Phil. VI. r
2
(zum Teil auch in gipuzkoascher), aufser den Gedichten seines
Vaters, zahlreiche eigene Schöpfungen, darunter auch Singspiele,
veröffentlicht, eine Zeitschrift (grofsenteils von ihm selbst geschrieben)
durch drei Jahre geleitet, endlich in einer kleinen praktischen
Sprachlehre die Fremden, sowie in einer grofsen theoretischen
(bask. u. spat), geschriebenen) mit diesen gemeinsam die Einheimischen
unterweisen wollen. Auch die letztere ist im Ausland bekannt,
freilich mit einigem Mifstrauen aufgenommen worden, da man sich
nicht recht klar darüber wurde was darin volkstümliches Baskisch
und was von A. konstruiertes ist. Er selbst bereut sie nun wie
eine Jugendsünde; er erkennt seinen Irrtum geglaubt zu haben
dafs die verschiedenen Mundarten des Baskischen sich vereinigen
liefsen wie die Substanzen in einer Phiole. Statt der geträumten
Einheit führt uns das gegenwärtige Werk die wirkliche Vielheit vor.
In langen Jahren hat A. einen geradezu staunenswerten Reichtum
von Wörtern und Wortformen gesammelt, nicht blofs aus gedruckten
Quellen und aus einem Dutzend handschriftlicher Wörterbücher,
die ihn zu Reisen bis nach England veranlafsten, sondern vor
allem aus dem Munde sehr vieler, den verschiedensten Teilen des
Baskenlandes angehörigen Personen. In den sieben Hauptmund-
arten (bizkayasch, gipuzkoasch, laburdisch, hochnavarrasch, nieder-
navarrasch, sulisch, ronkalisch, hier abgekürzt: b. g. I. An. nn. s. r.)
sind die Sprechweisen von dritthalbhundert Ortschaften vertreten.
Wenn ein Wort durch eine ganze Mundart verbreitet ist, so wird
das durch ein c. (comün) gekennzeichnet (also z. B. Bc = „all-
gemein bizkayasch"); c, . . . bedeutet „fast allgemein" (was unter
einem .. . dem kein c vorausgeht, zu verstehen ist, weifs ich nicht).
Folgt auf den grofsen Buchstaben irgend eine andere Abkürzung,
so ist damit gesagt dafs das Wort an dem betreffenden Orte fest-
gestellt ist, z. B. L-ain-azk = „laburdisch von Ainhoa und Az-
kain" (ich sehe im folgenden von diesen Einzelbestimmungen ab).
Über den Gebrauch der von keinem Zusatz begleiteten grofsen
Buchstaben finde ich nichts bemerkt; vermutlich bezieht er sich
darauf dafs eine genauere Lokalisierung nicht möglich war. Die
sonstigen Schwierigkeiten welche die Darstellung eines so bunten
und überquellenden Stoffes mit sich brachte, scheinen ebenfalls in
glücklicher Weise überwunden zu sein. Die Druckerei, die von
A. Mame u. S. in Tours, hat ihr Bestes getan; der Druck ist zwar
eng, aber schön, deutlich, und auch in stofflicher Hinsicht, durch
die Anwendung verschiedener Schriftarten übersichtlich. Die Korrektur
ist mit grofser Sorgfalt vorgenommen worden. Der französische
Text, der überall dem spanischen auf dem Fufse folgt, entspricht
ihm bestens; nur selten wird sich ein Versehen finden wie S. I22a,
Z. 5 v. u.: si je le vois oü il est (statt: st je lui vat's . . . = si me lt
voy ä dondc esld). Soweit es sich um die einzelnen Wortbedeutungen
handelt, ist die Doppelsprachigkeit von besonderem Nutzen. Manch-
mal jedoch decken sich die Wörter der beiden Sprachen so voll-
ständig dafs eine bestehende Ungewifsheit nicht behoben wird,
3
z. B. wenn neben aketa (wie in einem kleinen Orte Niedernavarras
gesagt wird) „café, café" steht; ist damit der Rohstoff oder das
Getränke oder der Ausschank gemeint? Solange man das nicht
weifs, kann man sich nicht einmal auf das Raten des Ursprungs
verlegen. In andern Fällen wiederum scheinen die beiderseitigen
Ausdrücke ganz auseinander zu fallen, so S. 503° unter kozkor 1:
„orujo de la uva" und „räfle de raisin"; denn orujo ist = marc,
und räfle ist = escobajo; letzteres richtig S. 510a unter kuskur 2.
Aber an eben dieser zweiten Stelle, unter 1, steht ein neues Rätsel:
„troncho de pera, manzana" = „trognon de poire ou de pomme",
insofern als troncho und trognon sich nur in der Bed. „Strunk"
(des Kohls) decken. Allein wir müssen beim Verfasser mit Bil-
baismen rechnen; als einen solchen finde ich trunchus (de man-
zana, de pera) für corazones gebucht. Ein anderer ist z. B. das
häufig vorkommende limaco „nackte Schnecke". Es enthält also
auch der Erdera-teil des Wörterbuchs Lehrreiches für den Roma-
nisten. Nur ausnahmsweise kommt es vor dafs in beiden Sprachen
die Bedeutung des baskischen Wortes nicht ganz richtig angegeben
wird. So steht S. 13 ib neben bapho: „cuajo, caillette". Mit cuajo,
welches gewöhnlich „Lab" bedeutet, ist hier der „Labmagen" ge-
meint (so = cuajar sehe ich es nur im Wtb. de Toros verzeichnet).
Aber es hat nun eine jener so häufigen Verwechslungen statt-
gefunden von denen ich Ztschr. XXVIII, 444 ff. gesprochen habe,
und zwar des Kropfes der Vögel (der höchstens als erster Magen
gelten könnte) mit dem vierten Magen der Wiederkäuer. Die Be-
legstelle (Hoheslied I, 9) hat uso tortoilaren baphoa, was mit „la
gorge de la colombe" richtig, aber mit „el cuajo de la paloma torcaz"
falsch übersetzt ist. Die Nebenformen von bapho (Azkue bietet
bap[h]aru nicht) und die zugrunde liegenden romanischen sehe
man Ztschr. XI, 478.
Hiermit ist nun endlich für die wortgeschichtliche Erforschung
des Baskischen ein breiter und sicherer Boden gewonnen. Aller-
dings machen sich zwei Übelstände fühlbar, die aber nicht dem
Sammler und Darsteller zur Last fallen, sondern eben erst durch
den Forscher selbst beseitigt werden müssen; beide beziehen sich
auf die Trennung der einzelnen Wörter voneinander. Einerseits
bilden die verschiedenen Lautformen eines Wortes, aufser wénn sie
sich nur sehr wenig unterscheiden und alphabetisch aufeinander-
folgen, verschiedene Artikel; anderseits sind unter einer Form oft
so voneinander abweichende Bedeutungen vereint dafs es sich gar
nicht um ein einziges Wort handeln kann. Van Eys hat uns die
Sache allerdings leichter gemacht, aber sie war ihm selbst durch
die beschränkte Wortmenge leichter gemacht; einer ganz andern
Aufgabe stand Mistral gegenüber und hat sie bewältigt, freilich
nicht ohne viele gordische Knoten zu durchhauen. A. hätte
alles dem Anschein nach lautlich Zusammengehörige wenigstens
durch Hinweise miteinander verbinden sollen. Solche fehlen zwar
nicht ganz bei ihm, sind aber doch sehr spärlich angewendet;
1*
4
so finden sich z. B. von den Formen 1. bufunta, nn. burßintS,
s. burzuntz, nn. 1. busoniza, busunta, r. buzuntz „Zitterpappel", 1.
burontza „Zypresse" (und andere sind mir vielleicht entgangen) nur
die vierte und fünfte mit Hinweisen versehen, und nur mit solchen
auf die sechste. Jedesfalls erwarten wir dafs sich an das baskisch-
romanische Wörterbuch ein ganz gedrängtes romanisch-baskisches
anschliefse, wofür eine der beiden romanischen Sprachen genügen
würde; schlimmstenfalls könnte man hier die baskischen Wörter durch
Angabe der Stellen ersetzen wo sie vorkommen (Spalte und Höhe),
also einen Index liefern wie ihn z. B. Dillmanns Äthiopisches Wörter-
buch hat. Weit näher läge es ja an das „deutsche Wortverzeichnis"
der ersten Ausgabe von Körtings Lat.-rom. Wtb. zu erinnern, aber
hier war die Sache dadurch sehr vereinfacht dafs jeder Artikel
des Wörterbuchs selbst beziffert ist. — Von dem Einflufs dieser
Übelstände können auch die folgenden Ausführungen nicht ver-
schont geblieben sein, um so weniger als ich das Werk noch nicht
Wort für Wort, nicht einmal Seite für Seite durchgenommen, sondern,
um möglichst rasch den Fachgenossen Kunde von ihm zu geben,
darin nur hin- und hergeblättert habe.
Über die so schwierige Frage der Rechtschreibung, und zwar
einer für alle Mundarten einheitlichen wird sich A. in der „Ein-
leitung" ausführlich äufsern. Ich folge seinem System noch bevor
er es gerechtfertigt hat, setze also z. B. auch -nb- und -np- an
Stelle des gewöhnlichen -trtb- und -mp-. In unaufhörliche, aber
fast unvermeidliche Inkonsequenzen ist er beim s. ü — u verfallen;
er schreibt z. B. s. bürü, bürühas u. s. w. neben dem buru, buruhas
u.s.w. der andern Mdd., aber unter burudun, lurugogor u. s. w.
wird s. bürädün, bürügogor u. s. w. mitverstanden.
A. hat sich nicht durchaus innerhalb des engsten Kreises der
Lexikographie gehalten; die Eingänge zu den einzelnen Buchstaben
haben ihn zu grammatischen Analysen veranlafst, und in der für
den Schlufs aufgesparten „Einleitung" sollen offenbar die gesamten
Tatsachen der baskischen Sprache (auch die bisher so vernachlässigte
Betonung) vorgeführt und beleuchtet werden. Als ich A.s grofse
Grammatik von 1891 in die Hände bekam, flöfste mir die eigen-
artige Kraft mit der er den schwierigen Stoff erfafst, durchdrungen
und geordnet hatte, Bewunderung ein (s. Ltbl. f. g. u. r. Ph. XV, 238),
und ich sagte mir, wenn eine so fruchtbare Ackerkrume den Samen
unserer Methodik aufnähme, würde das eine gute Ernte ergeben. Einige
Zitate (sogar eines aus Pauls Prinzipien) und gewisse Bemerkungen
(wie über den „agglutinierenden" Charakter des Baskischen S. XXIIIf.,
über die „falsche Analogie" in auiilin S. noab u. s. w.) zeigen
zwar dafs ihn keine Vorurteile zurückhalten, dafs sein Sinn für das Neue
aufgeschlossen ist; aber sie genügen nicht um erkennen zu lassen dafs
er wirklich mit der heutigen Sprachwissenschaft in breitere und innigere
Fühlung getreten ist; vielleicht hat er das auch gar nicht erstrebt.
Unter dem Gewände des Baskologen blickt doch bei jeder Gelegen-
heit der Baskophile hervor, der schon jetzt an eine künftige baskische