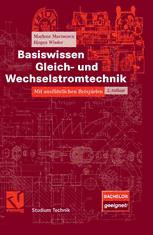Table Of ContentMarlene Marinescu
Jürgen Winter
Basiswissen
Gleich- und
Wechselstromtechnik
Literatur
für das Grundstudium
Vieweg Handbuch Elektrotechnik
herausgegeben von W. Böge und W. Plaßmann
Formeln und Tabellen Elektrotechnik
herausgegeben von W. Böge und W. Plaßmann
Elemente der angewandten Elektronik
von E. Böhmer, D. Ehrhardt und W. Oberschelp
Elemente der Elektronik – Repetitorium
und Prüfungstrainer
von E. Böhmer
Grundzusammenhänge der Elektrotechnik
von H. Kindler und K.-D. Haim
Aufgabensammlung Elektrotechnik 1 und 2
von M. Vömel und D. Zastrow
Elektrotechnik für Ingenieure in 3 Bänden
von W. Weißgerber
Elektrotechnik für Ingenieure – Klausurenrechnen
von W. Weißgerber
Elektrotechnik für Ingenieure – Formelsammlung
von W. Weißgerber
Elektrotechnik
von D. Zastrow
Elektronik
von D. Zastrow
vieweg
Marlene Marinescu
Jürgen Winter
Basiswissen
Gleich- und
Wechselstromtechnik
Mit ausführlichen Beispielen
2., überarbeitete Auflage
Mit 217 Abbildungen
Studium Technik
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
1. Auflage September 2005
2.,überarbeitete Auflage 2007
Alle Rechte vorbehalten
© Friedr. Vieweg & Sohn Verlag | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2007
Lektorat: Reinhard Dapper
Der Vieweg Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media.
www.vieweg.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung:Ulrike Weigel, www.CorporateDesignGroup.de
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Wilhelm &Adam, Heusenstamm
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
Printed in Germany
ISBN 978-3-8348-0344-3
V
Vorwort
Das vorliegendeBuch ist hervorgegangenaus zwei Lehrbu¨chern,die im Vieweg
VerlaginderReiheuniscripterschienensind: Gleichstromtechnik.Grundlagen
”
und Beispiele“ und Wechselstromtechnik. Grundlagen und Beispiele“. Es ist
”
gleichermaßenals Lehrbuch und Arbeitsbuch mit vielen ausf¨uhrlichen Beispie-
len und Aufgaben konzipiert.
Aufgrund seiner Kompaktheit ist es besonders fu¨r Studierende der Bachelor-
Studieng¨ange an Fachhochschulen und technischen Universit¨aten, die in den
ersten Semestern die Grundlagen der Elektrotechnik lernen, geeignet. Auch
in der Praxis stehenden Ingenieuren kann dieses Buch zum Auffrischen ihrer
Grundkenntnisse u¨ber elektrische Schaltungen helfen.
Die beiden erw¨ahnten Bu¨cher wurden vollst¨andig u¨berarbeitet, der Stoff etwas
gestrafft, alle Bilder gem¨aß der geltenden DIN-Normen und VDE-Vorschriften
neu erstellt.
Wir freuen uns, dass unser Buch jetzt in der 2. Auflage erscheint und wir
somit die notwendigen Korrekturen durchfu¨hren und Anregungen unserer
Leser beru¨cksichtigen konnten.
DieGleichstromtechnikwirdindiesemBuchausdidaktischenGru¨ndenausfu¨hr-
lich behandelt: Der Zugang zu der fu¨r die Praxis sicher wichtigeren, aber auch
komplizierteren Wechselstromtechnik wird fu¨r den Anf¨anger sehr viel einfa-
cher,wenn er alle Methoden der Schaltungstechnik erstbei Gleichstromkreisen
verstehtund lernt.Fast alleBerechnungsmethodenk¨onnendann auf die Wech-
selstromtechnik u¨bertragenwerden.Der fortgeschritteneLeserkannsichjedoch
auch direkt mit dem Teil III: Wechselstromkreise befassen.
Zum Verst¨andnis der Gesetzm¨aßigkeiten der Gleichstromkreise sind lediglich
elementare mathematische Kenntnisse erforderlich: solide Kenntnisse der Al-
gebra, vor allem der Bruchrechnung und einige Kenntnisse u¨ber Matrizen und
lineareGleichungssysteme.Die Arbeit mit den Studierenden zeigte uns jedoch,
dasstrotzderrelativenEinfachheitderBegriffeunddesmathematischenWerk-
zeugs das Lernen der Gleichstromtechnik einen nicht unerheblichen Aufwand
verlangt. Man muss viel u¨ben, bis man ein Gefu¨hl fu¨r elektrische Schaltungen
bekommt.
Um Wechselstromaufgaben l¨osen zu k¨onnen, muss man neben Algebra,
Trigonometrie und lineare Gleichungssysteme vor allem den Umgang mit
komplexen Zahlen gut beherrschen. Viele dieser mathematischen Aufgaben
werden heute von Taschenrechnern gel¨ost, was dem Anwender eine erhebliche
Zeitersparnis bringt.
VI
Bei der Darstellung der Grundlagen der Wechselstromtechnik wird in diesem
BuchbesondererWertauf dasVerst¨andnis der physikalischenZusammenh¨ange
gelegt. So wird zun¨achst der Behandlung der Sinusstromkreise im Zeitbereich
vielAufmerksamkeitgewidmetund erstdannwirdzu den symbolischen“ Ver-
”
fahren u¨bergegangen. Damit wird besonders die physikalische Bedeutung von
Zeigern und komplexen Zahlen betont.
Der Aufbau des Stoffes fu¨hrt den Leser schrittweise und leicht verst¨andlich
an die Berechnungsmethoden der Sinusstromnetzwerke heran, die ein vertie-
fendes Studium verschiedener Kapitel der Wechselstromtechnik erm¨oglichen.
Viele Behandlungsverfahren werden dabei vom Gleichstrom auf Wechselstrom
u¨bertragen, ohne die bekannten Begriffe nochmals zu erl¨autern. Lediglich die
UnterschiedezwischenGleich-undWechselstromwerdendetailliertdargestellt.
Spezielle Kapitel der Wechselstromtechnik (mehrphasige Systeme, Zweitor-
theorie, Ortskurven,nichtsinusf¨ormigeVorg¨angeu.a.) geh¨oren nicht mehr zum
grundlegenden Basiswissen der Schaltungstechnik. Ihre Behandlung wu¨rde
den Rahmen dieses Buches sprengen. Der interessierte Leser findet dazu
eine umfangreiche fortfu¨hrende Literatur, zu deren Verst¨andnis er nach der
Bearbeitung dieses Buches den Schlu¨ssel besitzen wird.
Mit diesem Buch m¨ochten wir unseren Lesern die M¨oglichkeit geben, sich
die grundlegenden Methoden zur Analyse von Schaltungen zu erarbeiten
und diese sicher anzuwenden. Dies erfordert selbstst¨andiges U¨ben, wozu wir
motivieren m¨ochten: Das Buch stellt zahlreiche Beispiele mit ausfu¨hrlicher
Erl¨auterung des L¨osungsweges zur Verfu¨gung. Zus¨atzlich bietet es U¨bungs-
aufgaben, deren ausfu¨hrliche L¨osungen im Internet unter http://app.gwv-
fachverlage.de/tu/1y zu finden sind.
Ein Lehrbuch u¨ber die Grundlagen der Elektrotechnik, die in vielen Bu¨chern
auf den unterschiedlichsten Ebenen behandelt wurden, kann nicht v¨ollig neu
sein. Die fremden Quellen, aus denen dieses Buch sch¨opft, sind im Literatur-
verzeichnis angefu¨hrt; dort findet der Leser auch andere Werke, die ihm zum
Verst¨andnis und zu seiner Fortbildung helfen k¨onnen.
Wir danken dem Vieweg Verlag fu¨r die gute Zusammenarbeit, vor allem Herrn
T.Zipsnerfu¨rdiewertvollenAnregungen,diezurVerbreitungdesBuchesmaß-
geblich beigetragen haben.
Unseren Lesern wu¨nschen wir viel Freude mit diesem Buch. Wir hoffen,
ihnen alle Chancen gegeben zu haben, sich das Basiswissen u¨ber Gleich- und
Wechselstromtechnik anzueignen.
Frankfurt und Ru¨sselsheim, im August 2007 Marlene Marinescu
Ju¨rgen Winter
VII
Inhaltsverzeichnis
I. Grundlegende Begriffe 1
1. Strom und Spannung 2
1.1. Der elektrische Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1. Stromst¨arke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2. Stromdichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.3. Stromarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2. Elektrische Spannung und Energie . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1. Elektrische Feldst¨arke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2. Leitf¨ahigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.3. Elektrische Spannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.4. Elektrische Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.5. Elektrische Leistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
II. Gleichstromkreise 10
2. Die Grundgesetze 11
2.1. Der Stromkreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2. Das Ohmsche Gesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3. Der elektrische Widerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.1. Berechnung von Widerst¨anden . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.2. Lineare und nichtlineare Widerst¨ande, differentieller
Widerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3.3. Temperaturabh¨angigkeit von Widerst¨anden . . . . . . . 15
2.4. Erste Kirchhoffsche Gleichung (Knotengleichung) . . . . . . . . 17
2.5. Zweite Kirchhoffsche Gleichung (Maschengleichung) . . . . . . 19
3. Reihen– und Parallelschaltung 24
3.1. Reihenschaltung von Widerst¨anden . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.1. Gesamtwiderstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.2. Spannungsteiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
VIII Inhaltsverzeichnis
3.1.3. Vorwiderstand (Spannungs–Messbereichserweiterung) . 28
3.2. Parallelschaltung von Widerst¨anden . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2.1. Gesamtleitwert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2.2. Stromteiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.3. Nebenwiderstand (Strom–Messbereichserweiterung) . . 33
3.3. Vergleich zwischen Reihen- und Parallelschaltung . . . . . . . . 34
3.4. Gruppenschaltungen von Widerst¨anden . . . . . . . . . . . . . 36
3.5. Schaltungssymmetrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4. Netzumwandlung 40
4.1. Umwandlung eines Dreiecks in einen Stern . . . . . . . . . . . . 41
4.2. Umwandlung eines Sterns in ein Dreieck . . . . . . . . . . . . . 45
5. Lineare Zweipole 52
5.1. Z¨ahlpfeile fu¨r Spannung und Strom . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.2. Spannungsquellen und Stromquellen . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.2.1. Spannungsquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.2.2. Stromquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.2.3. Innenwiderstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.2.4. Kennlinienfelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.3. Aktive Ersatz–Zweipole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.3.1. Ersatzspannungsquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.3.2. Ersatzstromquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.3.3. Vergleich zwischen Ersatzspannungs– und Ersatzstrom-
quelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.3.4. Die S¨atze von den Zweipolen (Th´evenin–Theorem und
Norton–Theorem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.4. Leistung an Zweipolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.4.1. Leistungsanpassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.4.2. Wirkungsgrad, Ausnutzungsgrad . . . . . . . . . . . . . 73
5.4.3. Leistung, Spannung und Strom bei Fehlanpassung . . . 74
6. Nichtlineare Zweipole 79
6.1. Kennlinien nichtlinearer Zweipole . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.2. Reihen– und Parallelschaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.3. Netze mit nichtlinearen Zweipolen . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7. Analyse linearer Netze 86
7.1. Anwendung der Kirchhoffschen Gleichungen . . . . . . . . . . . 86
7.2. U¨berlagerungssatz und Reziprozit¨atssatz . . . . . . . . . . . . . 89
7.2.1. U¨berlagerungssatz(SuperpositionsprinzipnachHelmholtz) 89
7.2.2. Reziprozit¨ats–Satz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.3. Topologische Grundbegriffe beliebiger Netze . . . . . . . . . . . 94
Inhaltsverzeichnis IX
7.4. Maschenstromverfahren (Umlaufanalyse) . . . . . . . . . . . . . 97
7.4.1. Unabh¨angige und abh¨angige Str¨ome . . . . . . . . . . . 97
7.4.2. Aufstellung der Umlaufgleichungen . . . . . . . . . . . . 100
7.4.3. Regeln zur Anwendung des Maschenstromverfahrens . . 103
7.4.4. Beispiele zur Anwendung des Maschenstromverfahrens . 104
7.5. Knotenpotentialverfahren (Knotenanalyse). . . . . . . . . . . . 110
7.5.1. Abh¨angige und unabh¨angige Spannungen . . . . . . . . 110
7.5.2. Aufstellung der Knotengleichungen . . . . . . . . . . . . 111
7.5.3. Regeln zur Anwendung der Knotenanalyse. . . . . . . . 114
7.5.4. Beispiele zur Anwendung der Knotenanalyse . . . . . . 115
7.6. Zusammenfassung: Analyse linearer Netzwerke . . . . . . . . . 121
7.6.1. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
7.6.2. Die Kirchhoffschen Gleichungen (Zweigstromanalyse) . . 123
7.6.3. Ersatzspannungsquelle und Ersatzstromquelle . . . . . . 124
7.6.4. Der U¨berlagerungssatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
7.6.5. Maschenstromverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7.6.6. Knotenpotentialverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
7.7. Design von Gleichstromkreisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
III. Wechselstromkreise 138
8. Grundbegriffe der Wechselstromtechnik 139
8.1. Warum verwendet man Wechselstrom? . . . . . . . . . . . . . . 139
8.2. Kennwerte der sinusf¨ormigen Wechselgr¨oßen . . . . . . . . . . . 141
8.2.1. Wechselgr¨oßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
8.2.2. Sinusgr¨oßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
9. Einfache Sinusstromkreise im Zeitbereich 147
9.1. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
9.2. Ohmscher Widerstand R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
9.3. Induktivit¨at und Kapazit¨at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
9.4. Ideale Induktivit¨at L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
9.5. Ideale Kapazit¨at C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
9.6. Ohmsches Gesetz bei Wechselstrom . . . . . . . . . . . . . . . . 154
9.7. Kirchhoffsche S¨atze fu¨r Wechselstromkreise . . . . . . . . . . . 155
9.8. Schaltungen von Grundelementen . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
9.8.1. Reihenschaltung R und L . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
9.8.2. Reihenschaltung R und C . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
9.8.3. Reihenschaltung R, L und C . . . . . . . . . . . . . . . 160
9.9. Kennwerte der Sinusstromkreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
9.9.1. Impedanz und Phasenwinkel . . . . . . . . . . . . . . . 163
9.9.2. Resistanz und Reaktanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
X Inhaltsverzeichnis
9.9.3. Admittanz und Phasenwinkel . . . . . . . . . . . . . . . 165
9.9.4. Konduktanz und Suszeptanz . . . . . . . . . . . . . . . 165
9.9.5. Zusammenfassung und Diskussion der Kennwerte einfa-
cher Sinusstromkreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
9.10.Leistungen in Wechselstromkreisen . . . . . . . . . . . . . . . . 168
9.10.1. Leistung bei idealen Schaltelementen R, L und C . . . . 168
9.10.2. Wechselstromleistung allgemein . . . . . . . . . . . . . . 171
9.10.3. Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor. . . . 172
10.Symbolische Verfahren zur Behandlung von Sinusgr¨oßen 178
10.1.Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
10.2.Zeigerdarstellung von Sinusgr¨oßen . . . . . . . . . . . . . . . . 179
10.2.1. Geometrische Darstellung einer Sinusgr¨oße . . . . . . . 179
10.2.2. Grundschaltelemente in Zeigerdarstellung . . . . . . . . 181
10.2.2.1. Ohmscher Widerstand . . . . . . . . . . . . . . 181
10.2.2.2. Ideale Induktivit¨at . . . . . . . . . . . . . . . . 182
10.2.2.3. Ideale Kapazit¨at . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
10.2.3. BehandlungvonSinusstromkreisenmitderZeigerdarstel-
lung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
10.3.Komplexe Darstellung von Sinusgr¨oßen. . . . . . . . . . . . . . 187
10.3.1. Darstellung einer Sinusgr¨oße als komplexe Zahl . . . . . 188
10.3.2. Anwendung der komplexen Darstellung in der Wechsel-
stromtechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
10.3.3. Komplexe Impedanzen und Admittanzen . . . . . . . . 194
10.3.4. Komplexe Leistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
10.3.5. Die Grundschaltelemente in komplexer Darstellung . . . 198
11.Sinusstromnetzwerke 202
11.1.Allgemeines, Kirchhoffsche Gleichungen . . . . . . . . . . . . . 202
11.2.Reihen- und Parallelschaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
11.2.1. Reihenschaltung, Spannungsteiler . . . . . . . . . . . . . 204
11.2.2. Parallelschaltung, Stromteiler . . . . . . . . . . . . . . . 210
11.2.3. Kombinierte Schaltungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
11.3.Netzumwandlung bei Wechselstrom . . . . . . . . . . . . . . . . 220
11.3.1. Bedingung fu¨r Umwandlungen . . . . . . . . . . . . . . 220
11.3.2. Die Umwandlung Dreieck-Stern . . . . . . . . . . . . . . 221
11.3.3. Die Umwandlung Stern-Dreieck . . . . . . . . . . . . . . 223
11.4.Besondere Wechselstromschaltungen . . . . . . . . . . . . . . . 224
11.5.Schwing- (oder Resonanz-) Kreise . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
11.5.1. Verlustlose Schwingkreise . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
11.5.2. Verlustbehaftete Schwingkreise . . . . . . . . . . . . . . 227
11.6.Aktive Ersatz-Zweipole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
11.6.1. Die S¨atze von den Ersatzquellen (Th´evenin, Norton) . . 230