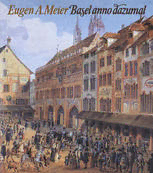Table Of ContentBugen A. Meier
1JaJe/ anno Oazuma/
ISBN 978-3-0348-6730-6 ISBN 978-3-0348-6729-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-0348-6729-0
Inhaltsverzeichnis
Zum Geleit 5 Der Fischmarktbrunnen 7 2
Basel im letzten Jahrhundert 6 Vor dem Spatentor 74175
Das Augustinerkloster 11 Der Spatenschwibbogen 76
Der Münsterplatz 12 Das Leimentor 7 8 I 79
Base/141 15 Das Kornhaus 80
Das Münster 16 Familienkonzert 82 I 83
Das Stadtcasino 18 I 19 Das Spatentor 84
Die Rittergasse 20 Das Fröschenbollwerk 86I 8 7
Der St.-Alban-Schwibbogen 22 I 23 Die Rittergasse 88
Das St. -A lban-Tor 24 Das Stachelschützenhaus 90 I 91
Die St.-Alban-Kirche 26127 Die Predigerkirche 92
Das Tor zur Dompropstei 28 Das Zeughaus 94 I 95
Der Zimmereiplatz Paravicini 30I 31 Der Schneiderhof 96
Der Aeschenschwibbogen 32 Der Französische Bahnhof98/99
Die Blömleinkaserne 34135 Der St. -johanns-Schwibbogen 100
Das Aeschentor 36 Das <grüne Basel> 102 I 103
Die Luftmatt 38I 39 Die Eisengasse 104
Die Barfosserkirche 40 Die Meerenge 1061107
Der Barfusserplatz 42143 Crossbasler Rheirifassade 108
Das Rathaus 44 Die Hochschule 110/111
Der Marktplatz 46147 Die Schiffleutenzunft 112
Die mittlere Freie Strasse 48 Kleinbasler Brückenkopf 114 I 115
Die untere Freie Strasse 50! 51 Der Hären 116
Das Kaufhaus 52 Das Kleinbasler Richthaus 118/119
Der Fronfastenmarkt 54 I 55 Die St.-Clara-Kirche 120
Der Elisabethengottesacker 56 Das Klingentalkloster 122 I 123
Die Kapelle zu St. Elisabethen 58159 Das Bläsitor 124
Der Birsigeirifluss 60 Das Riehentor 1261127
Die Stadtmauer beim Steinentor 62 I 63 Basler Küche 128
Die Schmiedenzurift 64 Der Surinam 130 I 131
Gant in der Schmiedenzunft 66/67 Nachwort des Autors 132
Das Pfrundhaus 68 Bildverzeichnis 132
Der Markgräflerhof 70171 Quellenverzeichnis 132
Zum Geleit
Basel hat im Laufe der Jüngsten Zeit unwiederbringlich einzigartige Bau
substanz verloren: Über 200 Zeugen einer denkwürdigen Vergangenheit sind spurlos aus
dem charaktervollen Weichbild verschwunden. Es war nicht nur reines Profitdenken, das
den Untergang vieler schöner Häuser, die der Bevölkerung das Gefühl der Geborgenheit und
stiller Zufriedenheit vermittelten, vorangetrieben hat. Auch die sprichwörtliche Wohlha
benheit der Bürger erlaubte es, sich dauernd nach derModeder Architektur und der Technik
zu richten und dem Kleid der Stadt sozusagen täglich neue Accessoires zu verpassen.
<Basel ist eine Wunderstadt, drinnen die Reichen leichter in den
Himmel kommen, als Kamele durchs Nadelöhr>, artikulierte 1844 ein aufmerksamer
Kritikus. Der herbe Spott galt den Promotoren der Industrie, die der wirtschaftlichen
Entwicklung unseres Gemeinwesens neue Maßstäbe gesetzt hatten. Die 1812 vor dem
Riehentor in Betrieb genommene erste chemische Fabrik hatte der Textilindustrie den Weg
zur <Diversifikation> geebnet, und der 1845 vor dem St.-Johanns-Tor eröffnete erste Bahn
hof auf Schweizer Boden verkündete schliesslich unmissverständlich und unabwendbar
den Aufbruch einer neuen Zeit. 1859 verabschiedete der Grosse Rat das <Gesetz über
die Erweiterung der Stadt>, welches die Regierung ermächtigte, <die Stadtgräben aufzu
füllen und neue Stadteingänge herzustellen, auch die bisherigen Stadtmauern und
Schanzen ganz oder teilweise zu beseitigen>. Und nach wenigen Jahren blieben von der
gigantischen Stadtbejestigung, die mit ihren 7 Toren, 40 Türmen, 42 Letzen und 1099
Zinnen der Einwohnerschaft seit 1398 sichern Schutz boten, nur noch wenige Zeugen
einer stolzen Vergangenheit: Wohlhabenheit und Technik hatten ihren Tribut gefordert!
Ich bin erfreut, dass Eugen A. Meier in diesem prächtigen Bildband dasAlte
Basel in seinem aussergewöhnlichen Charme wieder aufleben lässt und an die Beschaulich
keit vergangener Zeiten erinnert. Sein 14. Basler Buch soll keine Anklage sein, sondern
wiederum Einblick in die wechselvolle Geschichte unserer Stadt gewähren. Wenn wir uns
dabei die Erkenntnis vor Augen halten, dass nicht die Vergangenheit und die Zukunft an der
Geschichte zu studieren sind, sondern die Gegenwart, dann bringt uns< Baselanno dazumal>
auch einen beglückenden Gewinnfür unser tägliches Leben. Und dafur wollen wir dankbar
sezn.
Dr. Edmund Wyss, Regierungspräsident
Basel im Ietztenjahrhundert
Das Erste) was Einem beim Eintritt in Basel auffällt) ist der Ausdruck von
Traurigkeit und Öde) der Allem aufgedrükt ist. Wer hat unsre lustigen Städte Frankreichs
durchreist und gedenkt nicht ihrer belebten Vorstädte) ihrer Brunnen von plaudernden M äg
den umringt) ihrer Balkone mit hübschen Kindern beladen) welche neugierig schauen) ihrer
Fenstermitjungen Stikerinnen besezt) deren Nadel erhoben bleibt) sobald das Geräusch eines
Fuhrwerkes die Fenster klirren macht. Nichts von alle dem in Basel. Beim Lärm Eures
Wagens schliesst man die Laden und Thüren) die Frauen verbergen sich. A lies ist todt und
öde; man sollte glauben) die Stadt wäre zu vermiethen. Man darfjedoch nicht glauben) dass
die freiwillige Gefangenschaft der Baslerinnen etwa ein Beweis sei von einem gänzlichen
Mangel an Neugierde; aber sie haben Mittel gefunden) diese mit ihrer Sprödigkeit zu verei
nigen. Spiegel) mit Geschik an den Fenstern angebracht) gestatten ihnen zu sehen) was
draussen vorgeht) ohne selbst gesehen zu werden. - Wenn aber auch die Strassen Basels
traurig zu durchwandern sind, so ist es dagegen unmöglich) von ihrer ausgezeichneten Rein
lichkeit eine richtige Vorstellung zu geben. Da ist keine Spalte) kein Riss) kein Fleken zu
sehen aufa llen diesen in Öl gemalten Mauern) kein Sprung in allen diesen Gittern von wun
derbarer Arbeit) welche die untern Fenster schüzen. Die Sommerbänke neben der Thür
schwelle sind sorgfältig in der Mauer befestiget zum Schuz gegen Regen und Sonne. Bildet
die Strasse einen zu steilen Abhang) so unterstüzen Mauedehnen die Schritte des Greises und
beladenen Landmanns. Überall findet ihr diese in )s Kleine gehende Aufmerksamkeit) diese
Beachtung der Bedürfnisse der Menge) diese Sorgfalt des Eigenthümers und des Familien
vaters. Manfuhlt es) dass in Basel nichts dem Auge der Regierung entgeht) und dass sie
jeden Abend in ihren Staaten die Runde macht. Emil Souvestre) 183 7.
Basel stellt schon in jeder Hinsicht eine selbstständigere A bgrän
zung gegen Teutschland dar als Schajfhausen) und hält die schweizerische Eigenthümlich
keit mit einer Starrheit fest) als käme es in diesem Punkte recht darauf an) den Gegensaz
gegen den teutschen Charakter zu behaupten. In Basel) wie sehr es auch gegenfrühere Zeiten
an Leben und Bevölkerung verloren) liegt doch noch aller Reichthum und aller Stolz der
ganzen Schweiz aufgestapelt) und selbst das aristokratische Bern hat nie mit dem Patri-
6
zierthum Basels an Gewalt und Glanz wetteifern können. Stolz und ernst, wie das Münster
von Basel, ist anscheinend der Charakter der Einwohner. Wenn man dort durch die stillen
Strassen wandelt und im grünen Rheine das Spiegelbild verfolgt, welches die malerisch
umher gestreuten Häuser hineingeworfen haben, fohlt man sich von einem träumerischen
Quietismus urrifangen, der die Atmosphäre der ganzen Stadt zu bilden scheint. Aber wie
überall, so macht sich auch gleich der Gegensaz geltend, und mit dem Pietismus und Quietis
mus contrastirt in dieser Stadt der colossalste Luxus, schimmerndes Wohlleben und prun
kender Genuss des Augenblikes. Theodor Mundt, 1839.
Aufd er rechten Seite der Rheinbrücke bemerkt man ein kleines Kapellchen,
jetzt zur A ujbewahrung von Brückenbaugeräthschaften bestimmt. Hier wurden zur Zeit der
Gottesurtheile und der Hexenprozesse die Unglücklichen in das Wasser geworfen und bei
der jetzigen Rheinschanze (St. Thomasthurm) wieder aufgefangen. Hier wurden auch
nach der Reformationszeit die liederlichen Dirnen und Ehebrecher unter Volksgedränge zur
Busse hingeführt. Bis hieher reichten auch an der Fastnachtzeit die grotesken Tänze der
sogenannten Ehrenzeichen der Kleinbasler, welche bis 1830 fortdauerten. Es waren drei
Männer, von denen der eine das Wappen der Gesellschaft zum Rehhause in einer Löwen
maske, der andere der Gesellschaft zum Greifen in einer Greifenmaske, der dritte der Gesell
schaft zur Hären in einer Wildenmanngestalt trug. Sie durchzogen in Begleitung von Pfei
fen und Trommeln die kleine Stadt bis an dieses Joch und belustigten dann durch ihre Spässe
die Mahlzeiten der drei Gesellschaften auf den ihnen eigenthümlichen Häusern. Auch die
Gesellschaften der Vorstädte des grösseren Basels hatten bis 1798 ähnliche lebendige Mas
ken und Umzüge. Von allem diesem sind jetzt nur die auf den meisten Zünften üblichen
Aschermittwochsmahlzeiten übrig geblieben, an welchen goldene Zunftbecher eberifalls in
Gestalt ihrer Wappen ( z. B. eines Schlüssels, Bären, Lilie u. s. w.) herumkreisen und dann
dieZünftemit ihren Fahnen und Trommeln einanderBesuche abstatten. Wie zu London und
andern Orten, wo noch Zunftrechte gelten, müssen alle Bürger ohne Ausnahme in einer der
16 Zünfte eingeschrieben sein, ohne dass desshalb fur sie irgend eine Verpflichtung zu dem
betreffenden Berufe hervorginge. Diese Zünfte und Gesellschaften besitzen beträchtliches
sowohlliegendes als angelegtes Vermögen, aus dessen Zinsen die jährlichen Mahlzeiten, so
wie auch Unterstützungen von wohlthätigen Anstalten bestritten werden. -Man zählt in
Basel19 Gasthöfe, 160 Weinhäuser und Schenken, 10 Bierbrauereien und 6 Kaffeehäuser,
10 Köche und Traiteurs, aber keine eigentliche Restauration. Das häusliche Leben der
Einwohner kann allein diese Missverhältnisse gegen andere Städte gleicher Bevölkerung
erklären. Eben so der Umstand, dass viele eigene Badstuben besitzen, den Mangel an iiffent
lichen warmen Bädern, deren es nur 3 innerhalb der Stadt giebt. Wegen der Menge der
7
eigenen Luxuspferde (man zählt circa 3-400) können auch 3 Bereiter und 16 Lohnkut
scher nur mühsam bestehen. Banquiers zählt man 8, Fabrikanten und Crosshändler bei 100,
Makler (Sensalen oder Courtiers genannt) 14. Ausser diesen hat manfur den kleinern
Verkehr noch etliche (sogenannte) Geschäftsmänner und ein allgemeines Berichthaus.
Notare gibt es 18, aöer Advokaten nur 5 (und auch diese sind meist zugleich Notare), weil
es wenige Prozesse gibt, welches nicht nur dem versöhnlichen Charakter und der Scheue vor
Zeitverlust, sondern auch dem einfachen, bifdrderlichen und nicht kostspieligen Rechtsgan
ge zuzuschreiben ist. 24 Arzte, 11 Wundärzte und Barbiere, 8 Apotheken mögen von dem
sanitarischen, 8 Buchdruckereien, 5 Buch- und 4 Kunsthändler, 1 Antiquar von dem litera
rischen Verkehr einen Begriff geben. - Das in Basel cursirende Geld ist französische,
Reichs-und Schweizermünze. Grösseres Geld aus entfernlern Staaten, z. B. Sachsen, Preus
sen, Holland u.s. w. kann nur mit Verlust angebracht werden, Scheidemünze gar nicht. -Im
Handel und Wandel rechnet man nach Schweizerfranken zu 100 Rappen oder 10 Batzen.
Ein solcher Franken ( nichtfranc) ist gleich 40 Kreuzer rheinisch oder 30 sols altfranzösi
scher oder 1 franc 50 centimes neu-französischer Währung. Papiergeld hat in Basel gar
keinen Curs. Nur in grösseren Gasthöfen und bei den Banquiershäusern Passavant, Ehinger,
von Speyr, Merian-Forkart u.sj liessesich solches anbringen. In der innern Schweiz muss
man sich noch weit grössere Abzüge gefallen lassen. - A ufenthaltskosten: In den Gast
höfen 3 Königen und Storchen eine Mahlzeit 3 franz. francs, eine dito auf dem Zimmer
Jr.,
5 ein Kaffefrühstück 1-11f2 fr., ein Zimmer, je nach der Lage, 1, 11f2, 2 frs. Im
Wildenmann, Krone, Kopf, Schwanen ein Viertheil oder Dritttheil weniger. Ein zwei
spänmgßr Wagen pr. Tag 18fcs., pr. halben Tag 9-10fcs. Bei Einladungen in
Privathäusern ist es üblich, insofern fremde Weine aufgetragen werden, ein Trinkgeld
(meist von 5 Batzen) in die Küche zu verabreichen; eben so viel dem Kutscher, wenn
der Fremde auf ein Landhaus zu Tische abgeholt oder spazieren gefuhrt wird. Bei grös
seren Festlichkeiten natürlich etwas mehr. Ferdinand Röse, 1840.
Die Häuser Basels, durchschnittlich drei bis vier Stockwerke
hoch, waren früher durch ihre Sauberkeit und Nettigkeit berühmt. Noch jetzt wird viel
daraufg ehalten, damit sowohl Ausseres als Inneres ein anständigesAussehen habe. Es gibt
Häuser, in denen entsetzlich viel gescheuert und geputzt wird. Dagegen lässt die Reinlich
keit der Strassen viel zu wünschen übrig, da es durchaus an einer von Stadt wegen eingerich
teten Anstalt zur Kehrung derselben mangelt. -Das gesellschaftliche Leben Basels steht
auch nicht im besten Rufe, und man hört selten einen Fremden, der nicht über Langeweile
klagt. Allerdings Basel ist keine Stadtfur vornehme Müssiggänger und Pflastertreter; es ist
eine Stadt der Arbeit, wo man mehr an Geschäfte als an Vergnügungen denkt. Indessen
8