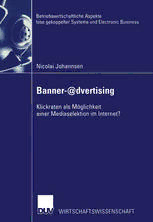Table Of ContentNicolai Johannsen
Banner-@dvertising
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT
Betriebswirtschaftliche Aspekte
lose gekoppelter Systeme und Electronic Business
Herausgegeben von
Prof. Dr. Sönke Albers,
Prof. Dr. Birgit Friedl,
Prof. Dr. Daniel Klapper,
Prof. Dr. Joachim Wolf
Institut für Betriebswirtschaftslehre,
Christian-Aibrechts-Universität zu Kiel
Prof. Dr. Udo Konradt .·
Institut für Psychologie,
Christian-Aibrechts-Universität zu Kiel
ln der Schriftenreihe werden Ergebnisse von Forschungsarbeiten ver
öffentlicht, die sich in herausragender Weise mit Fragen des Manage
ments lose gekoppelter Systeme, virtueller Unternehmen und elektro
nischen Geschäftsprozessen beschäftigen. Die Reihe richtet sich an
Leser in Wissenschaft und Praxis, die Anregungen für die eigene Ar
beit und Problemlösungen suchen. Sie ist nicht auf Veröffentlichungen
aus den Instituten der Herausgeber beschränkt.
Nicolai Johannsen
Banner-@dvertising
Klickraten als Möglichkeit
einer Mediaselektion im Internet?
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Sänke Albers
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz fur diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhăltlich
Dissertation Universităt Kiel, 2001
1. Auflage Mai 2002
Alle Rechte vorbehalten
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
UrsprGnglich erschienen bei Deutscher Universităts-Veriag GmbH, Wiesbaden, 2002
Lektorat: Ute Wrasmann / Brit Voges
www.duv.de
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschutzt.
Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulăssig und strafbar. Das gilt insbe
sonde re fUr Vervielfăltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wăren und daher von jedermann benutzt werden dUrften.
Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt/Main
ISBN 978-3-8244-0645-6 ISBN 978-3-663-09337-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-09337-4
Geleitwort
Während in der realen Welt versucht worden ist, die Wirkung von Werbeschaltungen über
das Lese- und Zuschauerverhalten zu messen, lässt sich dieses im Internet viel einfacher und
direkter erheben. Man kann nämlich die Anzahl der Personen messen, die auf Werbung in
Form von Bannern klickt und sich damit ein Produktangebot näher anschaut. Damit stellt sich
die bedeutende Frage, ob die Klickraten von der Art der Werbung abhängen und damit prog
nostiziert werden können, was die Gestaltung der Online-Werbung wesentlich erleichtern
würde. Johannsen hatte die Möglichkeit, einen sehr großen Datensatz mit etwa 30.000 Ban
ner-Schaltungen einer namhaften Multimedia-Agentur daraufhin untersuchen zu können, wo
von Klickraten abhängen.
Nach einer Beschreibung der Grundlagen der Mediaplanung im zweiten Kapitel mit spe
ziellem Fokus auf das Internet referiert Johannsen im dritten Kapitel den Stand der wissen
schaftlichen Diskussion, wovon Klickraten abhängen können und wie wichtig diese Einfluss
faktoren sind. Er zieht dazu zunächst theoretische Überlegungen heran und stellt dann die
Ergebnisse von empirischen Studien dar. Die Ergebnisse unterscheidet er danach, inwieweit
das Responseverhalten bzw. die Awarenessbildung als Ziel angegeben waren.
Im vierten Kapitel wird das Design der empirischen Untersuchung dargestellt. Da die bis
her publizierten Studien meist auf kleinen Stichproben basieren und die Auswertung nicht
über Mittelwertvergleiche hinausgehen, will Johannsen nun mit Hilfe eines sehr großen Sam
pies statistisch fundiert die Bedeutung von Einflussfaktoren herausfinden. Insbesondere geht
er dabei auf die eingesetzten Methoden der linearen Regressionsanalyse, der Clusteranalyse,
der logistischen Regression, der klassenweisen Regression und besonders der Mixture Reg
ression Models ein.
Herzstück seiner Untersuchung ist die empirische Auswertung eines Datensatzes von etwa
140 Mio. Adimpressions aus fünf Monaten, die sich auf etwa 30.000 Tages-Datensätze redu
zieren und sich auf ca. 2.000 Kampagnen beziehen, die später die Basis der Auswertung bil
den. Da sich die Verläufe der Klickraten über die Zeit als stochastisch darstellen und durch
die variablen Zeiten unzureichend erklärt werden können, bildet Johannsen durchschnittliche
Klickraten pro Kampagne und untersucht diese dann auf ihre Einflussfaktoren. Die etwa
2.000 Fälle wertet er dann mit Hilfe der Regressionsanalyse aus. Am besten schneidet dabei
ein multiplikativ verknüpftes Modell ab, das nach Transformation in die Logarithmen mit
Hilfe linearer Ansätze geschätzt worden ist. Dabei kann er allerdings nur etwa 20% der Vari
anz aufklären. In inhaltlicher Hinsicht erzielen Flash-Banner gegenüber normalen Html
Bannern eine größere Werbewirkung. Die Klickrate nimmt zu, je aggressiver der Banner
gestaltet ist. Positiv wirkt auch die Themenaffinität des Banners zu der Seite. Erstaunlicher
weise wirkt eine Vergrößerung der Fläche nicht positiv auf die Klickratc. Auf reichweiten
starken Seiten fällt die Klickrate geringer aus, weil vermutlich kein zielgruppengenaues Tar-
VI
geting möglich ist. Hohe Klickraten werden insbesondere auf Ergebnisseiten von Suchma
schinen und Verzeichnissen erzielt.
Die geringe Erklärungskraft seines Modells hängt damit zusammen, dass offenbar in der
Stichprobe Gruppen existieren, auf die die Einflussfaktoren unterschiedlich wirken. Um die
ses analysieren zu können, wendet er Mixture Models an, mit denen eine simultane Segmen
tierung des Datensatzes und eine Analyse der Werbewirkung durchgeführt werden kann. In
haltlich kommt dabei heraus, dass Pauschaleffekte sehr selten sind. Bisher geäußerte Vermu
tungen erweisen sich als zutreffend für einige Segmente, allerdings nicht für andere und kön
nen dann pauschal nicht mehr nachgewiesen werden. So entpuppen sich flash-animierte Ban
ner auf Lebensumfeldseiten als überlegen, während sonst eher andere Bannertypen geeigneter
sind. Insgesamt kann Johannsen bestätigen, dass aggressivere Banner stärkere Klickreaktio
nen hervorrufen und Themenaffinität entscheidend für den Werbeerfolg ist. Mit diesem Mo
dellansatz erzielt er eine erklärte Varianz von 40 %.
Will man diese Ergebnisse für die Werbeplanung benutzen, so spielt weniger die Erklärung
der Klickraten durch Einflussfaktoren eine Rolle. Vielmehr ist die Prognosegüte entschei
dend. Diese bestimmt er, indem er das Erklärungsmodell nur auf der Basis eines Teils der
Beobachtungen schätzt und dann das gefundene Modell auf die restlichen Fälle anwendet.
Dabei stellt er fest, dass es außer dem Verfahren der simultanen Segmentierung und Werhe
wirkungsanalyse keinem anderen Modell gelingt, die naive Mittelwertschätzung-Prognose zu
übertreffen.
Johannsen erzielt sehr interessante Ergebnisse. In inhaltlicher Hinsicht kann er feststellen,
dass Banner Eigenschaften nicht überall effektiv sind. Vielmehr kommt es sehr auf die Ein
bindung der Banner in die Website an. Diese Resultate sind aber nicht so stabil, dass wesent
lich bessere Prognosen als durch eine Mittelwertschätzung erzielt werden. Auf Grund des sehr
großen Sampies sind diese Aussagen von hoher Bedeutung für die Forschung, aber auch für
Praktiker, die sich für eine Verbesserung ihrer Onlinewerbung interessieren. In methodischer
Hinsicht ist bemerkenswert, dass Johannsen neben einfachen Regressionen auch Mixture Mo
dels rechnet, mit denen man eine simultane Segmentierung und Werbewirkungsanalyse
durchführen kann. Insgesamt liegt eine Arbeit vor, die in einem sehr neuen Gebiet des Mar
keting fundierte Ergebnisse vorlegt, die von hohem Interesse für die Forschung und für die
Praxis sind. Ich wünsche deshalb der Arbeit weite Verbreitung.
Prof. Dr. Sönke Albers
Vorwort
Die Jahre des ungebremsten Intemet-Hypes sind vorbei und zunehmend wird Wert darauf
gelegt, Prozesse nach Kosten zu optimieren und effizienter zu gestalten. Gerade der Bereich
der Online-Werbung durchläuft zur Zeit eine Phase der Konsolidierung, so dass der Bedarf an
neuen Lösungsansätzen hier besonders groß ist.
Die vorliegende Arbeit soll in diesem Zusammenhang einen methodischen Beitrag zu
Möglichkeiten der automatisierten Mediaselektion liefern. Es werden verschiedene multivari
ate Methoden vorgestellt und angewandt, um Werbewirkungsfunktionen zu ergründen. Sie
werden genutzt, um Werbeträger in eine Rangreihe absteigender erwarteter Werbeeffizienz zu
ordnen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den neuartigen Methoden der Mixture
Regression Models, welche, wie sich zeigt, die besten Ergebnisse liefern.
Ermöglicht wurde diese empirische Arbeit durch die Online Mediaagentur PLAN.NET aus
München. Jene stellte nicht nur ihre Kampagnendaten über einen Zeitraum von fast einem
halben Jahr zur Verfügung, sondern eröffnete auch den Zugang zu ihrer Werbeträgerdaten
bank und ihrem breiten Know-How in Sachen Mediaplanung. Mein Dank für diese tatkräftige
Unterstützung geht stellvertretend für die vielen hilfreichen Hände an Wolfgang Bscheid,
Oliver Gertz, Sigi Hinterwinkler und Michael Messerschmidt.
Auf uni versitilrer Seite ist diese Arbeit im Graduiertenkolleg "Betriebswirtschaftliche As
pekte lose gekoppelter Systeme im Zeitalter elektronischer Medien" verankert und hat da
durch vielseitigste Impulse erhalten. Insbesondere verdankt sie viel meinem akademischen
Lehrer und Sprecher des Graduiertenkollegs Prof. Dr. Sönke Albers, der mich unermüdlich
durch konstruktive Gespräche und anregende Kommentare inspirierte und vorantrieb. In die
sem Rahmen möchte ich meinen Dank auch an Prof. Dr. Dr. hc. Hauschild, Prof. Dr. Klapper
und Prof. Dr. Müller richten, die mich durch mein Graduiertenstudium begleiteten und mit
mir in meiner Disputation ein freundliches Streitgespräch führten.
Mit besonders herzlichem Dank erwähne ich meine Kolleginnen und Kollegen vom Gra
duiertenkolleg sowie vom Lehrstuhl für Innovation, Neue Medien und Marketing. Ihre fachli
chen und menschlichen Bereicherungen haben wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beige
tragen. An erster Stelle möchte ich Prof. Dr. Karen Gedenk Dank sagen, die mir gerade in der
schwierigen Anfangsphase mit Rat und Tat zur Seite stand. Beispielhaft für alle anderen Kol
legen danke ich an dieser Stelle Jörn Bartels, Ingo Garczorz, Heike Hoffmann, Markus Ho
renburger, Borris Orlikowski, Gregor Panten, Claudius Paul und Björn Schäfers. Mein Dank
gebührt ebenso Anette Hinz, Timo Emcke und Stefan Wende, welche die zahllosen "Kleinig
keiten" regelten, die mein Vorankommen sonst jedoch wesentlich erschwert hätten. Und
selbstverständlich möchte ich meinem Bürokollegen Jan Becker danken, der stets für eine
musikalische Untermalung in unserem Büro sorgte.
VIII
Wärmsten Dank schulde ich jedoch meinen Eltern und meiner Freundin Imke, die mich in
meinen Vorhaben stets und bedingungslos unterstützten, so das ich meine Promotion ohne
nennenswerte Tiefen abschließen konnte. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet. Und natürlich
meinem Bruder Matthias, der mir stets vor Augen führte, dass es immer noch etwas Wissens
wertes hinter dem eigenen Horizont gibt. Möge diese Arbeit also an dem gemessen werden,
was sie beinhaltet, und weniger an dem, was ihr fehlt!
Nicolai Johannsen
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ........................................................................................................................ 1
1.1 Problemstellung ............................................................................................................. 2
1.2 Ziele der Arbeit ............................................................................................................. 4
1.3 Aufbau der Arbeit ......................................................................................................... 5
2 Gnmdlagen der Mediaplanung .................................................................................. 7
2.1 Bestimmung der Werbeziele ......................................................................................... 8
2.2 Werbebudgetfestlegung ............................................................................................... 10
2.3 Mediaselektion ............................................................................................................ 11
2.3.1 Vorgehensweise der Mediaselektion .................................................................... 12
2.3.2 Vorstellung der einer Mediaselektion zugrundeliegenden Modelle .................... 15
2.3.2.1 Lineare Optimierungsmodelle ....................................................................... 16
2.3.2.2 Heuristische Verfahren ................................................................................. 16
2.3.2.3 Evaluierungsmodelle ..................................................................................... 18
2.3.3 Beurteilung der vorgestellten Mediaselektionsmodelle ....................................... 19
2.3.4 Status Quo der Mediaplanung im World Wide Web ........................................... 20
2.4 Werbemittelerstellung ................................................................................................. 22
2.4.1 Werbeformen im Internet.. .................................................................................... 23
2.4.1.1 Schaltflächen ................................................................................................. 24
2.4.1.1.1 Statische Banner. .................................................................................... 26
2.4.1.1.2 Animierte Banner ................................................................................... 27
2.4.1.1.3 Rich Media Banner ................................................................................ 27
2.4.1.1.4 Platzierung der Banner .......................................................................... 31
2.4.1.2 lnterstitials ................................................................................................... .32
2.4.1.3 Weitere Werbeformen ................................................................................... .34
2.4.1.4 Ausblick ........................................................................................................ .36
2.4.2 Prozess der Bannererstellung ............................................................................... 36
2.5 Werbeschaltung .......................................................................................................... .38
2.5.1 Technische Abwicklung der Schaltung ................................................................ 39
2.5.2 Grundlagen der Gestaltung von Anzeigenpreisen im Internet.. ........................... 41
2.5.2.1 Pauschalpreise ............................................................................................. .42
2.5.2.2 Leistungsbezogene Preise ............................................................................ .43
2.5.2.3 Alternative Preisgestaltung .......................................................................... .44
X
2.6 Werbeeffizienzmessung .............................................................................................. 44
2.6.1 Grundlagen der qualitativen Messung der Werbewirkung .................................. 46
2.6.2 Grundlagen der quantitativen Messung der Werbewirkung ................................ 49
2.6.3 Maßzahlen ............................................................................................................ 50
2.6.3.1 Basisgrößenfür Kontaktmaße ....................................................................... 51
2.6.3.2 Basisgrößen für Interaktivitätsmaße .................................. , .......................... 52
2.6.3.3 Kontaktkennzahlen ....................................................................................... ,54
2.6.3.4 Interaktivitätskennzahlen ............. , ................................................................ 55
2.6.4 Datenerhebung .................................................................................. , .................. 56
2.6.5 Technische Grenzen der Datenerhebung ............................................................. 61
3 Stand der wissenschaftlichen Diskussion ................................................................ 63
3.1 Theoretische Bezugspunkte der Werbewirkung ......................................................... 63
3.1.1 Involvement der Empfänger ................................................................................ 64
3.1.2 Beeinflussungsmodalität Sprache oder Bild ........................................................ 66
3.1.3 Zahl der Wiederholungen .................................................................................... 68
3.2 Empirische Studien ..................................................................................................... 68
3.2.1 Studien zum Responseverhalten .......................................................................... 69
3.2.2 Studien zur Awarenessbildung ............................................................................ 71
3.2.3 Zusammenfassende Betrachtung ......................................................................... 75
3.3 Erkenntnisse für die vorliegende Untersuchung ......................................................... 80
4 Darstellung des Untersuchungsdesigns ................................................................... 83
4.1 Forschungsansatz ........................................................................................................ 83
4.1.1 Anforderungen an ein Mediaselektionstool ......................................................... 83
4.1.2 Vorgehensweise zur Schätzung von Klickraten .................................................. 85
4.2 Bestimmung der Werbewirkungsfunktionen .............................................................. 86
4.2.1 Regressionsanalytische Modeliierung des Wirkungszusammenhanges .............. 86
4.2.2 Trennung erfolgreicher von nicht erfolgreichen Schaltungen ............................. 90
4.2.3 Untersuchung von Heterogenität im Datenmaterial ............................................ 94
4.2.3.1 Hierarchische Klassifizierungsverfahren ...................................................... 96
4.2.3.2 Partitionierende Klassifizierungsverfahren .................................................. 99
4.2.3.3 Verfahrensauswahl ........................................................................................ 99
4.2.4 Berücksichtigung der Heterogenität der Werbewirkungsfunktionen ................ 100
4.3 Prognose zukünftiger Kampagnenergebnisse ........................................................... 106
4.3.1 Prognosebeurteilung anhand der prognostizierten Klickraten ........................... 107
4.3.2 Prognosebeurteilung anhand der prognostizierten Rangreihe ........................... 108
4.3.3 Prognosebeurteilung im Vergleich zu anderen Verfahren ................................. 109