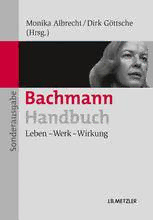Table Of ContentBachmann-
Monika Albrecht /
Dirk Göttsche (Hrsg.)
Handbuch
Leben – Werk – Wirkung
Sonderausgabe
Verlag J.B. Metzler
Stuttgart · Weimar
Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek © 2013 Springer-Verlag GmbH Deutschland
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Ursprünglich erschienen bei J. B. Metzler’sche
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet Verlag GmbH in Stuttgart 2013
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.metzlerverlag.de
ISBN 978-3-476-02513-5 [email protected]
ISBN 978-3-476-01241-8 (eBo ok)
DOI 10.1007/978-3-476-01241-8
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts-
gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmun-
gen und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort VII III. Kontexte und Diskurse in
Bachmanns Werk 211
I. Grundlagen 1 1. Bachmann und die Philosophie 212
1. Leben und Werk im Überblick – eine 1.1. Existentialphilosophie und Existentialis-
Chronik 2 mus 212
2. Rezeptionsgeschichte 22 1.2. Sprachphilosophie und poetologische
2.1. Rezeptionsgeschichte zu Lebzeiten 22 Sprachreflexion 214
2.2. Rezeptionsgeschichte seit Bachmanns 1.3. Kritische Theorie und Soziologie 216
Tod 26 1.4. Religion 218
2.3. Literarische Rezeption 35 1.5. Bachmanns Utopiebegriff 220
3. Editionsgeschichte und Nachlaß 42 2. Psychologie, Psychoanalyse und Psychiatrie in
Bachmanns Werk 223
II. Das Werk 47 3. Bachmann und die Zeitgeschichte 237
1. Jugendwerke 48 3.1. Nationalsozialismus 237
2. Lyrik 53 3.2. Die Entwicklung der Nachkriegsgesell-
2.1. Frühe Gedichte 53 schaft 246
2.2. Die gestundete Zeit 57 3.3. Der kulturgeschichtliche Umbruch von
2.3.Anrufung des großen Bärenund 1968 252
Gedichte aus dem Umfeld 67 3.4. Postkolonialismus und Kritischer
2.4.Späte Gedichte 78 Exotismus 255
3. Hörspiele 83 4. Literarische Kontexte, Dialoge und
4. Libretti 97 Lektüren 259
5. Erzählprosa 105 4.1. Deutschsprachige Literatur des 18. und
5.1.Frühe Erzählprosa 105 19. Jahrhunderts 259
5.2.Das dreißigste Jahrund Erzählfragmente 4.2. Europäische Literatur vor 1900 263
aus dem Umfeld 112 4.3. Klassische Moderne 270
5.3.Todesarten-Projekt 127 4.4. Deutschsprachige Literatur nach
5.3.1. Überblick 127 1945 282
5.3.2. Malina 130 4.5. Bachmann und die ›Weltliteratur‹ ihrer
5.3.3. Das Buch Franza 144 Zeit 292
5.3.4. Andere unvollendete Todesarten- 5. Bachmann und die Musik 297
Texte 152
5.4.Simultanund Erzählfragmente aus dem Anhang 309
Umfeld 159 1. Siglenverzeichnis (mit Sigle zitierte
6. Künstlerische und journalistische Prosa 172 Ausgaben) 310
7. Kritische Schriften 184 2. Andere Ausgaben und Hilfsmittel 311
7.1.Philosophische Essays und Disserta- 3. Ausgewählte Sekundärliteratur 312
tion 184 3.1. Sammelbände 312
7.2.Musikästhetische Essays 188 3.2. Monographien und Aufsätze 312
7.3.Literaturkritische Essays und 4. Werkregister 317
Frankfurter Vorlesungen 191 5. Personenregister 322
8. Übersetzungen 204 6. Mitarbeiter 329
Vorwort
Nachdem die vierbändige Ausgabe der »Werke« zwischen Literatur, Philosophie, Psychologie und
(1978) erstmals einen zusammenhängenden Musik begründet sind, aber auch die historisch-
Überblick über Ingeborg Bachmanns Werk und kritische Revision der verfügbaren Nachlaßtexte
erste Einblicke in ihren literarischen Nachlaß tragen ebenso zu diesem Umbruch bei wie der
ermöglicht hatte, ist es im Gefolge einer neuen literaturwissenschaftliche Methodenwandel, der
feministischen Lektüre in den frühen 1980er Jah- neue Lektürerahmen geschaffen hat. Zugleich ist
ren geradezu zu einer »Bachmann-Rennaissance« die Textgrundlage in den letzten Jahren sukzessiv
gekommen (Stephan et al. 1987, S.8), die bis durch neue Quellenfunde und -publikationen er-
heute anhält. Seither hat die Literaturwissen- gänzt worden, die nicht zuletzt das Wissen über
schaft eine Fülle neuer Erkenntnisse zu Ingeborg die Breite der schriftstellerischen Tätigkeit Inge-
Bachmanns Werk hervorgebracht und zugleich borg Bachmanns, ihre literarische Arbeitsweise
grundlegend neue Perspektiven der Interpreta- und die konkreten Entstehungskontexte ihrer
tion erarbeitet. Nach dem frühen Ruhm der Au- Texte vertiefen. Zu nennen sind hier beispiels-
torin als »neuer Stern am deutschen Poetenhim- weise die frühe lyrische Prosa Briefe an Felician
mel« (Blöcker) in den 1950er Jahren hat eine (1991), die kritische Edition des Todesarten-Pro-
breite, lebhafte und vielschichtige Forschung in jekts (1995), die u.a. auch bis dahin unbekannte
den vergangenen zwanzig Jahren so die Ein- Nachlaßfragmente wie den ersten Todesarten-Ro-
schätzung Ingeborg Bachmanns als eine der man und den Goldmann/Rottwitz-Roman ent-
wichtigsten deutschsprachigen Autorinnen der hält, die Wiederentdeckung der bis dahin ver-
Nachkriegsjahrzehnte auf neuer Grundlage be- schollenen Römischen Reportagen(1998) für Ra-
kräftigt. Bachmanns Werk steht seitdem gleich- dio Bremen und die »Westdeutsche Allgemeine
bedeutend für seine Auseinandersetzung mit der Zeitung«, die Edition »Letzter, unveröffentlichter
– wie sie es nannte – »Krankheit unserer Zeit« Gedichte« (1998) sowie weiterer bislang unver-
(GuI, 72), mit der sozialen Gewalt der modernen öffentlichter Gedichtentwürfe aus den 1960er
westlichen Gesellschaft, mit dem verborgenen Jahren unter dem Titel »Ich weiß keine bessere
Zusammenhang zwischen patriarchalischer Ge- Welt« (2000). Inzwischen ist im Nachlaß von Jörg
sellschaftsstruktur, katastrophischer Geschichte Mauthe, Bachmanns Kollegen aus ihrer Zeit bei
(Nationalsozialismus) und Unterwerfung bzw. dem amerikanischen Besatzungssender Rot-
Ausgrenzung des anderen (bis hin zum Neokolo- Weiß-Rot (1951–1953) ein Teil von Bachmanns
nialismus). Die fortdauernde Brisanz dieser Pro- Beiträgen zu der Sendereihe Die Radiofamilie
blemstellungen und die Reflektiertheit ihrer lite- aufgefunden worden (McVeigh 2002), und es ist
rarischen Darstellung sichern ihrem Werk zwei- zu hoffen, daß weitere Nachlaßpublikationen und
fellos seine anhaltende Bedeutung. Quellenfunde folgen. Darüber hinaus liefern Zi-
Angesichts des wachsenden Abstands von der tate aus dem unveröffentlichten Nachlaß und aus
Entstehungszeit der Texte zeichnet sich seit eini- diversen Korrespondenzen wertvolle neue Hin-
ger Zeit allerdings ein Forschungsumbruch ab, weise zum Verständnis von Leben und Werk, und
der die Begründung der fortdauernden Relevanz das vorliegende Handbuch fügt hier noch einiges
von Bachmanns Werk mit einer deutlicheren Hi- hinzu. Solche Editionen und ›Neuentdeckungen‹
storisierung im Sinne einer Neubewertung ihres ergänzen nicht nur die Materialgrundlage der
Oeuvres im Kontext der literarischen Nach- literarhistorischen Forschung, sie eröffnen auch
kriegsjahrzehnte verbindet. Analysen zum zeit- neue Fragestellungen und werden zweifellos eine
und diskursgeschichtlichen Kontext ihres Schrei- wichtige Rolle in der weiteren Entwicklung des
bens, die Erforschung des intertextuellen Hori- Bildes von Ingeborg Bachmann in Wissenschaft
zonts ihrer Werke, komparatistische und inter- und Öffentlichkeit spielen. Gleichwohl ist »das
disziplinäre Untersuchungen, die durch Bach- Desiderat einer kritischen Gesamtausgabe des
manns vielfältige Kontakte und Lektüren und Werks von Ingeborg Bachmann« (Bartsch 2000,
nicht zuletzt durch ihre Grenzüberschreitungen S.373) zu bekräftigen.
VIII Vorwort
Es gehört zu den Glücksfällen der Literaturwis- schließt, während der zweite ergänzend rele-
senschaft, daß das wissenschaftliche Interesse am vante Kontexte und Diskurse in Bachmanns Werk
Werk Ingeborg Bachmanns und das offenbar an- aufbereitet, die bei einer einzelwerkbezogenen
haltende Interesse einer breiten Leserschaft sich Betrachtung nicht ausreichend gewürdigt werden
seit der ›Wiederentdeckung‹ des Werks in den können.
frühen 1980er Jahren gegenseitig befruchtet ha- Ein so umfangreiches Projekt wie dieses Hand-
ben. Gleichzeitig hat die Funktion von Bach- buch kommt nicht ohne vielfältige Zusammen-
manns Werk als Kristallisationspunkt aktueller arbeit und Unterstützung zustande. In diesem
literaturwissenschaftlicher Methodendiskussion Sinne danken wir in erster Linie den Autorinnen
– insbesondere auch weiterhin im Bereich des und Autoren der Beiträge für ihre intensive Mit-
Feminismus, und nicht nur im deutschsprachigen arbeit und den Erben Ingeborg Bachmanns
Raum, sondern auch in der amerikanischen und (Isolde Moser und Dr. Heinz Bachmann) für die
französischen Germanistik – zu einer For- freundliche Erlaubnis zur Verwendung bislang
schungsproduktivität geführt, die heute für den unveröffentlichter Nachlaß- und Briefzitate. Un-
einzelnen kaum noch vollständig zu überschauen ser Dank gilt hier zugleich den Archiven, aus
ist. Vor diesem Hintergrund faßt das vorliegende deren Bestand zitiert werden durfte – der Öster-
Bachmann-Handbuch, das sowohl für die Bach- reichischen Nationalbibliothek (Wien), dem
mannforschung und die Literaturwissenschaft Deutschen Literaturarchiv (Marbach/N.), dem
allgemein als auch für eine interessierte Leser- Archiv der Akademie der Künste (Berlin), dem
schaft konzipiert wurde, das gewachsene Wissen Literaturarchiv Monacensia (München), dem Ar-
über das Werk der Autorin auf neuestem Stand chiv des Südwestdeutschen Rundfunks (Stutt-
zusammen, zieht in lesbarer Form eine kritische gart), den Verlagsarchiven Suhrkamp und Piper,
Bilanz der Forschung (und ihrer Lücken) und dem Heinrich Böll Archiv (Köln) und dem Uwe
stellt darüber hinaus neue Erkenntnisse und In- Johnson Archiv (Frankfurt/M.)–, sowie Robert
terpretationsperspektiven vor. Die einzelnen Ar- Pichl für die Benutzung seines Katalogs der Pri-
tikel versuchen also einer doppelten Aufgaben- vatbibliothek Ingeborg Bachmanns (Pichl 2003).
stellung gerecht zu werden: Sie sollen den Lese- Unserem Lektor Uwe Schweikert schließlich
rinnen und Lesern in zuverlässiger Form den danken wir für die kontinuierliche Förderung des
Wissens- und Forschungsstand zu dem jewei- Projekts von der ersten Anregung bis zur Druck-
ligen Werkkomplex oder Thema erschließen, zu- legung.
gleich aber auch die Forschung durch neue Ein- Abschließend noch einige Hinweise zur Benut-
sichten und eigene Akzentuierung vorantreiben. zung des Handbuchs: Ergänzend zum Inhaltsver-
Das Team der Autorinnen und Autoren setzt sich zeichnis erschließen ein Personen- und ein Werk-
aus etablierten und jüngeren Bachmann-Forsche- register die Gegenstände des Handbuchs. Der
rinnen und -Forschern zusammen, die ihren je- Anhang enthält darüber hinaus ein Literaturver-
weils unterschiedlichen Ansätzen entsprechend zeichnis mit den relevanten Ausgaben der Werke
auch verschiedene Perspektivierungen einbrin- Ingeborg Bachmanns sowie einer Auswahl der
gen. Es muß bei einem solchen auf Pluralität Literatur über die Autorin und ihr Werk. Mit
angelegten Konzept nicht eigens betont werden, Bezug auf dieses Literaturverzeichnis wird in den
daß die vorgetragenen Positionen nicht notwen- einzelnen Artikeln in abgekürzter Form zitiert:
dig mit denen der Herausgeber zusammenfal- Werke Ingeborg Bachmanns werden unter Ver-
len. wendung der im Ausgabenverzeichnis erläuter-
Das Handbuch hat selbstverständlich die Funk- ten Siglen zitiert; die im Anhang aufgeführten
tion eines Nachschlagewerks, es soll aber auch zu Drucke und Ausgaben werden im Literaturver-
neuer Werklektüre anregen und der Forschung zeichnis der Einzelartikel nicht nochmals aufge-
neue Impulse geben. In diesem Sinne ist es – führt. Sekundärliteratur aus dem Anhang wird im
nach dem einleitenden Überblick über Leben und Literaturverzeichnis der Einzelartikel nur in ab-
Werk, Rezeptions- und Editionsgeschichte – in gekürzter Form nach dem Muster »McVeigh
zwei Teile gegliedert, deren erster das Werk aus (2002)« zitiert und den ausführlichen bibliogra-
der Perspektive der Werkgruppen und Einzel- phischen Angaben zu weiterer Sekundärliteratur
werke (und damit auch werkgeschichtlich) er- vorangestellt.
Vorwort IX
Literatur: McVeigh (2002); Pichl (2003). Weigel (1987): Die Literatur von Frauen vor der Frau-
Kurt Bartsch (2000): Rezension [Bachmann 2000b, Al- enliteratur. Vorbemerkung. In: Stephan, Venske, Wei-
brecht/Göttsche 2000, Weigel 1999]. In: Sprachkunst gel: Frauenliteratur ohne Tradition? Neun Autorinnen-
31, S.371–380; – Günter Blöcker (1954): ›Lyrischer porträts. Frankfurt/M., S.7–9.
Schichtwechsel‹. In: Süddeutsche Zeitung, 13./14. No-
vember 1954; – Inge Stephan, Regula Venske, Sigrid Monika Albrecht und Dirk Göttsche
I. Grundlagen
2
1. Leben und Werk im Überblick – eine Chronik
Kindheit und Jugend in Klagenfurt die Personen singen sollten, also habe ich es
(1926–1945) selbst schreiben müssen.« (GuI, 124) Zu den
ältesten im Nachlaß überlieferten Texten gehören
1926 neben einer Notenschrift zahlreiche Gedichte,
Am 25. Juni 1926 wird Ingeborg Bachmann als das an Schullektüren wie Schiller und Kleist ori-
erstes Kind von Olga Bachmann (geb. Haas entierte historische Versdrama Carmen Ruidera
1901–1998) und Matthias Bachmann (1895– (1942) und die ebenfalls in den napoleonischen
1973) in Klagenfurt geboren. Ihre Mutter stammt Kriegen spielende historische Erzählung Das
aus Niederösterreich, dem östlichsten, an ›Böh- Honditschkreuz (Ende 1943), die bereits gera-
men‹ und Ungarn grenzenden Bundesland, wo dezu als ein »Werk der inneren Emigration«, als
ihre Familie eine Strickwarenerzeugung betrieb, Einspruch gegen die Volks- und Heimatideologie
ihr Vater, ein protestantischer Volksschullehrer, des herrschenden Nationalsozialismus gelesen
der an beiden Weltkriegen als Offizier teilnimmt, worden ist (Höller 1999, S.13).
aus Obervellach bei Hermagor im Gailtal im
Dreiländereck Österreich – Italien – Slowenien, 12.3. 1938
wo die Familie oft Ferien im Auszugshaus des Den Tag des Einmarsches von Hitlers Truppen in
großväterlichen Hofes verbringt. Diesen Kärnt- Klagenfurt im Rahmen des »Anschlusses« Öster-
ner Grenzraum, in dem Deutsche und Slowenen reichs an das Deutsche Reich hat Ingeborg Bach-
zusammenleben, hat Bachmann später in der mann später rückblickend zum symbolischen Be-
Nachfolge von Robert Musils utopischem ›Kaka- gründungsdatum ihrer Autorschaft erklärt: »Es
nien‹ als Inbegriff eines gewaltfreien Miteinan- hat einen bestimmten Moment gegeben, der hat
ders der Völker mythisiert, als »ein Stück wenig meine Kindheit zerstört. Der Einmarsch von Hit-
realisiertes Österreich […], eine Welt, in der lers Truppen in Klagenfurt. Es war etwas so Ent-
viele Sprachen gesprochen werden und viele setzliches, daß mit diesem Tag meine Erinnerung
Grenzen verlaufen« (W 4, 302). 1928 wird Inge- anfängt: durch einen zu frühen Schmerz, wie ich
borgs Schwester Isolde geboren, 1939 ihr Bruder ihn in dieser Stärke vielleicht später überhaupt
Heinz. Zunächst wohnt die Familie in einer nie mehr hatte.« (GuI, 111) Zwar darf diese Zu-
Wohnung in der Durchlaßstraße Nr.5, 1933 zieht spitzung nicht wörtlich verstanden werden – am
sie dann in ein eigenes Haus in der Hensel- 12. März 1938 war die Elfjährige (nach wider-
straße26. sprüchlichen Mitteilungen) entweder verreist
oder sie lag mit Diphtherie im Krankenhaus –, sie
1932–1944 bezeichnet jedoch emphatisch die moralische
1932 bis 1936 besucht Ingeborg Bachmann in Verpflichtung und zeitkritische Ausrichtung ihres
Klagenfurt die Volksschule, dann das Bundesreal- Werks als eines Schreibens nach Auschwitz, zu
gymnasium, das in ihren späteren Schuljahren im dessen ›Problemkonstanten‹ (W 4, 193) die Aus-
ehemaligen Konventgebäude der Ursulinen un- einandersetzung mit den Verflechtungen von In-
tergebracht war (von den Nationalsozialisten dividual- und Zeitgeschichte im Zeichen gesell-
1938 in »Oberschule für Mädchen« umbenannt). schaftlicher Gewalt gehört. Den frühen Eintritt
Dort legt sie am 2. Februar 1944 ihre Matura ab. des Vaters in die NSDAP (Höller 1999, S.46)
Schon in ihren Schuljahren beginnt Ingeborg wird sie dagegen ihr Leben lang nicht erwähnen,
Bachmann literarisch zu schreiben, verfaßt Ge- und sie beteiligt sich auch nicht an der in den
dichte und Prosa, komponiert Lieder und ent- sechziger Jahren einsetzenden öffentlichen Aus-
wirft Dramen. Im Rückblick hat sie die Musik an einandersetzung mit der Generation der Väter/
den Anfang ihres Schreibens gestellt: »Ich habe Täter.
als Kind zuerst zu komponieren angefangen. Und
weil es gleich eine Oper sein sollte, habe ich nicht
gewußt, wer mir dazu das schreiben wird, was