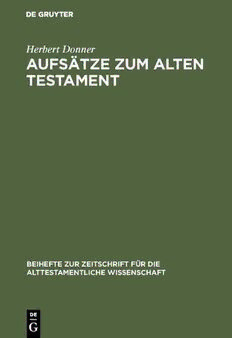Table Of ContentHerbert Donner
Aufsätze zum Alten Testament
w
DE
G
Beihefte zur Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft
Herausgegeben von
Otto Kaiser
Band 224
Walter de Gruyter • Berlin • New York
1994
Herbert Donner
Aufsätze zum Alten Testament
aus vier Jahrzehnten
Walter de Gruyter • Berlin • New York
1994
© Gedruckt auf säurefreiem Papier,
das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.
Die Deutsche Bibliothek — CIP-Einheitsaufnahme
Donner, Herbert:
Aufsätze zum Alten Testament aus vier Jahrzehnten / Herbert Donner. —
Berlin ; New York : de Gruyter 1994
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft : Beihefte ; Bd. 224)
ISBN 3-11-014097-7
NE: Donner, Herbert: [Sammlung]
ISSN 0934-2575
© Copyright 1994 by Walter de Gruyter & Co., D-10785 Berlin.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Druck: Arthur Collignon GmbH, Berlin
Buchbinderische Verarbeitung: Lüderitz & Bauer-GmbH, Berlin
Vorwort
In diesem Sammelbande sind Aufsätze zum Alten Testament aus den Jahren
1959—1992 zusammengetragen, vorwiegend solche, die ursprünglich als Bei-
träge zu Festschriften oder an nicht leicht zu erreichenden Orten veröffent-
licht wurden. Sie haben — abgesehen von ihrem Bezug auf das Alte Testament
— kein gemeinsames, übergreifendes Thema, sondern spiegeln die wechseln-
den Interessen des Verfassers in vier Jahrzehnten alttestamentlicher und
orientalistischer Arbeit: multa non multum.
Die Aufsätze sind nach der Chronologie ihrer Erscheinungsdaten angeord-
net. Nur die letzten drei stehen wegen ihrer thematischen Nähe beieinander:
in ihnen handelt es sich um Annäherungen an das Phänomen der „heiligen
Schrift" und um das Problem des vorkritischen Umgangs mit derselben. Da-
bei waren gelegentliche Wiederholungen in Kauf zu nehmen.
Zwei Arbeiten in englischer Sprache erscheinen hier erstmalig auf deutsch.
Im übrigen habe ich den Wortlaut der Texte unverändert gelassen; nur
Druckfehler sind berichtigt und einige Verweise den Seitenzahlen dieses Ban-
des angeglichen worden. Gewiß wird daraus niemand auf die Unveränderlich-
keit meines wissenschaftlichen Urteils schließen wollen. Natürlich würde ich
— vor allem im Hinblick auf die älteren Arbeiten — heute manches anders
ansehen und schreiben. Das Dies diem docet gilt nicht nur für W. Gesenius'
Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament.
Bei sechs von sechzehn Aufsätzen dieses Bandes waren neue, reproduk-
tionsfähige Vorlagen herzustellen. Für die Bewältigung dieser nicht immer
leichten Aufgabe danke ich meiner Sekretärin, Frau G. Stemke, und meinem
Mitarbeiter an der Gesenius-Arbeitsstelle der Universität Kiel, Dr. Joh. Renz.
Ohne sie hätte der Band nicht erscheinen können. Ferner danke ich dem
Herausgeber, Herrn Prof. D. Dr. Otto Kaiser, für die Aufnahme der Samm-
lung in die Reihe „Beihefte zur ZAW".
Kiel, im Januar 1994 Herbert Donner
Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
1. Art und Herkunft des Amtes der Königinmutter im Alten Testa-
ment 1
2. Der „Freund des Königs" 25
3. Adoption oder Legitimation? Erwägungen zur Adoption im Alten
Testament auf dem Hintergrund der altorientalischen Rechte . . .. 34
4. „Hier sind deine Götter, Israel!" 67
5. Die literarische Gestalt der alttestamentlichen Josephsgeschichte . . 76
6. Balaam pseudopropheta 121
7. Die Verwerfung des Königs Saul 133
8. Jesaja LVI 1—7: Ein Abrogationsfall innerhalb des Kanons — Impli-
kationen und Konsequenzen 165
9. Der Spruch über Issachar (Gen. 49,14—15) als Quelle zur Frühge-
schichte Israels 180
10. Psalm 122 189
11. „Forscht in der Schrift Jahwes und lest!" Ein Beitrag zum Verständ-
nis der israelitischen Prophetie 199
12. Der verläßliche Prophet. Betrachtungen zu I Makk 14,41 ff. und zu
Ps 110 213
13. „Wie geschrieben steht". Herkunft und Sinn einer Formel 224
14. Prophetie und Propheten in Spinozas Theologisch-politischem
Traktat 239
15. Der Redaktor. Überlegungen zum vorkritischen Umgang mit der
Heiligen Schrift 259
Quellenverzeichnis 286
Register 288
Art und Herkunft des Amtes der Königinmutter
im Alten Testament
Das Alte Testament vermittelt nur wenige, über den Zeitraum der Geschichte
des Volkes Israel von der Staatenbildung bis zum babylonischen Exil ungleich-
mäßig verstreute Angaben zum Charakter des Amtes der Königinmutter in
den Reichen Juda und Israel; es schweigt völlig auf die Frage nach seiner Her-
kunft. Die Dürftigkeit der Überlieferung ist in der Beschaffenheit der zur Ver-
fügung stehenden Quellen begründet. Hauptquelle ist das deuteronomistische
Geschichtswerk, das in den kanonischen Büchern Josua bis 2.Kön. die gesamte
Geschichte Israels von der Landnahme bis zum Untergange des Reiches Juda
586 unter dem einheitlichen theologischen und geschichtstheoretischen Ge-
sichtswinkel des Deuteronomiums zur Anschauung bringt1. Der zwischen 5622
und 539 schreibende Verfasser dieses Geschichtswerkes hat nicht ermangelt,
eine Fülle von älteren Traditionseinheiten teils erzählenden teils archivali-
schen Charakters nahezu unverändert in seine Darstellung aufzunehmen. So
unschätzbar dieses Verfahren für die Rekonstruktion des Geschichtsverlaufes
in weitestem Sinne ist, so unausbleiblich ist es auch, daß nicht alle Fragen eine
ausreichende Antwort finden können. Denn die Auswahl der mitgeteilten Ma-
terialien ist der Grundkonzeption des Verfassers dienstbar gemacht: dem
historischen Erweis des Gedankens, daß die Geschichte Israels Vollzugsort des
Gerichtes Gottes ist, daß die geschichtsbildenden Kräfte ihren Ursprung im
Verhältnis Israels zu seinem Gotte haben3. Dabei mußten Tatbestände der
Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte zur Sprache kommen, sofern sie Be-
ziehung zum Thema hatten; eine systematische Darstellung der staatlichen In-
stitutionen und Nachzeichnung ihrer Entwicklung war weder beabsichtigt noch
notwendig. Das gilt auch für das Amt der Königinmutter. Indessen entbindet
die Quellenlage nicht von der Pflicht, die einschlägigen Nachrichten zusam-
menzutragen, zu ordnen und mit dem in den letzten Jahrzehnten beträchtlich
1 Zum Problem der Einheitlichkeit vgl. M. Noth, Überlieferungsgeschichtliche
Studien 1 (1943).
2 Vgl. 2.Reg.25,27-30.
3 Vgl. die rückblickende Erörterung 2.Reg. 17,7-23.
2 Das Amt der Königinmutter im AT
gewachsenen außerisraelitischen Material zu vergleichen4. Die Aufgabe ist
umso dringlicher, als die Frage nach der Herkunft des Amtes der Königinmut-
ter durch Urkunden aus Ugarit (ras esch-schamra) neu gestellt wird und wohl
auch beantwortet werden kann.
I.
Die Könginmutter heißt im Alten Testamente HTOl Der Ausdruck bedeutet
ursprünglich „Herrin, Gebieterin, Patronin" gegenüber den Angehörigen der
„familia" in weiterem Sinne, also rechtlich beschränkten oder rechtsunfähigen
Verwandten, Hintersassen und Sklaven5. Bei der Anwendung auf die Königin-
mutter hat dieser Terminus eine Ausweitung und Umdeutung seines ursprüng-
lichen Sinnes erfahren: er ist, wie noch zu zeigen sein wird, zu einer Amtsbe-
zeichnung geworden, die an einer weitgehend außerhalb des Familienrechtes
stehenden Institution haftet6.
Daß die Königinmutter eine besondere Stellung innehatte, lehrt bereits ein
Blick auf die Exzerpte des deuteronomistischen Geschichtsschreibers aus den
Annalen der Könige von Israel und Juda. Dabei zeigt sich, daß diese Stellung
auf dynastisch gebundene Königtümer beschränkt war: bei allen Königen der
davididischen Dynastie von Rehabeam bis Zedekia sind mit zwei Ausnahmen7
Name und Herkunft der Mutter verzeichnet, während sie bei den Königen des
Nordreiches Israel fehlen8. Zweifellos bestand dieser Unterschied schon in den
4 Einen sehr verdienstvollen Versuch in dieser Richtung unternahm G. Molin, Die
Stellung der Gebira im Staate Juda. Theol. Ztschr. Basel 10 (1954), S.161ff. Durch das
Anwachsen des Materiales und durch modifizierte Fragestellungen ist jedoch an ent-
scheidenden Punkten über die von ihm ermittelten Zusammenhänge hinauszukommen.
5 Vgl. Gen.16,4.8. 2.Reg.5,3. Jes.24,2. Prov.30,23; auf Babylon als Herrin der Welt
übertragen Jes.47,5.7. Es handelt sich um die Femininform des Substantivs TDJ, das nach
Gen.27,29.37 den Inhaber derpatria potestas bezeichnet.
6 Diesem Umstände haben die LXX Rechnung getragen, indem sie ¡TTQ1 in
familienrechtlichem Sinne durch Kupia (Gen.16,4.8. 2.Reg.5,3. Jes.24,2. Prov.30,23) -
übertragen durch icrxüq und apxoucra (Jes.47,5.7) - als Bezeichnung der Königinmutter
jedoch durch ltyounewi (l.Reg.15,13), SuuacrtcuoüaT) (2.Reg.lO,13; mißverstanden auch
Jer.13,18) oder ßaaiXiaonr) (Jer.36,2 = 29,2) übersetzen.
7 Jehoram 2.Reg.8,16-24 und Ahas 2.Reg.l6. Molin, a.a.O., S.164 äußert die Vermu-
tung, daß die Trägerinnen der Würde einer ¡TT11 vor dem Regierungsantritt ihrer Söhne
verstorben waren.
8 Der einzige Beleg für !TP3a auf dem Territorium des Nordreiches (2.Reg.lO,13)
gehört in den Zusammenhang der Dynastie Omris, der einzigen neben der Dynastie des
Jehu, die sich über mehrere Generationen in Israel gehalten hat. Der Ausdruck begegnet
dort überdies im Munde judäischer Prinzen. Zur unterschiedlichen Ausprägung des