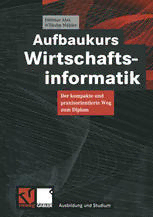Table Of ContentDietmar Abts
Wilhelm Mülder
Aufbaukurs
Wirtschaftsinformatik
Die Bücher der Reihe .Ausblldung und Studium" bieten praxlsorlentlene Einführungen für die
Aus-und Weiterbildung sowie Bausteine für ein erfolgreiches berufsqualilbierendes SlUdium.
Unler anderem sind erschienen:
Studien-und Fonchunpfl!It,. ..
Infonnatlk .n Facltltoctlacltulen
von Ralner Bischoff (Hrsg.)
Turbo 1'11_1 WecwelHr flir Aueblldun, und Studium
von Ekkehard Kaler
DeIphi Eaaentl. ..
von Ekkehard Kater
ProcrammleNn mit Fortran 90
von Hans-Peter BIIumer
W1rtaehafbm.tltem.tIk mit dem Comput. ..
von Hans Denker
D.t.nb.nk-EnJlnHl'iIll
von AI fI'1ld Moos und Gerha rd Daues
Vllu.1 Baale Eaaentla"
von Ekkehard Kaler
Exeel für Betrlebawlrt.
von RObert Horvat und Kamblz Koochakl
GNndkuna WIrtlChaftainform.tlk
von Dletmar Abts und Wllhelm ltilder
Pr.ktlsch. Sy.tamproarammleNIII
von Helmut Weber
Inpnleurmatllematlk
mit Comput.ralpbr..ayatem.n
von Hans Denker
ExeelfürTechnlkerund Inpnleure
von Hans-jUrgen Holland und Uwe Demhardl
R.latlon.l. . und obJ.lcnlatlon.l. . 8QL
von Wolf-Michael Kähler
Ko.t.nlt.lI.nrKhnun, mit SApe R/3·
von Franz KI nger und Ellen Falk Kalms
Theori. und Pre.le r.latlonaler D"nbanken
von Rene Stelner
OBERON
von B. Marincek,I.L. Marais und E. ZeJler
Studl.nfQhrer Wlrtaeh.ftalnfonnetlk
von Peler Mertens, Peler ehamonl, Dieler Ehrenberg,
loachlm GrIese, Lutz I. Heinrich und Karl Kurbel (Hrsg.)
ElnfühNn, In UNIX
von Wemer Brechl
GNndkuna JAVA
von Dletmar AbiS
ObJ.kt.ort.ntl.rt. ProarammleNn., In JAVA
von OUo Rauh
PL/I fürWorkltatloftll
von Eberhard Sturm
Effektiv Proarammleren In C und C++
von Dletmar Herrmann
Modul., KI ....n , V.rlr'i,.
von Karlheinz Hug
Aufbaukuna Wlrtaeheftalnform.tlk
von Dlelmar AbiS und Wilhelm MllIder
Dietmar Abts
Wilhelm Mülder
Aufbaukurs
Wirtschafts
informatik
Der kompakte und praxisorientierte Weg
zum Diplom
m
vleweg GABLER
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhältlich.
Alle Rechte vorbehalten
© Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 2000
Der Verlag Vieweg ist ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlieh ge
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Ur
heberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig
und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Ver
arbeitung in elektronischen Systemen.
httP//www.vieweg.de
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Höchste inhaltliche und technische Qualität unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der
Produktion und Auslieferung unserer Bücher wollen wir die Umwelt schonen: Dieses
Buch ist auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die Einschweißfolie
besteht aus Polyäthylen und damit aus organischen Grundstoffen, die weder bei der
Herstellung noch bei der Verbrennung Schadstoffe freisetzen.
Konzeption und Layout des Umschlags: Ulrike Weigel, www.CorporateDesignGroup.de
Gedruckt auf säurefreiem Papier
ISBN 978-3-528-05592-9 ISBN 978-3-322-91607-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-91607-5
Vorwort
So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig,
man muss sie für fertig erklären, wenn
man nach Zeit und Umständen das
Möglichste getan hat.
J. W. Y. Goethe, Italienische Reise,
Caserta, den 16. März 1787
(Goethe bezieht sich auf die Bearbeitung
seines Schauspiels "Iphigenie auf Tauris".)
Aufbauend auf unserem einführenden Lehrbuch "Grundkurs Wirtschafts
informatik", im gleichen Verlag erschienen, behandeln wir in diesem Buch
aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik , wie sie z.B. im Hauptstudium des
Studiengangs Wirtschaftsinformatik an Universitäten, Fachhochschulen,
Berufsakademien und anderen Fort- und Weiterbildungsinstituten angeboten
werden. Wir haben dabei den Schwerpunkt gelegt auf den Anwen
dungsbezug und die praktische Umsetzbarkeit der von uns vorgestellten
Konzepte.
Dieses Lehrbuch eignet sich sowohl zum Vertiefen und Nachschlagen von
Vorlesungen und Seminaren als auch zum Selbststudium. In jedem Kapitel
behandeln wir die wichtigsten Grundbegriffe, zeigen die Zusammenhänge zu
anderen Themenbereichen der Wirtschaftsinformatik auf und erläutern die
Thematik anhand von Anwendungsbeispielen. Als zusätzliche Lernhilfe
enthält jedes Kapitel Kontrollfragen und Aufgaben mit Lösungen, die es
unseren Leserinnen und Lesern ermöglichen, sich auf Klausuren und
Prüfungen im Fach Wirtschaftsinformatik vorzubereiten. Die Lösungshinweise
befinden sich am Ende des Buches in Kapitel 9. Zur Vertiefung finden unsere
Leserinnen und Leser im Literaturverzeichnis am Schluss des Buches
zahlreiche weiterführende Quellen. Das Sachwortverzeichnis erleichtert das
Querlesen und gezielte Nachschlagen.
Das Buch ist in Teamarbeit entstanden. Insbesonders danken wir den
Studierenden an der Fachhochschule Niederrhein in Mönchengladbach für die
konstruktiven Diskussionsbeiträge und kritischen Anmerkungen zu den
v
V01WOrt
frühen "Betaversionen" der einzelnen Kapitel. Gleichzeitig bitten wir aber
auch unsere Leserinnen und Leser, Anregungen und Verbesserungsvorschläge
an die folgenden E-Mail-Adressen zu senden:
[email protected]
[email protected]
Unsere Arbeit ist damit erst einmal beendet. Zum Schluss möchten wir uns
ganz besonders bei unserem studentischen Mitarbeiter Herrn Michael Lankes
bedanken, der zahlreiche Abbildungen in sorgfältiger Arbeit erstellt hat. Wir
danken Herrn Dr. Klockenbusch vom Vieweg-Verlag, der uns zu diesem
Buchprojekt angeregt hat und mit Geduld die von uns mehrmals nach hinten
korrigierte Zeitplanung ertragen hat.
Ratingen und Essen, im Januar 2000 Dietrnar Abts
Wilbelrn Mülder
VI
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ................................................................................................... 1
2 Internet - Technik, Dienste und Anwendungen ................................. 9
2.1 Einleitung .......................................................................................... 10
2.2 Technische Grundlagen ................................................................... 13
2.3 Dienste im Internet. .......................................................................... 19
2.3.1 Telnet und FTP ................................................................................. 19
2.3.2 E-Mail und News .............................................................................. 21
2.3.3 Zeitgleiche Kommunikation ............................................................. 26
2.3.4 World Wide Web .............................................................................. 28
2.4 Sicherheit .......................................................................................... 34
2.4.1 Verschlüsselung ................................................................................ 35
2.4.2 Schutzmaßnahmen .......................................................................... .44
2.5 Anwendungen .................................................................................. 48
2.6 Fragen und Aufgaben ...................................................................... .58
3 Datenmodelle und Datenbanken .......................................................... 61
3.1 Einleitung .......................................................................................... 62
3.2 Datenmodelle ................................................................................... 63
3.2.1 Das Entity-Relationship-Modell ........................................................ 65
3.2.2 Das Netzwerkmodell ........................................................................ 70
3.2.3 Das Relationenmodell ...................................................................... 71
3.3 Relationale Datenbanksysteme ........................................................ 79
3.3.1 Aufbau und Aufgaben eines Datenbanksystems ............................. 79
3.3.2 Anforderungen an relationale Datenbanksysteme .......................... 84
3.3.3 Die Datenbanksprache SQL ............................................................. 85
3.4 Datenintegrität .................................................................................. 99
3.5 Transaktionen ................................................................................. 103
3.6 Zugriffskontrolle ............................................................................. 110
3.7 Entwicklung von Datenbankanwendungen .................................. 114
VII
Inhaltsverzeichnis
3.8 Verteilte Systeme ............................................................................ 119
3.8.1 SeIVer-Datenbanksysteme .............................................................. 120
3.8.2 Verteilte Datenbanksysteme ........................................................... 123
3.9 Objektorientierte Datenbanksysteme ............................................. 127
3.10 Fragen und Aufgaben ..................................................................... 131
4 Objektorientierte Software-Entwicklung ........................................... 135
4.1 Grundkonzepte der Objektorientierung ........................................ 136
4.2 Objektorientierte Entwicklungsmethoden ..................................... 144
4.3 Ein Anwendungsbeispiel in Java ................................................... 150
4.4 Fragen und Aufgaben ..................................................................... 167
5 Dokumenten-und Workflow-Management ....................................... 171
5.1 Einige Anwendungsbeispiele ......................................................... 172
5.2 Dokumenten-Management-Systeme ............................................... 177
5.2.1 Aufgaben und Vorteile eines DMS ................................................. 178
5.2.2 Der Archivierungsprozess ............................................................... 180
5.2.3 Systemkonzepte .............................................................................. 191
5.2.4 Rechtliche Aspekte beim Einsatz von DMS ................................... 196
5.3 Workflow-Management- Systeme .................................................... 199
5.3.1 Begriffsabgrenzung ......................................................................... 200
5.3.2 Leistung und Ziele .......................................................................... 204
5.3.3 Workflow-Modellierung ................................................................. 206
5.3.4 Komponenten eines Workflow-Systems ........................................ 213
5.3.5 Ausblick .......................................................................................... 215
5.4 Fragen und Aufgaben ..................................................................... 217
6 Managementunterstützungssysteme ................................................... 219
6.1 Die Ausgangslage ........................................................................... 219
6.2 Begriff, Klassifikation und Architektur. .......................................... 221
6.2.1 Begriff und historische Entwicklung .............................................. 221
6.2.2 Klassifikation von Managementunterstützungssystemen ............... 224
6.2.3 Architektur von Managementunterstützungssystemen .................. 227
6.3 Data Warehouse ............................................................................. 231
VIII
6.3.1 Begriff, Ziele und Merkmale des Data-Warehouse-Konzepts ....... 231
6.3.2 Aufbau eines Data Warehouse ....................................................... 234
6.3.3 Datenbasis für ein Data Warehouse .............................................. 236
6.3.4 Datenübernahme ............................................................................ 241
6.3.5 Datentransformation ....................................................................... 242
6.3.6 Meta-DatenvelWaltung ................................................................... 248
6.3.7 Praktische Anwendungsbeispiele ................................................... 250
6.4 Online Analytical Processing .......................................................... 252
6.4.1 Begriff ............................................................................................. 252
6.4.2 Anforderungen an OLAP ................................................................ 253
6.4.3 Mehrdimensionalität ....................................................................... 256
6.4.4 Modellierung multidimensionaler Datenstrukturen ....................... 258
6.4.5 Realisierung von OLAP ................................................................... 260
6.5 Data Mining .................................................................................... 261
6.5.1 Grundlagen ..................................................................................... 261
6.5.2 Methoden des Data Mining ............................................................ 263
6.5.3 Anwendungsbereiche ..................................................................... 266
6.6 Business Intelligence ...................................................................... 268
6.7 Fragen und Aufgaben ..................................................................... 269
7 Electronic Commerce ............................................................................ 271
7.1 Merkmale von E-Commerce ........................................................... 271
7.2 Formen kommerzieller Web-Auftritte ............................................ 275
7.2.1 Unterteilung nach Interaktivität und Informationsgehalt .............. 275
7.2.2 Unterteilung nach Art der beteiligten Geschäftspartner.. .............. 280
7.3 Geschäftsmodelle bei E-Commerce ............................................... 282
7.3.1 Einnahmenmodelle ......................................................................... 283
7.3.2 Organisationsmodelle ..................................................................... 286
7.4 E-Commerce im Bereich Business-to-Business .............................. 289
7.4.1 Von EDI zu Web-EDI ..................................................................... 289
7.4.2 Geschlossene Benutzergruppen ..................................................... 296
7.4.3 Bezugsquellendienste ..................................................................... 298
7.4.4 Support- und Service-Systeme ....................................................... 299
7.5 Produktspektrum für E-Commerce ................................................ 299
7.5.1 Produkteignung für E-Commerce .................................................. 300
IX