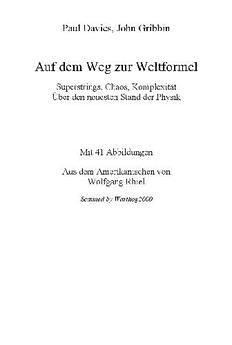Table Of ContentPaul Davies, John Gribbin
Auf dem Weg zur Weltformel
Superstrings, Chaos, Komplexität
Über den neuesten Stand der Physik
Mit 41 Abbildungen
Aus dem Amerikanischen von
Wolfgang Rhiel
Scanned by Warthog2000
Von Paul Davies
ist im Deutschen Taschenbuch Verlag erschienen:
Superstrings (30035; herausgegeben zusammen mit
Julian R. Brown)
Ungekürzte Ausgabe
1. Auflage November 1995
5. Auflage Mai 1997
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Dieses Buch erschien zuerst als gebundene Ausgabe 1993
im Byblos Verlag GmbH, Berlin, ISBN 3-929029-25-1
Unter dem Titel: Auf dem Weg zur Weltformel
Superstrings, Chaos, Complexity - und was dann?
Der große Überblick über den neuesten Stand der Physik
© 1992 Orion Productions and John Gribbin
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
The Matter Myth. Dramatic Discoveries that Challenge Our
Understanding of Physical Reality
Simon & Schuster, New York 1992
© der deutschsprachigen Ausgabe:
1993 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. RG, München
Umschlagkonzept: Balk & Brumshagen
Satz: Deutsch-Türkischer Fotosatz, Berlin
Druck und Bindung: C.H. Beck'sche Buchdruckerei, Nördlingen
Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in Germany • ISBN 3-423-30506-1
Inhalt
VORWORT 7
I DER MATERIALISMUS IST TOT 11
Das Maschinenzeitalter — Eine neue Physik für eine neue Gesell-
schaft — Das Wesen der wissenschaftlichen Wahrheit — Was ist
Wirklichkeit? — Jenseits des gesunden Menschenverstands
II CHAOS — BEFREIUNG DER MATERIE 29
Das Universum ist keine Maschine — Komplexität verstehen —
Eigenwillige Wellen — Knicke und Drehungen
III MYSTERIÖSE GEGEN WART 58
Der Raum als Arena — »Mein Gott, der Himmel bewegt sich!« —
Einsteins Durchblick — Die Vermählung von Raum und Zeit — Im
Kampf mit der Schwerkraft
ZWISCHENSPIEL
BEKENNTNISSE EINES RELAT1V1STEN 92
Das Unmögliche glauben — Das Unsichtbare sichtbar machen —
Das Blendwerk der Unendlichkeit
IV DAS UNIVERSUM ALS GANZES 104
Expansion ohne Zentrum — Der Urknall — Die Zeit und das Univer-
sum — Stirbt das Universum? — Zeit und Bewußtsein
V DIE ERSTE SEKUNDE ... 130
Etwas für nichts — Die Antiwelt — Wo ist die Antimaterie geblieben?
— Das Werden von Raum und Zeit — Im Griff der Antischwerkraft
VI ... UND DIE LETZTE 161
Hört die Zeit auf? — Das Universum zusammenschnüren — Der
gekräuselte Raum — Schreckliche Begegnung: String trifft schwar-
zes Loch
VII VERRÜCKTE QUANTEN 182
Der Quantentunnel — Eine unzuverlässige Welt — Die Erschaffung
der Wirklichkeit — Einsteins Dilemma — Unendlich viele Welten —
Kosmische Zufälle
VIII DAS KOSMISCHE NETZWERK 217
Photonen als Wegweiser — Ein Netz von Boten — Die Aufhebung der
Unendlichkeit — Unsichtbare Dimensionen — Sind Strings die
Lösung?— Vereinigung der Kräfte
IX JENSEITS DER UNENDLICHEN ZUKUNFT 241
Gefangenes Licht — Das Sternen-Aus — Wo die Zeit stillsteht —
Wurmlöcher und Zeitreise — Wieviel wiegt leerer Raum?
X DAS LEBENDE UNIVERSUM 263
Leben, was ist das? — Der Ursprung des Lebens — Jenseits-Welten
— Leben ohne Welten — Die Fremden — Die Suche nach ET — Wo
sind sie? — Von der Materie zum Geist
BIBLIOGRAPHIE 287
PERSONENREGISTER 290
Vorwort
Der Begriff »Revolution« wird in der Wissenschaft gern überstra-
paziert. Und doch merken wohl selbst die, die sich nur beiläufig
für wissenschaftliche Themen interessieren, daß tatsächlich re-
volutionäre Veränderungen stattfinden. Wir meinen weniger
bestimmte Entdeckungen, die immer gemacht werden, noch die
vielen herausragenden technologischen Fortschritte. Sicher, auch
diese Veränderungen sind revolutionär. In der Wissenschaft findet
jedoch ein grundlegender Wandel statt: in der Sicht der Wissen-
schaftler auf die Welt.
Der Philosoph Thomas Kuhn hat erklärt, der Wissenschaftler
baue seine Vorstellung von der Wirklichkeit um spezifische »Para-
digmen«. Ein Paradigma ist keine eigenständige Theorie, sondern
ein Denkschema, um das herum die durch Experiment und Beob-
achtung erlangten Daten angeordnet werden. Von Zeit zu Zeit
kommt es in der Geschichte des Denkens zu einem Paradigmen-
wechsel. Wenn das geschieht, ändern sich nicht nur wissenschaftli-
che Theorien, sondern auch die Weltbilder der Wissenschaftler.
Und genau das erleben wir gegenwärtig.
Leider sind Behauptungen, daß wir uns mitten in einem sol-
chen Paradigmenwechsel befinden, bereits zum Klischee gewor-
den. Sie beruhen nur auf Teilwahrheiten. Vielen wird aufgefallen
sein, daß in den letzten Jahren eigenartige und provozierende
Begriffe aufgetaucht sind: Schwarze Löcher, Wurmlöcher, Quan-
ten-»Geisterhaftigkeit«, Chaos, »denkende« Computer - um nur
einige zu nennen. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. In Wirk-
lichkeit wirft die Wissenschaft am Ende des 20. Jahrhunderts die
Denkfesseln dreier Jahrhunderte ab, in denen ein Paradigma das
Weltbild der Wissenschaftler beherrscht hat: die mechanistische
Naturauffassung. Simpel ausgedrückt besagt sie, daß das Univer-
sum lediglich eine Ansammlung wechselseitig aufeinander einwir-
kender Materieteilchen ist, eine gigantische planlose Maschine, in
der der menschliche Körper und sein Gehirn nur unmaßgebliche,
unbedeutende Teile sind. Dieses mechanistische Weltbild und der
mit ihm verwandte Materialismus lassen sich bis ins antike Grie-
chenland zurückverfolgen. Ihre neuzeitlichen Ursprünge hegen
jedoch bei Isaac Newton und seinen Zeitgenossen des 17. Jahrhun-
derts. Es war Newton, der die Gesetze der Mechanik entwickelte
und den Boden dafür bereitete, daß alle physikalischen Systeme,
alle Ereignisse, als Teil eines gewaltigen mechanistischen Prozes-
ses betrachtet werden. An der Schwelle zum 21. Jahrhundert wird
dieser Mythos vom Materialismus zu Grabe getragen.
Der Trend zu einem »postmechanistischen« Paradigma, das der
Wissenschaft des 21. Jahrhunderts angemessen wäre, vollzieht
sich auf breiter Front: in der Kosmologie, der Chemie selbstorgani-
sierender Systeme, der neuen Chaosforschung, der Quantenme-
chanik und der Teilchenphysik, der Informatik und (noch wider-
strebend) an der Schnittstelle zwischen Biologie und Physik. In all
diesen Bereichen sehen es die Wissenschaftler als fruchtbar oder
unumgänglich an, den Teil des Universums, mit dem sie sich befas-
sen, völlig neu anzuschauen, in Kategorien, die mit den alten Vor-
stellungen vom Materialismus und der kosmischen Maschine
kaum noch etwas zu tun haben. Dieser gewaltige Paradigmen-
wechsel bringt auch eine ganz neue Sicht auf den Menschen und
seine Rolle im großen Spiel der Natur mit sich.
Der Physiker Joseph Ford hat das materialistische, mechanisti-
sche Paradigma als »Gründungsmythos« der klassischen Wissen-
schaft bezeichnet. Müssen wir deshalb annehmen, daß der gewal-
tige Fortschritt der Wissenschaft in den letzten drei Jahrhunderten
auf einem totalen Mißverständnis über das Wesen der Natur
beruht? Nein, das hieße, die Rolle wissenschaftlicher Paradigmen
falsch zu verstehen. Ein Paradigma ist weder richtig noch falsch, es
spiegelt lediglich eine Perspektive, einen Wirklichkeitsaspekt
wider, der sich entsprechend den Umständen als mehr oder weni-
ger fruchtbar erweisen kann - so, wie ein Mythos, auch wenn er
nicht die Wahrheit ist, allegorische Einsichten enthalten kann, die
sich entsprechend den Umständen als mehr oder weniger brauch-
bar herausstellen.
Das mechanistische Paradigma erwies sich als so erfolgreich,
daß man fast überall bereit war, es mit der Wirklichkeit gleichzu-
setzen, es nicht als eine Seite der Wahrheit anzusehen, sondern als
Wahrheit schlechthin. Inzwischen erkennen immer mehr Wissen-
schaftler die Grenzen der materialistischen Naturauffassung und
meinen, daß die Welt mehr ist als eine gigantische Maschine.
Im vorliegenden Buch erkunden wir die aufregenden und pro-
vozierenden Veränderungen und diskutieren ihre Bedeutung für
uns alle, nicht nur für die Wissenschaftler. Um diese Geschichte
erzählen zu können, müssen wir uns weit auf wissenschaftliches
Terrain begeben, aber wir haben uns bemüht, die Darstellung so
einfach wie möglich zu halten. Vor allem die Mathematik haben
wir völlig ausgeklammert, obwohl einige der neuen Konzepte sich
erst in der Sprache der Mathematik voll erschließen.
Wir möchten einen kurzen Blick auf das Universum bieten, das
sich vor uns auftut. Es ist ein noch kläglich unvollkommenes Bild,
doch allein das, was bereits zu erkennen ist, ist aufregend genug.
Wir zweifeln nicht daran, daß diese Revolution, deren unmittelbare
Zeugen zu sein wir das Privileg und das Glück haben, die Sicht des
Menschen vom Universum für immer verändern wird.
Paul Davies
John Gribbin
I
Der Materialismus ist tot
Alltäglich wird uns bewußt, daß manche Dinge sich ändern, andere
nicht. Wir werden älter, vielleicht klüger, doch das Wir, das diese
Veränderungen erfährt, bleibt scheinbar das gleiche. Jeden Tag
ereignet sich Neues auf der Erde, Sonne und Sterne jedoch schei-
nen davon unberührt. Aber wieweit sind all das nur menschliche,
durch unsere Sinne begrenzte Wahrnehmungen?
Im alten Griechenland gab es die große Auseinandersetzung
um das Wesen von Veränderung. Einige Philosophen, so Heraklit,
meinten, alles fließe, nichts entgehe der Veränderung. Dagegen
hielt Parmenides, daß alles sei, was es sei, und folglich nicht wer-
den könne, was es nicht sei. Veränderung und Sein waren somit
unvereinbar, und nur die dauerhaften Erscheinungen konnten als
wahrhaft real angesehen werden.
Im 5. Jahrhundert v. Chr. wies Demokrit einen genialen Aus-
weg aus dieser Sackgasse: mit der Hypothese, daß alle Materie aus
winzigen, unzerstörbaren Einheiten bestehe, die er Atome nannte.
Die Atome selbst blieben unveränderlich, da sie feste Eigenschaf-
ten wie Größe und Gestalt hatten, aber sie konnten sich frei im
Raum bewegen und untereinander Verbindungen eingehen, so daß
die makroskopischen Körper, die sie bildeten, sich offenbar verän-
dern konnten. Auf diese Weise konnten Beständigkeit und Verän-
derlichkeit versöhnt werden; alle Veränderungen in der Welt wur-
den einfach neuen Verbindungen von Atomen im leeren Raum
zugeschrieben. Damit war die Lehre vom Materialismus be-
gründet.
Jahrhundertelang mußte der Materialismus mit anderen Ideen
konkurrieren, etwa mit dem Glauben, die Materie besitze magi-
sche oder sonstige Wirkungen, oder sie könne sich mit vitalisti-
schen oder okkulten Kräften aufladen. Diese mystischen Vorstel-
lungen traten mit dem Aufkommen der modernen Wissenschaften
11
in den Hintergrund. Ein Schlüsselereignis war 1687 die Veröffentli-
chung von Isaac Newtons >Principia<. In diesem Buch stellte New-
ton seine berühmten Bewegungsgesetze vor. Wie schon die grie-
chischen Atomisten bezeichnete Newton die Materie als passiv und
träge. Wenn ein Körper sich im Ruhezustand befindet, verbleibt er
nach den Newtonschen Gesetzen ewig in diesem Zustand, sofern
keine Kraft von außen auf ihn einwirkt. Der bewegte Körper bleibt
dagegen mit gleicher Geschwindigkeit und in gleicher Richtung in
Bewegung, solange keine Kraft ändernd auf ihn einwirkt. Materie
ist somit völlig passiv.
Nach Newton besteht Materie aus festen, massiven, undurch-
dringlichen, beweglichen Teilchen. Für ihn und seine Zeitgenos-
sen gab es keinen wesentlichen Unterschied zwischen den Eigen-
schaften alltäglicher Gegenstände und denen der elementaren
Bestandteile, aus denen sie sich vermeintlich zusammensetzen
(abgesehen von der Undurchdringlichkeit der letzteren).
Das Maschinenzeitalter
Newtons Sicht auf die Materie als träge Masse, die durch äußere
Kräfte gestaltet und geformt wird, setzte sich in der westlichen Kul-
tur durch. Ungeteilte Akzeptanz sollte sie vor allem während der
industriellen Revolution finden, die immense Macht und Wohl-
stand mit sich brachte. Im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts
wurden die Kräfte der Natur für Produktionszwecke gezähmt und
nutzbar gemacht, Dampfkraft und Eisen, Lokomotiven und große
Schiffe bildeten die Macht, das Antlitz der Erde zu verändern. Diese
Fortschritte stärkten den Wunsch, Materielles in großen Mengen
und unterschiedlichster Form zu besitzen. Wohlstand wurde in
Masse gewogen - in Tonnen Kohle, in Hektaren Land, in Gold oder
anderen Gütern. Die industrielle Revolution war eine Zeit grenzen-
loser Zuversicht - der Triumph des Materialismus.
Bei Erscheinen der >Principia< waren Uhren die technisch auf-
wendigsten Apparate. Newtons Bild von der Wirkungsweise der
Natur als einem ausgeklügelten Uhrwerk paßte genau in die Zeit.
Die Uhr verkörperte Ordnung, Harmonie und mathematische
Genauigkeit, Vorstellungen, die sich bestens mit der herrschenden
Theologie vertrugen. Entgegen alten Auffassungen vom Kosmos
12
als mystisch durchdrungener, lebendiger Organismus hatte die
newtonsche Mechanik eine klare Verbindung zwischen Ursache
und Wirkung hergestellt, und die mechanistische Darstellung ver-
langte, daß sich die Materie streng nach mathematischen Gesetzen
richtete. Gerade der Bereich, der sich etwas Magisches und Geheim-
nisvolles bewahrt hatte, das All, bot die erfolgreichsten Anwen-
dungsmöglichkeiten für die newtonsche Mechanik. In der Verbin-
dung der Bewegungsgesetze mit dem Gravitationsgesetz konnte
Newton die Umlaufzeit des Mondes sowie die Umlaufbahnen der
Planeten und Kometen überzeugend darstellen.
Die Lehre, nach der das Universum aus träger Materie besteht,
die in eine Art deterministisches Riesenuhrwerk eingesperrt ist, hat
sämtliche Bereiche menschlichen Forschens durchdrungen. So
beherrscht der Materialismus beispielsweise die Biologie. Lebende
Organismen werden nur als komplizierte Ansammlungen von Teil-
chen betrachtet, die blind von ihren Nachbarn angezogen oder
abgestoßen werden. Richard Dawkins, ein wortgewandter Verfech-
ter des biologischen Materialismus, bezeichnet den Menschen (und
andere Lebewesen) als Genmaschinen. Organismen werden dem-
nach wie Automaten behandelt. Solche Ideen haben sogar die Psy-
chologie beeinflußt. Die behavioristische Schule versteht alles
menschliche Handeln als eine Art newtonsches dynamisches
System, in dem der Geist eine passive (oder träge) Rolle spielt und
auf äußere Einwirkungen oder Reize letztlich deterministisch rea-
giert.
Es steht außer Frage, daß das newtonsche Weltbild mit seiner
Lehre vom Materialismus und vom Uhrwerk-Universum enorm
zum Fortschritt der Wissenschaft beigetragen hat, weil es einen
äußerst zweckmäßigen Rahmen für die Untersuchung der verschie-
densten Phänomene bot. Es ist aber auch keine Frage, daß es
wesentlich die Entfremdung des Menschen von seinem Universum
beförderte. Donald Mackay, ein Experte für die Erforschung des
Gehirns als Kommunikationssystem, spricht von »der Krankheit der
Maschinenfixiertheit«. Er führt aus: »In unserem Zeitalter, wo die
Menschen nach Erklärungen suchen, geht die Tendenz immer
mehr dahin, jede Situation, die wir verstehen wollen, durch die Ana-
logie zur Maschine zu begreifen.« Auf menschliche Belange wie
Politik oder Wirtschaft angewandt, führt die Maschinenfixiertheit
13