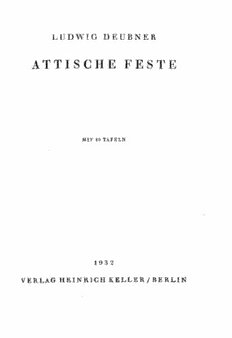Table Of ContentLUDWIG DEUBNER
ATTISCHE FESTE
MIT 40 TAFELN
1932
VERLAG HEINRICH KELLER/ BERLIN
PRINTED IN GERMANY
GEDRUCKT BEI POESCHEL & TREPTE IN LEIPZIG
LICHTDRUCK: GANYMED/ BERLIN
VORWORT
1t&,1w µe:cr,oc¼ opnjt;- roc' Anix&
Maximus Tyrius
E
I~E neue Bea~beit~ng der attischen :este bedarf kaum der Rechtfertigung. Das
m mancherlei Beziehung sehr verdienstvolle Buch von August Mommsen über
die Feste der Stadt Athen war vom religionswissenschaftlichen Standpunkt aus be
reits bei seinem Erscheinen (1898) um Jahrzehnte veraltet und hatte leider die nach
teilige Wirkung, daß Nilsson acht Jahre später in seinen neue Wege weisenden
Griechischen Festen das attische Material ausschließen zu müssen glaubte. Stengels
kurze Zusammenfassung in den Griechischen Kultusaltertümern und der betreffende
Abschnitt in den von Lipsius neu bearbeiteten Griechischen Alterthümern Schoe
manns dienen nur einer aUgemeinen Orientierung, und überdies ist die Benutzung
Stengels in der dritten Auflage durch eine große Anzahl von Fehlern und Unge
nauigkeiten in den Zitaten erschwert. So hat denn auch Lesky neuerdings im
Gnomon 8, 1932 S. 146 auf die Notwendigkeit einer „Darstellung der attischen
Feste, in der Art wie sie M. P. Nilsson für die .;iußerattischcn gegeben hat" hinge
wiesen.
Ich habe mich im wesentlichen auf die Beli~ndlung der religiösen Seite der atti
schen Feste beschränkt. Was zum äuße'ren Apparat gehört, wie namentlich die
Agone, ist beiseite gelassen oder nur geleg~niltcli gestfoift; doch sind zwei Tafeln
den religiös bedeutsameren Agonen der Ep:rdphia gewidmet. Im Rahmen der Auf
gabe, die ich mir gesetzt habe, ist Vollständigkeit angestrebt. Maßgebend war da
bei, daß die zu besprechenden religiösen Begehungen in der Überlieferung als Feste
bezeichnet werden oder doch den Charakter einer besonderen Feier an sich tragen:
gewöhnliche Opferdarbringungen konnten nicht in Betracht kommen. Sodann
scheiden die privaten „Familienfeste'" aus, die durch Samter wiederholt eine er
schöpfende Darstellung erhalten haben. Es handelt sich für uns um die öffentlichen
Feiern von allgemeinerer Bedeutung, zu denen wir auch die Apaturia und die zu
Ehren bestimmter Götter veranstalteten Vereinsfeste rechnen. Der Stoff ist nicht
wie bei Mommsen in kalendarischer Reihenfolge gegeben, sondern nach den Gott
heiten geordnet, wie es Carl Robert in seiner wertvollen Besprechung des Momm
senschen Buches ( Gött. Gel. Anz. 1899, 524) mit Recht verlangte. Auch die von
uns beigefügte kalendarische Tabelle hatte Robert an der gleichen Stelle emp
fohlen. Um die Kontrolle der Darstellung zu erleichtern, sind alle für die religiöse
Bedeutung der Feste wichtigen Zeugnisse in den Anmerkungen im Wortlaut an
geführt. In dem Text des Abschnitts über die Anthesteria (S. 93 ff.) ist mein Auf
satz aus den Neuen Jahrbüchern 6, 1930, 606ff. mit einigen Änderungen übe1·
nommen.
Das Buch verbindet eine handbuchartige Darstellung mit einzelnen Untersuchungen,
die durch philologische Kritik und Interpretation der Zeugnisse einen festeren
Grund für eine vertiefte religionsgeschichtliche Betrachtung zu legen sich bemühen.
5
Daß ich nicht jede unrichtige Behauptung widerlegt, sondern manches stillschwei
gend übergangen habe, wird man billigen. Wohl aber schien es mir bei dem Cha
rakter dieses Buches geboten, klar zu bezeichnen, wo die eigene Auffassung zu der
Meinung sachkundiger und gewichtiger Forscher in Gegensatz tritt. Folkloristische
Parallelen, die zu häufen leicht ist, habe ich sparsam verwendet und nur wo sie
das Verständnis fördern. Die auf den Tafeln wiedergegebenen Denkmäler der bil
denden Kunst dienen nicht nur der Belebung unserer Anschauung, sondern auch
der Ergänzung unserer Kenntnis. Riten und Bräuche führen ein zähes Leben. Da
her sind auch späte Zeugnisse oft von großer Wichtigkeit. Freilich bedarf es bei
ihrer Verwendung der kritischen Prüfung. Es kommt in diesen Dingen darauf an,
daß man eine gewisse Kenntnis der religiösen Formensprache besitzt. Erscheint
dem geschulten Auge ein in späteren Zeugnissen überlieferter Brauch oder Ritus
als altertümlich, so wird man ihn bis zum Beweise des Gegenteils mit Wahrschein
lichkeit für alte Zeit in Anspruch nehmen dürfen.
Ich habe vielen zu danken, die mir geholfen haben : Christian J ensen, dem mahnen -
den Freunde, und Dr. W. Abel für Mitlesen der Korrektur, unsern archäologischen
Instituten in Athen und Rom, dem Badischen Landesmuseum in Karlsruhe, dem.
Albertinum in Dresden, dem M. von Wagnermuseum in Würzburg, dem British
Museum in London, den Musees Royaux du Cinquantenaire in Brüssel, der Staat
lichen Eremitage zu Leningrad, dem Metropolitan Museum in New York, dem Art
Institute of Chicago, der Rhode Island School of Design in Providence, den Herren
E. Boehringer, A. Brückner, K. Bulas, E. Buschor, L. D. Caskey, L. Curtius,
H. Diepolder, P. Ducati, E. Fabricius, R. Herbig, Chr. Jensen, K. Friis Johansen,
G. Karo, W. Kolbe, E. Langlotz, K. Latte, F. Lenz, A. Merlin, K. Regling, G. Roa
denwaldt, Ed. Schmidt, W. Technau, J. Wackernagel, C. Weickert, E. Weigand,
P. Wolters, R. Zahn, W. Zschietzschmann und meinem Sohne Otfried teils für die
Besorgung von Photographien, teils für verschiedenartige Auskünfte. In herzlicher
Dankbarkeit gedenke ich der großen Liberalität der Direktion des Athener Natio
nalmuseums,. die mir in weitherzigster Weise die Publikation einer größeren An
zahl von Vasen gestattete, sowie der liebenswürdigen Hilfsbereitschaft des Herrn
A. Keramopullos, die ein genaues Studium des Kalenderfrieses von Hag. Eleu•
therios ermöglichte.
Mein ganz besonderer Dank gilt der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft,
sowie der preußischen Akademie der Wissenschaften und dem Archäologischen
Institut des Deutschen Reiches, deren :finanzielle Hilfe dazu beitrug, das Buch in
dieser kritischen Zeit herauszubringen. Auch dem Verlag sei für das Interesse
an den Attischen Festen und die ihnen gegebene Ausstattung bestens gedankt.
Schlachtensee, im September 1932 Ludwig Deuhner
INHALT
·Athena ....................... . 9 Tauropolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Arretophoria ................ . 9 Andere Artemisfeste . . . . . . . . . . 209
Procharisteria ............... . 17
Verschiedene Götter . . . . . . . . . . . . 211
Kallynteria, Plynteria ........ . 17
Prometheus .................. 211
Panathenaia ................ . 22
Hephaistos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Chalkeia .................... . 35
Eumeniden .................. 214
Synoikia ................... . 36
Poseidon .................... 214
Andere Feste ................ . 39
Eros, Aphrodite .............. 215
Demeter und Kore ............. . 40 Andere Götter der Stadt Athen 216
Skira ...................... . 40 Hekalos, Hekale .............. 217
Thesmophoria ............... . 50 Enyalios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Haloa ...................... . 60 Andere Götter außerhalb Athens 219
Andere Feste ................ . 67 Bendis ................ , ... , . 219
Mysterien ................... . 69 Adonis ...................... 220
Eleusinia ................... . 91 Andere ausländische Götter . . . . 222
Dionysos ..................... . 93 Heroen und Tote . . . . . . . . . . . . . . . 224
Anthesteria ................. . 93 Theseus ..................... 224
Lenaia ..................... . 123 Herakles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Ländliche Dionysia .......... . 134 Aias ........................ 228
St'a" d ti·s c h e n'·l Onys·ia .......... . 138 Andere Heroen . . . . . . . . . . . . . . . 228
Oschophoria ................. . 142 Genesia, N emeseia . . . . . . . . . . . . 229
Andere Feste ................ . 147 Epitaphia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Kronos, Zeus, Hera ............. 152 Apaturia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Kronia ...................... 152
Historisches, Politisches, Agonisti-
Diasia .......... , , . , ......... 155
sches ........................ 235
Pompaia .................... 157
Beilage I: Die Darstellungen der
Dipolieia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Choenkannen . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Düsoteria .... ~ ........... , . . . 174
Andere Feste .............. , .. 176 Beilage II: Der Kalenderfries von
Hag. Eleutherios . . . . . . . . . . . . . 248
Apollon und Artemis . . . . . . . . . . . . 179
Thargelia .................... 179 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Pyanopsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Verzeichnis der Tafeln . . . . . . . . . . . 266
Andere Apollonfeste .......... 201
Nachträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Munichia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Brauronia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Tabelle des Festkalenders / Tafeln
7
ABKÜRZUNGEN
=
ARW Archiv für Religionswissenschaft
BCH = Bulletin de correspondance hellenique
=
CAF Comicorum atticorum fragmenta ed. Kock
Farnell, Cults = Famell, Cults of Greek States
=
GGA Göttingische Gelehrte Anzeigen
IG = lnscriptiones Graecae
=
IG 12 lnscriptiones Graecae 1, editio minor
IG 22 = lnscriptiones Graecae 2 et 3, editio minor
Jahrb. = Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts
=
JHS Journal of Hellenic Studies
Lehrbuch d. Rel. = Chantepie de· la Saussaye, Lehrbuch der Religionsge
schichte, vierte Auflage, herausgegeben von A. Bertholet und E. Lehmann
Mommsen, Feste = A. Mommsen, Feste der Stadt Athen
Preller-Robert = Preller, Griech. Mythologie Band 1, vierte Auflage, be
arbeitet von Robert
=
Pringsheim, Beitr. Pringsheim, Archäologische Beiträge zur Geschichte
des eleusinischen Kults
=
RE Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft
Schoemann-Lipsius = Schoemann, Griechische Alterthümer, vierte Auflage,
neu bearbeitet von Lipsius, Band 2
=
Stengel Stengel, Die griechischen Kultusaltertümer, dritte Auflage
Die Bände von F:razers Golden Bough3 sind wie in seinem General Index
durchlaufend gezählt. Vgl. seinen Schlußband (12) S. 14 7.
ATHENA
ARRETOPHORIA
P
AUSANIAS berichtet im Rahmen seiner Akropolisperiegese von emem merk
würdigen Brauch, der seine große Verwunderung erregte und, wie er sagt,
keineswegs allgemein bekannt war. Nicht weit von dem Tempel der Athena Polias
wohnen - so bemerkt er - zwei Jungfrauen, die von den Athenern Arrephoren ge
nannt werden. Diese verweilen eine Zeit lang bei der Göttin, wenn aber das Fest
herangekommen ist, tun sie nächtlicher Weile folgendes. Sie setzen etwas auf den
Kopf, was ihnen die Priesterin der Athena zu tragen gibt, wobei weder diese noch
die Tragenden wissen, . was es ist, und begeben sich auf einem natürlichen unter
irdischen Gange, der durch den nahe gelegenen Bezirk der Aphrodite in den Gärten
führt, hinunter. Dort unten lassen sie das Getragene zurück und bringen etwas
anderes, was sie ebendort aufgenommen haben, in verhülltem Zustande herauf.
Dann werden sie entlassen und andere Jungfrauen an ihrer Stelle auf die Akropolis
gcbracht 1 Es handelt sich also um eine sehr geheime Zeremonie: unbekannte oder
).
eingehüllte Dinge werden nachts auf unterirdischem \Vege2) hinab - und herauf
getragen, und die Allgemeinheit weiß von diesen Vorgängen in der Zeit des Pau
sanias überhaupt nicht mehr viel. In engstem Zusammenhang damit steht die Nach
richt von einem Fest Arrephoria, das der Athena im Monat Skirophorion gefeiert
wurde 3 denn sein Name kann von jenen Arrephoren des Pausanias nicht getrennt
),
werden. Der Name der Arrephoria wird von den geheimen Dingen abgeleitet, die
bei dem Feste von Mädchen in Cisten zu Ehren der Göttin getragen wurden, er
soll also aus &ppYJ--ruon:d cpfpe:wz usammengesetzt sein4). Das Gleiche gilt natür
lich für den Namen der Mädchen. Wie vorzüglich das der Sache entspricht, leh1·t
die Schilderung des Pausanias auf das deutlichste, und sprachlich findet die Ver
kürzung von &.pp·~--rocp6zpuo c&; .pP"l)<.p6iphorec ; Analogien in Bildungen wie 3pct.xocuAo<c ;
<
o(1,p et.X1 .0VT'>O. WC/>\ 0Yc.;X,1( \ (l-OiT<E' t"C) OXVX !.L/(\ 0V0iTE;u:'ot1 'x0pVe,t .V0\<I ;uovo1 xpo.vov,- r1e :--rpet.)'..[L0--cr;e :--1 rpcx-
1) Paus. l, 27' 3 & 8f µot -&c.mµ&crµoc:tt .AtO"TrcCoi: pfoy_EVE,O 'Ttµ zv O\JX Ei; &rco:vwcy; w:>ptµo:,) 'POC4'Ci'tllE
oTo:c ruµßo:[w;t. rco:p-&tvoMt o -rnü vo:oü rijc; IloAtct.i'loco;t xoüow oü rr.6ppw, xo:).oücrti 'le:' A-D-·rivoii:cortc pc2c;
&pp·ricp6poucC;i·Ü TCxipt 6vov µsv WJCi 3to:tTCi'~I xoucrt mxpix- r')j -D-e:f:ri.,o :po:ye:voµbrl)ic'l;e :- rijc;f op-rijc;i 'lpwmv
e:v VUXT-Lro t&Se:. &vo:-&e:i:ccrroq:li tcrtlh/ tl -roccx; e:cpo:),ix&c ;1 1- r'ijc';A O·l)vrlcl;e pELC8i[ owcrt cpEpe:tvo,i h·e: ~ Ot·
8oücro:o rcoi.6v- rt Slowcrtl/d oui.o: oü-re:- ro:'i:cc;p e:poücro:Etcm; cr-ro:µtvo:t-c; ifo't'LO Er: ce:plßo).ocE; \/ -r-nrr .61-e-:tr ijc;
:x.o:).ouµsv-tEJ'cIK; ~rcotc;'A cppoSkl)c;Q \) 1t6pp(Jx) c,,lS t' O(\J't'OÜx &-9-oooucr;r .6yo:toca;u -c-oµoc-r-·,I J -ro:u-rnX CiTLO:OW
o:l n-o:pB-svotx. oc-rwµ. /:v 8·1)'t '<Xcp e:p6µsvc1,-, d1roucrw), ,o:ßoücro:St e: rJ.),_)T,oL x oµ((ouatv 11:yxsxo:).uµµtvo· vx o:t
-rixcµ; 1:v& cptifotv'f i/3--1r)o e:,m:ü-0-sve,: -rl:po:8ce; : tc;- r·riv& xp61t0Atvrc o:p-9-tvourcl.;y oucrL&Vv -:-C' lUT&°}'I,
2) Diesen Weg und das Heiligtum der Aphrodite in den Gärten glaubt Broneer jetzt wieder
gefunden zu haben, Hesperia 1, 1932, 52. Ebenda 51 f. über frühere Ansetzungen des Weges.
3) Etym. m. 14,9, 14, &pp-l)cp6pxoot :t 'App·1Jcp6ptcf,o,·p -r·~t m-rs).ouµc:v·I-Jr '/j' A-0·1Jv~tv ~xtpocpoptwvtµ rivl ..••
n-o:pix- ro ofpp·IJ-rxOa!l . µucrTIJpLoccp itpsw.
4) S. Anm. 3. Vgl. auch Schol. Aristoph. Lys. 642 ·ijpp-1J<p6pouovl · µe:v OLO-rCo ü o:, 'App-1Jcp6putxr,c e:tS~
't"IcXt. pp-f)TEOV:x lcr-ratc~; cpEpo-vr n ,fü;cpa .l 7tCip-9-evoStu; id. 'App7Jcp6pLOBCa;c hmann, Anecd. 1, 146, 3.
9
3pocx[J.ocd;i, e beiden letzten Beispiele von attischen Inschriften 1). Dazukommt nun, daß
der volle Festname 'App"l)-roqi6ptoicn dem bekannten Lukianscholion begegnet, in
dem auch von den 0zcrµoqi6pta und Lx.tpoqi6ptocd ie Rede ist, und daß es sich hier um
Vorgänge handelt, die den von Pausanias geschilderten ganz analog sind2 Eine
).
Gesamtbehandlung des wichtigen Scholions wird unten S. 40ff. gegeben. Hier kann
nur das Stück herausgehoben werden, das sich auf die Arretophoria bezieht. Da
nach handelte es sich um einen geheimen Brauch, der in gleicher Weise wie das
vorher in dem Scholion Geschilderte das Wachstum der Früchte und die mensch
liche Zeugung betraf: Man bringt aus einem unterirdischen Raume geheime heilige
Dinge aus Brotteig herauf, Abbilder von Schlangen und Phallen. Auch nimmt man
Pinienzweige mit herauf wegen dei· Fruchtbarkeit dieser Pflanze 3). Es werden also
bestimmte Symbole heraufgebracht, die vorher in den betreff enden unterirdischen
Raum hinuntergebracht oder hinuntergeworfen sein müssen, geradeso wie bei
Pausanias die Arrephoren nicht nur geheime Dinge hinunterbringen, sondern auch
solche abholen, die ebenfalls vorher hinuntergelangt sein müssen. Daß es sich
im Scholion um Fruchtbarkeitssymbole handelt, paßt gut zu dem geheimen Cha
rakter dieser Riten. Es kann nach dem Dargelegten nicht zweifelhaft sein, daß
die Arretophoria des Lukianscholions ebenso wie die Arrephoria des Etym. m.
und die Arrephoren des Pausanias dem Kulte der Athena angehören und daß
ihr N ame4 die Ableitung der Arrephoria und der Arrephoren von den äpp"IJ-ra
)
bestätigt. Doch erhebt sich nun die Frage, ob die an den drei Stellen erwähnten
Begehungen identisch sind, oder wie sie sich sonst zueinander verhalten. Die
Analogie der Thesmophoria (s. unten S. 50 f.) zeigt, daß das Heraufholen der
&pp"IJ"ti'OmC Zusammenhang steht mit der Aussaat des Spätherbstes. Jene Dinge,
die sich in der Tiefe der Erde mit deren Fruchtbarkeitskräften vollgesogen hatten,
sollten nunmehr, der Saat beigemischt, eine reiche Ernte garantieren. Dem Herauf-
1) Meisterhans, Gramm. d. att. Inschr. 3 118, 14, vgl. 217, 31. S. auch Leo Meyer, Griech. Ety
mologie 1,266. Die von Lobeck, Aglaophamus 873c befürwortete, von Hiller v. Gärtringen,
RE 6, 551, 15ff. wieder aufgenommene und auch von Ziehen, Burs. Jahresb. 172, 1915,
107 gebilligte Ableitung des Namens &pp"IJcp6povLom Stamme des Wortes &ppLx_oics;t ganz abge
sehen davon, daß es sich dabei um eine bloße Vermutung handelt, deswegen unwahrscheinlich,
weil man ein Fest nicht nach einem so wenig charakteristischen Zuge wie dem Tragen eines
gewöhnlichen Korbes benannt hätte. Es muß vielmehr auf den Inhalt des getragenen Gegenstandes
angekommen sein. Bei der eA€V"IJd er 'EAEVJJ<p6pL(Poco ll. 10, 191) handelt es sich um ein ganz
spezielles, nur bei diesem Feste gebrauchtes Gerät. Im Thesaurus des Stephanus erscheint
KcxVl)cp6pwa:l s Festname, wofür auf Castellanus, De festis Graecorum verwiesen wird. Aber bei
diesem (Gronovius, Thesaurus 7, 676) findet sich Kcxv't)cp6pLnoucr als Überschrift eines Abschnitts
über das xctv7Jcpope:i:v.
2) Vgl. zum folgenden van der Loeff, Mnemos. 44, 1916, 333ff., der unsere Erkenntnis entschei-
dend gefördert hat.
s. ae
3) Sc hol. Lukian 27 6, 13 Rabe 't'O: CX\l't'xIXix l , App't)Wq>6ptoXc O:AE:t't'xC.ot:cL&l . ye:'t'O'Ct'OL \IC (U't'O)\.I6 yov
ae
ezovw, m:pt njc; 'fW\Ix apm7iv yevem:wcY;.c tl. njc; 't'W\I& v.Opwneuvcm opäc;. &voccpepoV't'et:xL. &v-.-ocü&&op:p 7j't'Cl
!epo:l x a-rect't'oc';t 'OÜa hou xct't'e:axeuocaµevctµ, tµ~(J-ct't'a.3 po:x6V't'wvx ixl. &v8pe:lruvC JX"IJ(J-IX't)'C.oucvµ.ß tivouat
ae s.
<xctl.>x c:ivou .Oo:UoucS;i a 't'On o).uyovov "t'OcÜpu -roü. Vgl. unten 41 ff.
4) Vgl. dieselbe Form bei Clemens Protrept. 2, 17 S. 14, 6 Stählin.
10
holen entsprechen die Arretophoria des Lukianscholions, während die Begehung
des Skirophorion (Et. m.) wegen der Jahreszeit davon getrennt werden muß.
Offenbar diente diese analog den unten zu besprechenden Skira dazu, die ge•
heimen Gegenstände an die Stelle zu schaffen, wo sie später abgeholt werden konn·
ten. Da es sich dabei um die Zeit handelt, wo die Ernte vorüber war, beabsichtigte
man gewiß in erster Linie, mittels der Fruchtbarkeitssymbole der erschöpften
Erde neue zeugerische Kräfte zuzuführen 1). Die Reste dieser &pp"l)'t"trCaJte. n dann
im Herbst in eine neue Funktion. Wenn nun bei Pausanias von den Arrephoren
Dinge teils hinuntergebracht, teils heraufgeholt werden 2 so ist es wahrscheinlich,
),
daß wir es hier mit dem Herbstritus zu tun haben, denn auch an den Thesmophoria
holte man nicht nur die Fruchtbarkeitsträger herauf, sondern legte auch bestimmte
Gaben in dem unterirdischen Raume nieder (unten S. 43), die wie bei Pausanias
ein Ersatzopfer für die abzuholenden Dinge dargestellt haben müssen, während
ein Heraufholen im Sommer nicht überliefert ist und, im Gegensatz zum Herbst,
auch gar keinen erkennbaren Zweck hätte. Das alles wird bestätigt durch die An
gabe des Pausanias, daß die Arrephoren nach Vollziehung ihrer Aufgabe entlassen
und neue eingestellt -w,irden: denn dies ist nach dem Herbstritus verständlich,
nicht aber nach der sommerlichen Begehung, die erst in jenem Ritus ihre Voll
endung findet. Aus den Geheimriten ist die Geschichte von der Ciste des Erichtho
nios3) erwachsen, die von den Kekropiden nicht geöffnet werden durfte. In ihr
spiegelt sich das Gerät wieder, das von den Arrephoren getragen wurde 4). Die
Schlange, die darin verborgen ist, hat ihr Vorbild in den p.LfL~fLOC~,poocc x6v-n,)V
des Lukianscholions (Z. 17)5
).
Die Anephoren hatten außer der erwähnten noch eine zweite Aufgabe zu erfüllen:
sie waren beteiligt, wenn die Webarbeit am Peplos der Athena begonnen wurde.
Dies geschah am Feste der Chalkeia (unten S. 31. 36). Und zwar wurden von den
vier Arrephoren, die das Volk wählte, zwei für die Teilnahme an der Peplosarbeit
auserlesen 6 Es geschah dies durch den Archon Basileus, offenbar in feierlicher
).
Form. Suidas hat den altertümlichen Ausdruck für diese Kürung erhalten 7).
Robert war der Meinung, daß die Volksversammlung die vier Arrephoren nur
präsentiert und daß der Basileus zwei davon bestätigt hahe 8 Dem ist mit Recht
).
1) Vgl. unten S. 44 und über analoge Begehungen z.B. Preuß, Globus 86, 1904, 358ff.
2) Das ),o:ßoümx~d es Paus. (Z. 25/26) entspricht dem AO:fJ-ßcx.voduecsn Schol. (Z. 17/18).
3) Nach Picard, Les luttes primitives d' Athenes et d'Eleusis (aus Rev. histor. 166, 1931) 41 stellt
diese Geschichte eine Nachahmung eleusinischer Motive dar und ist zum Zweck der Konkurrenz
erfunden.
4) S. oben S. 9. Vgl. dazu die Vermutungen von Frickenhaus, Ath. Mitt. 33, 1908, 28ff.
5) Harrison, Mythology and Monuments XXXHf.; Prolegomena 133{. .
6) Harpokr. ixpfl'~<popei:.'•v. · 't'eo'O'ocpeµ:¾i; v cy_etpo-rovoüv-raot ' e;uybietcxvc xppij<p6poLM, o 8e e:xp[vovro,
ociT ijc;u qi'ijc-;r oü mbtAOU~ px_ovx al 't'NVr J.AAÜ'tJ'VN Vm :pl CJ.U't'6v)..e ;UX'l8jl'/ e:cr-&'ij-er:cqxi 6pouv.d Se:x pucrlcc
m:pte-&e:v-rloe,: pcx-; c,:ü-roec-y lve-ro. Vgl. Bekker, Anecd. 1, 202, 3; 446, 18; Etym. m. 149, l 9ff.
7) Suid. e:mtil~cx-;oX· O(.'t'eAe:~&e:~ve, ;).[~C,:'t'€0O''.t 'L ö' ,A 't'wt6v· 6 ßo:at),e:uc&; mN\jJIX'lc'Oxp p,icp6pouc;
TIÄ&.-rwev:v N 6µotc; (947 c 4f., wo die Form e:m6\jJCilV'bt'ce,l:eLg t ist). Vgl. IG 22 1933, 1; 1934-,2 .
s) Robert, GGA 1899, 533.
11
widersprochen worden 1). Der Wortlaut der angeführten Harpokrationstelle ist
vollkommen eindeutig. Und wenn wir uns daran erinnern, daß die von Pausanias
geschilderten Geheimriten ebenfalls von zwei Arrephoren ausgeübt wurden, so
ist es klar, daß von den vier erwählten Arrephoren je zwei für die beiden verschie
denen Aufgaben verwendet wurden 2). Wir bemerkten oben S. 11, daß die Arrephoren
nach Vollziehung des Herbstritus entlassen und neue eingestellt wurden. Der
Ritus wird wie die analogen Thesmophoria 3) gegen die Mitte des Pyanopsion ge
fallen sein. Die Chalkeia, an denen die Arbeit am Peplos begann, wurden am letzten
Tage des Pyanopsion gefeiert. Es ergibt sich somit, daß die Wahl der vier neuen
Arrephoren zwischen den beiden Festen, in der zweiten Hälfte des Pyanopsion
stattfand und zwei von ihnen sofort für die unmittelbar bevorstehende Peplos
arheit delegiert wurden. Vier Arrephoren können allerdings nur in den Jahren
gewählt worden sein, wo die großen Panathenaia folgten: denn an dem jährlichen
Feste wurde kein Peplos dargebracht. In den anderen Jahren kann es sich nur
um die Wahl von je zwei Arrephoren gehandelt haben 4). Der Name Arrephoren,
wie wir ihn auffassen, weist darauf hin, daß das Amt zunächst für die Vollziehung
der Geheimriten geschaffen wurde, und daß erst später zwei weitere Mädchen unter
dem selben Namen zur Peplosarbeit bestimmt wurden. Das paßt gut dazu, daß
wir den Beginn der regelmäßigen Erneuerung des Peplos erst in historische Zeit
setzen können (s. unten S. 30). Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Arrephoren
in den Sesselträgerinnen auf dem Ostfries des Parthenon zu erkennen sind5), wo
die Übergabe des Peplos dargestellt ist (Taf. l, 1). Die Kleinheit ihrer Figuren stimmt
gut zu dem zarten Alter, in dem sie standen: sie waren ja sieben bis elf J ahrc alt6
)·
Man wählte gerne für den Vollzug wichtiger Riten unschuldige Kinder aus, weil
ihre Unbeflecktheit den Erfolg magisch empfundener Handlungen zu garantieren
schien. Dies ist bei den von Pausanias erwähnten Zeremonien besonders begreiflich.
Bei der Anfertigung des Peplos mag sich der Gedanke schon dahin gewandelt
haben, daß die Beteiligung der unschuldigen Mädchen der Göttin wohlgefällig sei7
),
und es ist sehr wohl möglich, daß eben das kindliche Alter der schon vorhandenen
Arrephoren der Grund war, warum man ihresgleichen als Vertreterinnen für die
neue Aufgabe delegierte. Wenn einige Zeugnisse, in denen die Arrephoren erwähnt
werden, von 1rocp8-tvoLsp rechen 8), so ist hier die genauere Kenntnis des Tatbe-
1) Schoeman:n-Lipsius 493, 4.
2) Vgl. auch Hitzig-Blümner, Pausanias 1, 295.
3) S. unten S. 52.
4) Vgl. Premerstein, Öst. Jahresh. 15, 1912, 22, 74.
5) Vgl. Mommsen, Feste 114; Roberta. 0.; Premerstein a. 0. 22f. Anders Furtwängler, Meister
werke I86ff. Über die Bedeutung der Sessels. u. S. 31.
6) Etym. m. 149, 19 -rfocrct:pEfcü;: :1 tct:i:fü;ec);" .ELpo-rovoüvX-rcot :-rE' uytve:tcxv& pp1jcp6poot mohw v bmx µexpu;
evae:xa.X 't'A. Vgl. Bekker, Anecd. 1, 202, 5; Aristoph. Lys. 642 brnx µbl lt'!"1yJ e:ywcr' Eu&ü~- JippY)·
cp6pouv.
7) Vgl. Mommsen a. 0. 109.
8) Schol. Aristoph. Lys. 642 (trotz des Textes des Aristophanes, s. oben Anm. 6); Paus. 1, 27, 3
z.
15.
12