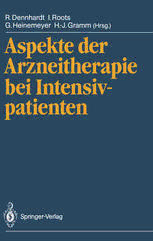Table Of ContentR. Dennhardt I. Roots
G. Heinemeyer H.-J. Gramm
(Hrsg.)
Aspekte der
Arzneitherapie bei
Intensivpatienten
Mit einem Geleitwort von
K. Eyrich und H. Kewitz
Mit 52 Abbildungen, davon 6 in Farbe
Springer-Verlag
Berlin Heidelberg New York
London Paris Tokyo
Prof. Dr. RODIGER DENNHARDT
Krankenhaus Nordwest, Anasthesie-Abteilung, Steinbacher HohI2-26,
0-6000 Frankfurt 90
Prof. Dr. IVAR ROOTS
Institut fijr Klinische Pharmakologie, Universitatsklinikum Steglitz,
Hindenburgdamm 30,0-1000 Berlin 45
Dr. GERHARD HEINEMEYER
Beratungsstelle fijr Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie,
PulsstraBe 3-7, 0-1000 Berlin 19
Dr. HANS-JOACHIM GRAMM
Klinik fijr Anasthesiologie und operative Intensivmedizin,
Universitatsklinikum Steglitz, Hindenburgdamm 30,
0-1000 Berlin 45
ISBN-13: 978-3-540-17261-1 e-ISBN-13: 978-3-642-71694-2
DOl: 10.1007/978-3-642-71694-2
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Aspekte der Arzneitherapie bei Intensivpatienten I R. Dennhardt ... Mit e. Geleitw. von K. Eyrich u.
H.Kewitz. - Berlin; Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo: Springer, 1988
NE: Dennhardt, Rtidiger [Hrsg.]
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschtitzt. Die dadurch begrtindeten Rechte. insbesondere die der
Ubersetzung, des Nachdrucks. des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der
Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielniltigung auf anderen Wegen und der Speiche
rung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Eine Vervielfaltigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den
Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
vom 9. September 1965 in der Fassung vom 24. Juni 1985 zuUissig. Sie ist grundsatzlich vergtitungs
pflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1988
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daB solche Namen im Sinne
der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von
jedermann benutzt werden dtirften.
Produkthaftung: Ftir Angaben tiber Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Ver
lag keine Gewahr tibernommen werden. Derartige Angaben mtissen vom jeweiligen Anwender im
Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit tiberpruft werden.
212113130-543210· Gedruckt auf saurefreiem Papier
Geleitwort
Patienten auf Intensivstationen sind durch das Versagen von Vitalfunk
tionen bedroht und benatigen daher zu deren Aufrechterhaltung sHindig
einer intensiven apparativen und medikamentasen Behandlung.
Hier treffen die Einschrankungen der Funktionen mehrerer Organe
und die darauf beruhenden oder schon vorher bestehenden pathologischen
Veranderungen von Eliminations- und Entgiftungsmechanismen mit der
Notwendigkeit zur Anwendung vielfaltiger eingreifender und hochdosier
ter Arzneimittel zusammen. Die daraus erwachsenden besonderen Pro
bleme flir den Einsatz von Medikamenten bei Patienten, die nach groBen
Operationen oder schweren Verletzungen einer Intensivbehandlung be
durfen, sind bisher nicht ausreichend wissenschaftlich bearbeitet worden.
Selbst die unter so1chen Bedingungen auftretenden Interaktionen zwischen
den verschiedenen Arzneimitteln, also Antagonismen, Synergismen und
gegenseitige Induktion oder Hemmung des Metabolismus, der EiweiBbin
dung und der Ausscheidung, sind nicht ausreichend bekannt und kannen
daher bei der sorgfiiltig auf den individuellen Fall anzupassenden Therapie
nicht genugend berticksichtigt werden.
Um das auf diesem Gebiet vorhandene Wissen zu sichten und zu disku
tieren, haben wir im Oktober 1986 klinische Pharmakologen und Intensiv
mediziner zu einem Gedankenaustausch zusammengeflihrt. Der vorgelegte
Band enthiilt die wichtigsten Beitrage zu diesem interdisziplinaren Sympo
sium.
Berlin, Sommer 1988 K. EYRICH H. KEWITZ
Inhaltsverzeichnis
Klinisch wichtige phannakokinetische Parameter
L.DETILI
(Mit 1 Abbildung) ............... . 1
Einfliisse auf die PlasmaeiweiBbindung von Arzneimitteln
bei Intensivpatienten
U.KLOTZ
(Mit 4 Abbildungen) .................... . . . .. 10
Hemmung und Induktion des Arzneimittelstoffwechsels
bei Intensivpatienten
G. HEINEMEYER
(Mit 2 Abbildungen) ................... . 19
Pathophysiologische und phannakologische Determinanten
des hepatischen Arzneimittelstoffwechsels
H. LANGE, J. BIRCHER
(Mit 2 Abbildungen) ......... .... . . . . . . . . .. 29
Arzneitherapie bei renaler Insuffizienz
D.KAMPF .............. . . ........ 38
Arzneimittelinteraktionen und Nierenerkrankungen
H. G. SIEBERTH
(Mit 2 Abbildungen) ............ . . . . . . . . . . . .. 47
Arzneimittelverluste bei Hiimodialyse und spontaner Hiimofiltration
F. KELLER, H.Hn.T, H.HALr.ER, G. WALZ, U.KUNZENDORF,
G. OFFERMANN
(Mit 5 Abbildungen) .................. ...... 55
Serumkonzentrationsbestimmungen von Arzneimitteln
in der Intensivtherapie
F.FoLLATH
(Mit 3 Abbildungen) ......................... 73
Gebrauch von Arzneimitteln auf Intensivstationen
H. P. SCHUSTER •••••••••••••••••••••••••••• 80
VIII Inhaltsverzeichnis
Zentralnervose N ebenwirkungen
der intensivmedizinischen Arzneitherapie
P.M.LAUVEN,H.STOECKEL ...•.... 87
Inkompatibilitaten von Arzneimitteln und Infusionslosungen
P. VERMEIJ
(Mit 1 Abbildung) ...................... 96
Genauigkeit der Arzneimittelapplikation durch Infusionspumpen
U. FRUCHT, R. DENNHARDT
(Mit 3 Abbildungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 104
Probleme der Therapie des erhohten intrakraniellen Druckes
mit Osmodiuretika und hohen Barbituratdosen
K. WIEDEMANN, C. KRIER, H. POLARZ
(Mit 5 Abbildungen) ............. . ... 110
Hz-Rezeptorantagonisten - Abwagung von Nutzen und Risiko
bei Intensivpatienten
R. GUGLER ..........•••................. 122
Probleme der Antibiotikatherapie bei Patienten
einer operativen Intensivstation
H.LoDE, H. TEPE, K.MERTENs, U.FoHRING, R.DENNHARDT,
F.KELLER, H.-J.GRAMM, I. GOECKE .................. 130
Indikation zur Behandlung von Pilzinfektionen
G.HOFFKEN .............................. 140
Besonderheiten der Pharmakotherapie
in der neonatalen Intensivmedizin
G.HEIMANN
(Mit 14 Abbildungen) ........................ 147
Antiepileptika in der Intensivtherapie des Status epilepticus
W. CHRISTE, D.JANZ
(Mit 4 Abbildungen) ......................... 158
Antiarrhythmikatherapie in der Intensivmedizin
E.-R. v. LEITNER ................ . . 167
Langzeitsedierung und Schmerzbehandlung von Intensivpatienten
R. DENNHARDT, H.-J. GRAMM ...........•..... . 172
Kutane Arzneimittelnebenwirkungen in der Intensivmedizin
K.BORK
(Mit 6 Abbildungen) ......................... 182
Mitarbeiterverzeicbnis
Die Anschrift des erstgenannten Autors ist jeweils bei Beitragsbeginn als
FuJ3note angegeben
Bircher, J. 29 Keller, F. 55,130
Bork, K. 182 Klotz, U. 10
Christe, W. 158 Krier, C. 110
Dennhardt, R. 104, 130, 172 Kunzendorf, U. 55
Dettli, L. 1 Lange, H. 29
Fohring, U. 130 Lauven, P. M. 87
Follath, F. 73 Leitner, E.-R. v. 167
Frucht, U. 104 Lode,H. 130
Goecke, I. 130 Mertens, K. 130
Gramm, H.-J. 130,172 Offermann, G. 55
Gugler, R. 122 Polarz, H. 110
Haller, H. 55 Schuster, H. P. 80
Heimann, G. 147 Sieberth, H. G. 47
Heinemeyer, G. 19 Stoeckel, H. 87
Hilt, H. 55 Tepe, H. 130
Hoifken, G. 140 Vermeij, P. 96
Janz, D. 158 Walz, G. 55
Kampf,D. 38 Wiedemann, K. 110
Klinisch wichtige pharmakokinetische Parameter
L.DE1TLI
Wenn wir von klinisch "wichtigen" pharmakokinetischen Parametem sprechen, ver
suchen wir folgende Frage zu beantworten: "Welche der vielen pharmakokineti
schen Parameter muB nicht nur der spezialisierte klinische Pharmakologe, sondem
auch der in Klinik und Praxis Uitige Arzt kennen, urn eine rational begrtindete Arz
neimitteldosierung betreiben zu konnen?" Es kann niimlich festgestellt werden, daB
die Beriicksichtigung pharmakokinetischer Prinzipien fUr den klinischen Pharmako
logen heute zur Selbstverstiindlichkeit geworden ist. Dies gilt insbesondere auf der
Intensivstation, wo oft Pharmaka mit geringer therapeutischer Breite schwerkran
ken Patienten mit Abnormitiiten der Pharmakokinetik verabreicht werden. Ande
rerseits ist unverkennbar, daB im iirztlichen Alltag pharmakokinetische Gedanken
giinge bei der Arzneimitteldosierung ungenugend gewtirdigt werden. Da dieser
Mangel unseres Erachtens in erster Linie die Folge von zu wenig realitiitsbezogenen
Lehrmethoden ist, seien zuniichst einige didaktische Prinzipien diskutiert, die beach
tet werden mussen, wenn dem Kliniker pharmakokinetisches Gedankengut niiherge
bracht werden solI.
1. Das Lehrziel: Ein verbreiteter didaktischer Fehler besteht darin, daB der speziali
sierte Kinetiker im klinisch-pharmakologischen Unterricht versucht, dem Kliniker
ein iihnliches kinetisches Lehrgebiiude zu vermitteln, wie er es selbst gelemt hat,
d. h. eine komplexe und weitgehend abstrakte Theorie der Pharmakokinetik. Dieses
hohe Lehrziel ist beim Kliniker mangels genugender mathematischer Vorkenntnisse
nicht erreichbar und auch nicht anzustreben; denn was der Praktiker benotigt, ist
nicht eine umfassende Theorie, sondem ein einfaches priidiktives Werkzeug, das
ihm hilft, seine Probleme bei der Arzneimitteldosierung zu losen. Man begnuge sich
dehalb mit der bescheideneren, aber realisierbaren Aufgabe, einige fundamentale
pharmakokinetische Prinzipien fUr die pharmakotherapeutische Praxis nutzbar zu
machen. Das Lehrziel heiSt demnach nicht "Pharmakokinetik", sondem "Dosie
rungslehre".
2. Die Lehrmethodik: Bei der Auswahl der fUr den Kliniker geeigneten kinetischen
Parameter ist folgendes zu beachten: 1m Gegensatz zu einer rein naturwissenschaft
lichen Theorie genugt es hier nicht, daB ein Parameter die biologische Realitiit rich
tig beschreibt, sondem der Parameter muB vom Kliniker uberdies fUr die tiigliche
Anwendung am Krankenbett akzeptiert werden. Einfachheit der Formulierung ist
deshalb eine unabdingbare Voraussetzung. Dabei liiBt sich nach unserer Erfahrung
der Begriff "Einfachheit" mit folgendem "Lehrsatz" charakterisieren: "Der Arzt in
Medizinische Universitiitsklinik B, Department fUr Innere Medizin, Kantonsspital, CH-4031 Basel
2 L. Dettli
Klinik: und Praxis ist nicht willens oder fahig, einen Begriff zu akzeptieren, mit dem
er nicht eine Vorstellung verkniipfen kann". Dieser Sachverhalt ist durch die Tat
sache bedingt, daB die derzeitige medizinische Ausbildung sich vomehmlich mit der
Erziehung der Sinneswahmehmungen beschaftigt. Demnach ist Einfachheit mit An
schaulichkeit gleichzusetzen. AuBerdem ist zu beachten, daB ein klinisch nutzlicher
kinetischer Parameter die biologische Realitat nicht mit maximaler, sondern ledig
lich mit klinisch ausreichender Genauigkeit beschreiben muB. Andererseits ist bei al
lem Verstandnis fur die vorwiegend durch Anschaulichkeit gepragte Ausbildung des
Arztes stets der Grundsatz zu vertreten, daB Arzneimitteldosierungen ein quantita
tives Problem ist. Das heiSt, daB auch der Arzt nicht darauf verzichten kann, einige
quantifizierbare pharmakokinetische Parameter zu beriicksichtigen.
3. Der Lehrinhalt: In der klinischen Pharmakokinetik, die als Basis einer rationalen
Arzneimitteldosierung dienen solI, stehen die Probleme der Elimination weitaus im
Vordergrund. In der Praxis stellen sich folgende Fundamentalfragen:
Frage 1: Wie nimmt die Plasmakonzentration eines Arzneimittels nach Verabreichung
einer oder mehrerer Dosen zeitlich ab?
Wir verwenden fur diesen Zweck die sog. Residualquote r, die angibt, auf wel
chen Bruchteil der Ausgangskonzentration Co die Plasmakonzentration Cr nach
einem bestimmten Abklingintervall r abgesunken ist: r = cr/co. Die Beantwortung
dieser Frage kann Z. B. bei einer Arzneimitteliiberdosierung bedeutungsvoll sein.
Umgekehrt kann die Frage von Interesse sein, urn welchen Bruchteil der Aus
gangskonzentration Co die Plasmakonzentration abgenommen hat. Diese Frage be
antwortet die Abklingquote d, wobei offensichtlich die Beziehung gilt:
d = I - r oder r = I-d. (1)
Bei der repetierten Arzneimitteldosierung ist das Abklingintervall gleich dem Dosie
rungsintervall.
Frage 2: Wie ist das Ausmaf3 und der zeitliche Verlauf der Kumulation bei repetierter
Verabreichung eines Medikaments?
Das Ausmaf3 der Kumulation wird durch den sog. Kumulationsfaktor R quanti
tativ charakterisiert, der angibt, wievielmal hoher als nach der ersten Dosis die Arz
neimittel-Plasma-Konzentration Css irn Steady-state liegt. Dabei laBt sich folgende
Beziehung nachweisen:
R = CsslCl = lid. (2)
Der zeitliche Verlauf der Kumulation wird durch die Siittigungsquote s beschrieben,
die angibt, aufwelchen Bruchteil des Kumulationsgrenzwertes die Plasmakonzentra
tion nach einem bestimmten Siittigungsintervall T angestiegen ist. Fur T = r gilt:
(3)
SchlieBlich ist dasjenige Verhiiltnis zwischen Initialdosis D* und Erhaltungsdosis D
anzugeben, das nicht zu einem kumulativen, sondern schon nach der ersten Dosis zu
Klinisch wichtige pharmakokinetische Parameter 3
einem zeitlich stationaren Konzentrationsverlauf flihrt. Diese Frage beantwortet der
Dosisquotient R *, wobei folgende Beziehung gilt:
R* = D*/D = R = lid. (4)
Frage 3: Bei welchen Krankheiten und bei welchen Medikamenten sind kinetische Ab
normitiiten zu erwarten und wie konnen die daraus resultierenden unerwunschten Wir
kungen durch Modifikation des Dosierungsschemas vermieden werden?
Fur die Beantwortung dieser 3 Fragen sind nach unserer Erfahrung nur 2 kineti
sche Parameter genugend anschaulich: Fur die Fragen 1 und 2 ist die biologische
Halbwertszeit (HWZ) ausreichend; flir die Beantwortung von Frage 3 benotigt man
auBerdem die renale Dosisfraktion.
Die biologische Halbwertszeit
Ausgangspunkt bildet das Einkammermodell, das den GesetzmaBigkeiten der linearen
Kinetik gehorcht. AuBerdem wird vereinfachend angenommen, daB die Absorption
des Arzneimittels unendlich rasch erfolgt. Didaktisch geht es demnach um die Frage,
wie dem Kliniker die praktischen Konsequenzen der Differentialgleichung
-dc/dt = k· c. (5)
erlautert werden konnen.
Yom theoretischen Standpunkt aus erscheint das Problem einfach, da flir ein
durch Gleichung 1 beschreibbares System grundsatzlich nur 2 Fundamentalparameter
benotigt werden:
Ein Parameter der Konduktivitiit, in der Pharmakokinetik als Arzneimittel-Clear
ance V bezeichnet, und
ein Parameter der Kapazitiit, in der Pharmakokinetik als Verteilungsvolumen V
bekannt. In einfacher und vollig naturlicher Weise erhhlt man daraus den Sekun
darparameter der Geschwindigkeitskonstanten k als den Quotienten aus Konduk
tivitat und Kapazitat:
k = Konduktivitat = Clearance V
(6)
Kapazitat Verteilungsvolumen V
Die Erfahrung lehrt aber, daB dieser so naheliegende Weg flir den Kliniker nicht
gangbar ist: Der Begriff des Verteilungsvolumens wird wegen seiner Pseudoanschau
lichkeit immer wieder fehlgedeutet, der Clearancebegriff ist seinem Wesen nach ab
strakter Natur, und die daraus resultierende Eliminationskonstante k (mit der Di
mension einer reziproken Zeit!) wird vom Arzt in der taglichen Praxis mangels An
schaulichkeit nicht akzeptiert.
Dagegen laBt sich die durch Gleichung 1 postulierte Tatsache didaktisch nutzen,
daB in gleichen Zeitabstanden T die Konzentration eines Pharmakons in Plasma stets