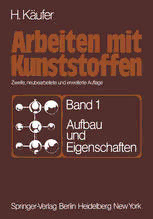Table Of ContentArbeiten mit KunststofIen
Band 1 Aufbau und Eigenschaften
Hehnut Kaufer
Arbeiten
mit Kunststoffen
Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage
Band!
Aufbau und Eigenschaften
Mit 16 Ubersichtstafeln, 62 Bildern
und einem Kunststoffliberblick
Springer-Verlag
Berlin Heidelberg New York 1978
Dr. HELMUT KAUFER
o. Professor flir Kunststofftechnik
Technische Universitlit, Englische StraBe 20, D-lOOO Berlin 12
Die 1. Auflage erschien 1968 im Wilhelm Knapp Verlag, Dusseldorf
ISBN-13:978-3-642-81167-8 e-ISBN-13:978-3-642-81166-1
DOl: 10.1007/978-3-642-81166-1
Library of Congress Cataloging in Publication Data: Kaufer, Helmut. Arbeiten mit Kunst
stoffe n. Contents: Bd. I Aufbau und Eigenschaften. I. Plastics. TP1l20.K33 1978 664'.4
78-921.
Das Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begrtlndeten Rechte, insbesondere die
der Dbersetzung, des N achdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der
Wiedergabe auf photomechanischem oder iihnlichem Wege und der Speicherunp in Daten
verarbeitungsanJagen bleiben auch bei nur auszugsweiser Verwendung vorbehalten.
Bei Vervielfl!ltigungen fur gewerbliche Zwecke ist gemaB § 54 UrhG eine Vergiibmg an den
Verlag zu zahlen, deren Hohe mit dem Verlag zu vereinbaren ist.
© by Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1978.
Softcover reprint of the hardcover 2nd edition 1978
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die
sem Buche berechtigt auch olme besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daB sol
che Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu be
trachten waren und daher von jederrnann benutzl werden diirften.
Gesamtherstellung: Konrad Triltsch, Wiirzburg
206113020/543210
Vorwort zur zweiten Auflage
" ... Dieses Buch ist aus der praktischen Arbeit entstanden in dem BemUhen, Ar
beitsgrundlagen zu schaffe n, welche eine schnelle und verstandliche Information
auf den unterschiedlichen Gebieten, auf denen heute Kunststoffe angewendet wer
den, ermoglichen. Zweifellos ist dieser Versuch in mancher Beziehung gewagt, weil
Gebiete zusammengefaBt wurden, welche bis jetzt immer nur gesondert und unter
speziellen Aspekten betrachtet werden. Dies flihrte zu ungewohnten Zusammenstel
lungen und Darstellungen ..."
Dieser Ausschnitt aus dem Vorwort zur 1. Auflage (1968) kUndigte einen Ver
such an, dessen Ergebnis damals nicht vorauszusehen war. Heute haben sich nicht
nur die Zielsetzung sondem auch Darstellung und Betrachtungsweise des dam a
ligen Versuchs in wesentlichen Punkten durchgesetzt, und es hat sich bestatigt, daB
die UberblicksmaBige Betrachtung der Kunststoffe in ihrem gesamten Bereich unter
anwendungstechnischem Aspekt die Grundlage flir ein erfolgreiches Arbeiten mit
Kunststoffen ist.
Daher haben sich die Zielsetzung und die Schwerpunkte der Darstellung auch
in dieser zweiten Auflage nicht verandert. GegenUber der seit einiger Zeit vergriffe
nen ersten Auflage ist eine vollige Neubearbeitung vorgenommen worden, um der
in der Zwischenzeit sehr lebhaften Entwicklung der Kunststoffwissenschaften und
Kunststofftechnik gerecht zu werden.
Kunststoffe sind heute unbestritten die vielseitigsten und anpassungsflihigsten
Werkstoffe. Ihr Einsatz hat unzahlige neuartige technische Problemlosungen und
Produkte ermoglicht. Diese Entwicklung ist noch voll im Gange und hat zur Folge,
daB flir die technische Gesamtentwicklung die Kunststoffe. die Werkstoffgruppe
sind, die die groBten und auf breitester Basis wirkenden Impulse in den kommen
den Jahren bringen wird. Auch als Werkstoffe selbst werden die Kunststoffe als jun
ge Werkstoffgruppe eine wesentlich intensivere Entwicklung erfahren, als dies bei
den anderen Werkstoffen der Fall sein wird.
Dem steht entgegen, daB die Kunststoffe und ihre speziellen Technologien in
der Lehre und in der Ausbildung gegenUber den klassischen Werkstoffen entspre
chend ihrer heutigen Bedeutung vollig unterreprasentiert sind. Daher fehlt den mei
sten von uns heute auch noch eine sozusagen instinktive Sicherheit auf diesem Ge
biet, ganz anders als bei den klassischen Werkstoffen Metall, Stein und Holz. Ein si
cheres Geflihl flir die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungen der Kunststoffe,
insbesondere in ihren komplexen Strukturen und im Verbund mit den anderen
VI Vorwort
Werkstoffen hat sich wegen ihrer VieWiltigkeit und schnellen Verbreitung jedoch
bisher nicht entwickeln konnen. Ein Hauptanliegen ist es daher, eine solche sichere
Kenntnis der Aufbaumoglichkeiten, der Eigenschaften und der Verarbeitungsmog
lichkeiten von Kunststoffen zu vermitteln.
Nach einer kurzen Ubersicht iiber Geschichte und wirtschaftliche Bedeutung
werden in den Kapiteln 2 und 3 der Aufbau und die anwendungsbezogene Eintei
lung der Kunststoffeerkl~rt, ohne zu sehr auf chemische und physikalische Einzel
heiten einzugehen. Erganzend dazu befindet sich ein Uberblick iiber alle wichtigen
Einzelkunststoffe am SchluB des Bandes. Die praktisch wichtige Bestimmung von
Kunststoffen anhand einfacher Verfahren wird in Kapite14 vermittelt. Der groBte
Teil des Bandes behandelt in den Kapiteln 5 bis 9 dann die technisch wichtigen Ei
genschaften der Kunststoffe. Dabei werden jeweils zusammenhangende Eigenschaf
ten fur samtliche Kunststoffgruppen besprochen. Zu diesem Vergleich werden auch
die klassischen Werkstoffe herangezogen, urn den Standort der Kunststoffe in der
gesamten Werkstoffpalette zu verdeutlichen.
Der zweite Band wird sich mit der Verarbeitung und Anwendung der Kunst
stoffe befassen.
Bei der N eubearbeitung lag mir besonders daran, eine anwendungsbezogene
Gliederung der Kunststoffe mit ihren komplexen Makroaufbauarten in den Vorder
grund zu stell en.
Deshalb werden, ankniipfend an die bereits in der ersten Auflage gegebenen
Gliederungen, differenziertere Unterteilungen und Erweiterungen der Einteilung
der Kunststoffe mitgeteilt und veranschaulicht. So bei ihrer Gruppeneinteilung und
bei der neu verwendeten Gliederung des Makroaufbaus der Kunststoffe in diesem
Buch. Letztere basiert auf einer Einteilung, die der Fachwelt in meinem Buch
"Kunststoffe als Werkstoff" (Vogel-Verlag, Wiirzburg 1974) vorgestellt und begrun
det wurde. Die darauf erfolgten Diskussionen lassen mich nun hier vorschlagen,
den Makroaufbau der Kunststoffe in funf Arten einzuteilen, der ebenfalls die Ver
bundmoglichkeiten auch mit den anderen Werkstoffen klassifiziert. Das Verstand
nis dieser Moglichkeiten ist fur di~ Anwendung wichtig, da es neben den Kunststof
fen keinen anderen Werkstoff gibt, der in samtlichen dieser funf Makroaufbauarten
hergestellt und angewendet werden kann. Es zeigt sich dabei bereits bei der verglei
chen den Betrachtung der Eigenschaften, daB die begriffiiche Anwendung solcher
Makroaufbauarten das Uberlicken der Kunststoffmoglichkeiten sehr erleichtert.
Als Besonderheit der Darstellung ist beibehalten worden, zu versuchen, alle
wichtigen Daten und Zusammenhange in Tabellen oder Abbildungen anschaulich
zusammenzustellen. Dabei sind auch charakteristische Eigenschaften der anderen
Werkstoffe integriert, so daB durch einen Bruckenschlag zu den klassischen Werk
stoffen die Einordnung der Kunststoffe in die gesamte Werkstoffpalette veranschau
licht wird. Die Tabellen und Abbildungen sind auBerdem so angelegt, daB sie auch
ohne den Text verstandlich sind. Daher kann das Buch auch als Nachschlagewerk
fur eine schnell ere erste Information dienen.
Moge diese zweite Auflage eine ebenso freundliche Aufnahme wie die erste fin
den und viele weiterfuhrende Diskussionen in der Fachwelt auslOsen. Fiir letztere,
aber auch fur Anregungen und Hinweise aus dem Leserkreis, bin ich wie bisher be
sonders dankbar.
Vorwort VII
Mein Dank gilt vielen Kollegen in der Industrie, in den Forschungs- und Priif
instituten und insbesondere in den Universitaten sowie meinen Mitarbeitem am
Kunststofftechnikum und in der Kunststotlphysik. Ihnen allen habe ich zu danken
fur vielfaltige Anregungen, Diskussionen und Kritik sowie fur die Oberlassung von
MeBergebnissen und Bildvorlagen. Dem Springer-Verlag danke ich fur die gute Zu
sammenarbeit.
Berlin, im August 1978 H. Kaufer
Inhaltsverzeichnis
1. Geschichte und Wirtschaft . . . . . .
1.1. Einleitung . . . . . . . . . . . 1
1.2. Kunststoffe in der Vorkunststoffzeit 1
1.2.1. Cellu1ose-Kunststoffe aus der Papier-Herstellung 2
1.2.2. Die technische Kautschukanwendung durch die Vulkanisation 3
1.3. Synthetisch hergestellte Kunststoffe . . 6
1.3.1. Phenolharz von L. H. Baeke1and 6
1.3.2. Kunstkautschuk von F. Hoffmann 7
1.3.3. Andere Entwicklungen . . . . . 8
1.4. Entdeckung des Kunststoffaufbaus durch H. Staudinger 8
1.5. Der Durchbruch zum Massenwerkstoff ...... . 9
1.5.l. Po1yviny1ch1orid (PVC) a1s erster Massenkunststoff 9
1.5.2. Aufbau einer Kunststoffpa1ette 10
1.5.3. Heutige Situation . . . . . . . . . . . . . . 11
1.6. Kunststofferzeugung. . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.6.1. Mengenentwicklung im Verg1eich zu anderen Werkstoffen 11
1.6.2. Die Petrochemie a1s die heutige Rohstoftbasis 14
1.6.3. Wiedergewinnung und -verwertung von Kunststoffen 14
1.7. Kostensituation. . . . . . . . . . . . . 15
1.7.1. Zusammensetzung des Produktpreises 15
1.7.2. Vo1umen-und gewichtsbezogene Preise 15
1.8. Anwendung. . . . . . . . . . . . . . . 17
1.8.1. Kunststoffgerechter Einsatz . . . . . 17
1.8.2. Einsatz in den einzelnen industriellen Bereichen 18
1.9. Ausblick. . . . . . . 20
2. Der Autbati der Kunststoffe . . . . . . . . . . 21
2.1. Ein1eitung . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2. Koh1enstoff-Atome sind die Hauptbausteine der Kunststoffe 21
2.2.1. Chemische Grund1agen. . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.2. Werkstoffe aus monomeren und po1ymeren Mo1ekii1en 23
2.3. Makromo1ekii1e ermoglichen den p1astischen Zustand 24
2.3.1. ~ufbau und Herstellung der Makromo1ekii1e . ' ... 24
2.3.2. Dberblick iiber Stoffzustande po1ymerer Mo1ekii16 25
2.3.3. Der p1astische Zustand im Rahmen des KunststoftVerhaltens 27
2.4. Die Kunststoffgruppen. . . . . 28
2.4.1. P1astomere (Thermop1aste) ........... . 28
2.4.2. E1astomere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.4.3. Duromere (Durop1aste) ............. . 32
2.4.4. Zusammenfassender Dberblick der Kunststoffgruppen 32
2.5. Entstehung und Aufbau der krista1linen Bereiche 33
2.5.1. Beweglichkeit der Makromo1ekii1e . . . . . . . . . 34
X Inhaltsverzeichnis
2.5.2. Kristalline Bereiche . . . . . 36
2.5.3. Die amorphen Bereiche 40
2.6. Aufbaumoglichkeit im Makrobereich 41
2.6.1. Homogener Kunststoff . . . . 42
2.6.2. Schaumkunststoffe. . . . . . 42
2.6.3. Verstiirkte und gefiillte Kunststoffe 43
2.6.4. Flachenhafter Verbund. . . . . . 43
2.6.5. Vergleich der Makroaufbauarten 43
2.7. Werkstoffauswa"hl ist Auswahl des Kunststoffes und seines Aufbaus 47
2.8. Die chemische Stoflbezeichnung charakterisiert Einzelkunststoffe bzw.
die Kunststoffart . . . . . . . . . . 49
2.8.1. Handelsnamen als Bezeichnungen 49
2.8.2. Chemische Stofibezeichnungen 50
2.9. Zusammenfassung und Ausblick 51
3. KunststoffzusammenhaIt . . . . . . 53
3.,1. Einleitung . . . . . . . . . . 53
3.2. Die Zusammenhaltskrafte bei Kunststoffen 54
3.2.1. Chemische Bindungskrafte . . . . 54
3.2.2. Elektrische Bindungskrafte . . . . 54
3.2.3. Van-der-Waalssche Bindung 55
3.2.4. Zusammenwirken der einzelnen Zusammenhaltsmechanismen 55
3.3. Der plastische Zustand und seine Beschreibung ....... 57
3.3.1. Unterschied zwischen einer fliissigen und plastischen Phase 57
3.3.2. MakromolekiilgroBe und Viskositiit 57
3.3.3. Schmelzindex . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.3.4. Strukturviskositiit . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3.5. Folgerungen aus dem strukturviskosen Verhalten 58
3.4. Obergange zwischen plastischen und festen Zustanden 59
3.4.1. Kristallisieren und Einfrieren der plastischen Phase 59
3.4.2. Theoretische Behandlung mit dem Enthalpiesatz ..... 60
3.4.3. Erklarung der Oberlagerung von Kristallisation und Einfrieren 61
3.4.4. Zersetzung bei zu hoher Erwarmung 62
3.5. Entropieelastizitat der Kunststoffe . . . . 63
3.5.1. Vergleich von Energie-und Entropieelastizitat . 63
3.5.2. Oberlagerung von Energie-und Entropieelastizitiit 64
3.5.3. Elektrizitiitsmoduln und reversible Verformbarkeit . . . . . . . .. 65
3.6. Anderung der Eigenschaften und Eigenschaftskombinationen durch Anderung
des Zusammenhalts . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.6.1. Variation in der chemischen Zusammensetzung 66
3.6.2. Variation mit kristallinen Anteilen 67
3.6.3. Fiillung und Verstiirkung . . . . . . . . . . 67
3.6.4. Reckung und Verstreckung . . . . . . . . . 68
3.6.5. Zusammenhang mit den verschiedenen Makroaufbauarten 71
3.7. Quellung, Losung, Dispersion und Weichmachung 71
3.7.1. Quellung und Losung . . . . . 71
3.7.2. Filmbildung und Weichmachung 72
3.7.3. Dispersion . . . . . . . . , . 73
3.8. Zusammenhalt an Grenzflachen, das Kleben .' 74
3.8.1. Haftverbindung . . . . . . . . . 74
3.8.2. Chemische Grenzflachenverbindung . 75
3.9. Grenzen des Zusammenhalts, das Versagen 75
3.9.1. Abhiingigkeit von der Belastungszeit . 76
3.9.2. Einwirkungen, welche den Zusammenhalt vermindem 80
3.9.3. Temperaturabhangigkeit . . . . . . . . . . . . . 80
3.9.4. Versagensmechanismen in Abhangigkeit vom Aufbau 81
3.10. Ausblick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Inhaltsverzeichnis XI
4. Kunststoftbestimmung mit einfachen Mitteln 83
4.1. Einleitung . . . . . . . . . . . . . 83
4.2. Allgemeine Vorgehensweise ..... 84
4.3. Verarbeitungsmerkmale und Hinweise auf die Art des Teils 84
4.4. Kunststofferkennung aufgrund des Makroaufbaus 86
4.5. Harte, Griffund optisches Aussehen 87
4.6. Verbrennungs-und Erwarmungstest 90
4.7. Weitere Bestimmungsmethoden 94
4.8. Ausblick . . . . . . . 94
5. Mechanische Eigenschaften . 96
5.1. Einleitung . . . . . . 96
5.2. Abhlingigkeit der Eigenschaften vom Kunststoffaufbau am Beispiel der Dichte 97
5.3. Einachsige mechanische Beanspruchungen . . . . . . . . . . . . 98
5.3.1. Zugfestigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.3.2. Das Superpositionsgesetz flir verstarkte und geflillte Kunststoffe 100
5.3.3. Druckfestigkeit . . . . . . . . . . . 101
5.3.4. Oberflachenharte . . . . . . . . . . 101
5.3.5. Vergleich von Zug-und Druckfestigkeit 103
5.4. Verformungsverhalten . . . . . . . . . . . 104
5.4.1. Verformungen im elastischen Bereich 104
5.4.2. Spannungsdehnungskurven . . . . . . 106
5.5. Abhangigkeit von der Beanspruchungszeit. Zeitstandverhalten 107
5.5.1. Zugfestigkeit in Abhangigkeit von der Belastungszeit 107
5.5.2. Spannungsdehnungskurven in Abhangigkeit von der Belastungszeit 108
5.5.3. Zeitstandfestigkeit, Kriech-und Entspannungskurven 109
5.5.4. Anwendung der Zeitstandfestigkeit ............ 110
5.6. Schwingungsbeanspruchung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.7. Gleitverhalten als Grundlage wartungsfreier Lager-und Gleitelemente 114
5.8. Festigkeitsminderung durch innere Spannungen und Kerbstellen 116
5.8.1. Innere Spannungen und Memory-Effekt . . . . . 116
5.8.2. Schlagpriifungen an gekerbten Proben, Kerbwirkung 117
5.8.3. Kerbwirkungsmechanismus . . 118
5.8.4. Folgerungen flir die Gestaltung 119
5.9. Ausblick. . . . . . . . . 119
6. Wiirmetechnische Eigenschaften . 120
6.1. Einleitung . . . . . . . . 120
6.2. Warmeausdehnung . . . . 120
6.2.1. Warmeausdehnungim Vergleich 121
6.2.2. Beriicksichtigung der Warmeausdehnung bei der Anwendung 122
6.2.3. Schwindung bei der Verarbeitung 122
6.3. Wiirmekapazitiit. . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.4. Wiirmeleitungseigenschaften . . . . . . . . . . 124
6.4.1. Warmeleitrahigkeit. . . . . . . . . . . . 124
6.4.2. Auswirkungen beim Erwarmen und Abkiihlen 125
6.4.3. Anwendungen als Wiirmeisolator . . . . . 126
6.5. Temperaturabhangigkeit der mechanischen Eigenschafte)l 127
6.5.1. Temperaturabhlingigkeit der Zugfestigkeit 127
6.5.2. Elastische und plastische Dehnungen ...... 128
6.5.3. Schubmodulkurven beschreiben wiirmetechnisches Verhalten 130
6.6. Die Anwendungstemperaturbereiche. . . . . . . . . . . . . . 133
6.6.1. EinfluB von Art und Aufbau .............. 133
6.6.2. Das Beanspruchungskollektiv bestimmt die Anwendungstemperaturbereiche 134
6.6.3. Formbestandigkeit in Abhlingigkeit von der Gestalt der Teile 135
6.6.4. Heute iibliche Anwendungstemperaturbereiche 137
6.7. Ausblick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
XII Inhaltsverzeichnis
7. Optische, elektrische und akustische Eigenschaften 140
7.1. Einleitung . . . . . . . . . . 140
7.2. Aussehen und Farbton 141
7.2.1. Masseeinfarbung. . . . . 141
7.2.2. Oberflachenbeschichtungen 141
7.2.3. Bedrucken und Beschriften 142
7.3. Organische Glaser und ihre Eigenschaften 142
7.3.1. Uberbli"k iiber die organischen Glaser 143
7.3.2. Eigenschaften. . . . . . . . . . . 143
7.3.3. Lichtdurchlassigkeit . . . . . . . . 144
7.3.4. Lichtbrechung als Grundlage optischer Systeme 145
7.4. Kunststoffe als mehrfunktionale, optimale elektrische Isolierstoffe 147
7.4.1. Elektrischer Durchgangswiderstand und Durchschlagfestigkeit 147
7.4.2. Zusatzliche Funktionen der elektrischen Isolierstoffe 149
7.4.3. Halbleitende Spezialkunststoffe . . . . . . . . . . . . - 149
7.5. Dielektrische Verluste und Dielektrizitiitszahl . . . . . . . . . 150
7.5.1. Wechselstromverlust bewirkt dielektrische Erwarmung 150
7.5.2. Hohes Speichervermogen ist Grundlage von Kondensatoren 152
7.5.3. Miniaturisierung und Funktionsintegrierung 152
7.6. Elektrostatische Aufladung von Kunststoffoberflachen . . . . . 154
7.6.1. Elektrostatische Spannungsreihe . . . . . . . . . . . . 154
7.6.2. Hauptanwendungsgebiete der elektrostatischen Aufladung 155
7.6.3. Verhinderungder Verschmutzung der Oberflachen durch Aufladung 155
7.7. Akustik der Kunststoffe . . . . . . . 157
7.7.1. Schall und Schallgeschwindigkeit . . . . . . . . 157
7.7.2. Schallanregbarkeit und Schallgabe . . . . . . . . 158
7.8. Schallschutz und Gerauschminderung als Zukunftsgebiete 159
7.8.1. Beseitigung von Liirmquellen ist einfachster Schallschutz 159
7.8.2. Schalldammung mit Kunststoffen benotigt wenig Auf\vand 160
7.9. Ausblick. . . . . . . .. ............... 162
8. Chemische Eigenschaften. . . . . 163
8.1. Einleitung . . . . . . . . . 163
8.2. Verhalten gegen gasformige Stoffe 164
8.2.1. Gasdurchlassigkeit aufgrund der Diffusion 164
8.2.2. Atmende Stoffe gestatten Luftkonvektion . 166
8.2.3. Schadigung durch gasformige Stoffe . . . 166
8.3. Verhalten gegen Fliissigkeiten ........ 167
8.3.1. Bestiindigkeit gegen Chemikalien und LOsungsmittel 167
8.3.2. Bestiindigkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit 172
8.3.3. LOslichkeiten der Kunststoffe . . . . 172
8.3.4. Geruchsprobleme bei Kunststoffteilen 173
8.4. Verhalten gegen feste Stoffe ....... 174
8.5. Chemischer Abbau und seine Wirkungen 174
8.5.1. Mechanismus des chemischen Abbaus 175
8.5.2. Abbau unter mechanischer Belastung 176
8.5.3. Strahlungseinwirkung. . . . . . .. ., 179
8.5.4. Gezielter chemischer Abbau und Regenerierung 180
8.6. Alterung als Zusammenfassung aller Einfliisse wahrend der Anwendung 181
8.6.1. Begriffund Untersuchung der Alterung ...... 182
8.6.2. Moglichkeiten der Beeinflussung der Alterung 182
8.6.3. Vergleich der Alterung bei Kunststoffen und Metallen 185
8.7. Brandverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
8.7.1. Nur zwei Kunststoffe sind vollig unbrennbar 186
8.7.2. Charakterisierung des Brennverhaltens bezieht sich aufdas Gesamtteil 188
8.7.3. Vorteile der Brennbarkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 188