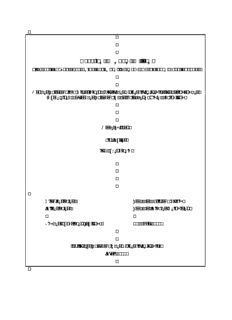Table Of ContentArbeiten, Handeln, Wissen
Tätigkeitstheoretische Untersuchungen zu einem dialektischen Arbeitsbegriff
Von der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Stuttgart zur Erlangung der
Würde eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte Abhandlung
Vorgelegt von
Jan Müller
aus Lüdenscheid
Hauptberichter: Prof. Dr. Christoph Hubig
Mitberichter: Prof. Dr. Michael Weingarten
Tag der mündlichen Prüfung: 30. April 2010
Institut für Philosophie der Universität Stuttgart
März 2010
Inhalt
0. Zusammenfassung .................................................................................................... 3
I. Vom Inbegriff zur Handlungstheorie ......................................................................... 7
1. Historische Rückversicherung ...................................................................................................... 7
2. Perspektiven auf ‚Arbeit’: ‚Arbeit am Inbegriff’ ..................................................................... 23
3. ‚Arbeit’ und ‚arbeiten’: Grammatische Klärungen ................................................................. 44
II. ‚Arbeiten’ als Handeln ........................................................................................... 71
1. ‚Handeln’ und ‚Handlung’ .......................................................................................................... 75
2. Arbeiten und Handeln als Handlungstypen ............................................................................ 102
3. Zweckrationales Prinzip und Gattungsgeschichte: Aufgaben einer ‚Kritischen Theorie’
der Gesellschaft ........................................................................................................................... 107
4. Vermittlungsversuche: Das Ausdrucks- und Entäußerungsmodell des Handelns .............. 124
5. Generalisierungsversuche: Das „Produktionsparadigma“ und sein „Veralten“ ................ 138
III. Handeln und Tätigsein: ‚Arbeit’ als Reflexionsbegriff ........................................ 158
1. Handlungstypen und Weisen des Handelns: Zur Grammatik ihrer Unterscheidung ........ 159
2. ‚Poiesis’ und ‚Praxis’: Revision einer Leitdifferenz ............................................................... 176
3. Prozesse und Tätigkeiten ........................................................................................................... 195
4. Ausblick: ‚Arbeit’ als Reflexionsbegriff .................................................................................. 206
Literaturverzeichnis ................................................................................................. 217
1
2
0. Zusammenfassung
Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Funktion der Verwendung der Ausdrücke
‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ und ihr logisches Verhältnis zu den Begriffen des Handelns und der
Tätigkeit zu klären. Motiviert ist diese Untersuchung durch die sozialwissenschaftlichen und
öffentlichen Debatten über die angemessene Bewertung rezenter Krisendiagnosen vom „Ende
der Arbeitsgesellschaft“. Diese Diskussionen leiden darunter, dass in unterschiedlichsten
Bedeutungen von „Arbeit“, „Lohnarbeit“ und „Tätigkeit“ gesprochen wird. Sie gleichen darin
dem alltäglichen Sprechen, in dem die Verwendung der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’
notorisch vielfältig ist: Sie bezieht sich in ganz unterschiedlicher Weise auf differente
Gegenstandsbereiche und ist in unklarem Ausmaß geprägt durch historische,
geistesgeschichtliche und ideologische Unterscheidungen, die die Vielfalt unserer
Gebrauchsmöglichkeiten bestimmen.
Die Analyse der Form des Gebrauchs beginnt daher mit einer typologischen
Rückversicherung über die Entwicklung dieser Gebrauchsweisen und ihrer Bedeutung (Kap.
I,1). Der Ausdruck ‚Arbeit’ wird damit zunächst als ein ‚Inbegriff’ rekonstruiert, der
unterschiedliche, kategorial inhomogene Inhalte unter dem einheitlichen Interesse
zusammenfasst, Kriterien zur Beschreibung und Beurteilung menschlichen Handelns zu
bündeln. Unter dem Titel ‚Arbeit’ werden demnach a) Handlungen angesprochen, die
individuellen Handlungssubjekten durch eine anthropologische Verfasstheit des Menschen
aufgezwungen werden; b) Handlungen, die als mühsam erfahren werden, und c) Handlungen,
die sozial als Leistungen anerkannt oder ökonomisch honoriert werden. Die Rekonstruktion
exemplarischer soziologischer und philosophischer Klärungsversuche dieser Vielfalt zeigt,
dass eine Vereinheitlichung des Begriffsgebrauchs auf eines oder mehrere dieser Kriterien zu
widersprüchlichen und kontraintuitiven Bestimmungen eines Handelns als ‚Arbeit’ führt, ihre
verallgemeinernde Zusammenführung dagegen nur um den Preis der Investition
metaphysischer oder anthropologischer Grundannahmen gelingen kann (Kap. I,2). Dieses
Scheitern hat seinen Grund in der grammatischen Allgemeinheit des Handlungsausdrucks
‚arbeiten’: Er bezeichnet ein Handeln in nur unspezifischer, ‚nicht-sortierender’ Weise (Kap.
I,3).
Handlungstheoretisch wird damit so umgegangen, dass ‚Arbeit’ als ein besonderer
Typ des Handelns angesehen wird (Kap. II,1). Diese Strategie wird exemplarisch am
3
Vorschlag von Jürgen Habermas diskutiert: ‚Arbeit’ als Typ eines zweckrationalen,
instrumentellen Handelns wird vom Handlungstyp des kommunikativen Handelns dadurch
unterschieden, dass ‚Arbeit’ einer anderen Rationalitätsform folge als Kommunikation (Kap.
II,2). Diese Unterscheidung soll erlauben, die inbegrifflich geläufigen Verwendungen des
Arbeitsbegriffs – seine anthropologische (Kap. II,3) und ökonomistische (Kap. II,4)
Interpretation – als „philosophische Dramatisierungen“ zu kritisieren. Die
handlungstheoretische Bestimmung von ‚Arbeit’ als instrumentellem Handlungstyp ist jedoch
inkonsistent: Entweder gilt die These von der prinzipiellen Verschiedenheit von Arbeit und
Interaktion; dann ist Kommunikation nicht mehr als Handeln verstehbar. Soll dagegen am
Begriff des kommunikativen Handelns festgehalten werden, dann ist der Unterschied der
beiden Handlungstypen nur noch graduell, nicht mehr typologisch verständlich (Kap. II,5).
Die handlungstheoretische Bestimmung des Arbeitens erweist sich als unbrauchbar,
weil sie ‚arbeiten’ als eine bestimmte Sorte von Handlungen konzipiert (Kap. III,1).
Alternativ wird hier gezeigt, warum sich der Ausdruck ‚Arbeit’ und seine inbegriffliche
Bedeutungsvielfalt nicht auf durch handlungstheoretisches Vokabular überformte
Handlungstypen, sondern auf die Vollzugsperspektive eines Tuns bezieht (Kap. III,2). Der
Ausdruck ‚Arbeit’ charakterisiert, wie in der Interpretation der aristotelischen Unterscheidung
von poiesis und praxis (Kap. III,3) gezeigt wird, die Form menschlichen Tätigseins
überhaupt. Diese Bestimmung betrifft näher die Momente der Gesellschaftlichkeit des
Tätigseins, seine Prozessualität und seine Produktivität (Kap. III,4). Die Beurteilung eines
Tuns als ‚Arbeiten’ fungiert reflexionsbegrifflich (Kap. III,5): Es wird damit angezeigt, dass
der Vollzug eines Tuns formal unter dem Aspekt beurteilt wird, wie er zur Form
gesellschaftlicher Praxis und ihrer tätigen Reproduktion steht. Die inbegrifflichen
Thematisierungen erweisen sich so rückblickend als verdinglichende Missverständnisse der
reflexionsbegrifflich durch den Ausdruck ‚Arbeit’ ermöglichten Hinsichten in der Beurteilung
menschlicher Handlungs- und Lebensvollzüge.
4
Summary
This inquiry illuminates the function of the expressions ‚(to) work’, ‚work’ and ‚labour’ and
their logical relation to the concepts of action and activity. It is motivated by recent debates,
both political and in the social sciences, on how to interpret the thesis about an „end of the
working society“ and the related, manifold observations of social crises. These debates suffer
from lack of conceptual and linguistic clarity in the use of their pivotal linguistic means. In
this respect they resemble ordinary language in which usage is as widespread as divergent;
uses of the expression „(to) work“ apply to vastly different subject matters and are implicitly
linked to distinctions that derive from historical and ideological contexts, all of which
determine our actual uses in everyday discourse.
Analysis of the forms of usage thus starts with a brief historical overview, in which the
development of forms of use of said expressions and their meaning is presented (ch. I,1). The
expressions ‚work’ and ‚labour’ are initially treated as epitomes, that is, as concepts that
combine categorically different approaches to different subject matters under one unifying
interest, i. e. to concentrate distinctions and criteria for the evaluation of human action. The
expression ‚work’ serves as a title that denotes a) heteronomous action into which an agent is
thought to be forced by the human condition; b) actions that are experienced as laborious, as
well as c) actions which are socially acknowledged or economically rewarded. Exemplary
reconstruction reveals that attempts to standardize usage of the terms ‚work’ or ‚labour’ using
one or more criteria of their epitomal use typically fall short, leading to inconsistent or
contraintuitive interpretations of the ordinary use. Attempts to expand both the concepts’
intension and extension on the other hand fail in that they are forced to implement strong
claims about the human condition or to invest unfounded metaphysical assumptions to back
up their assertions (ch. I,2). This failure derives from the expressions’ logical grammar: ‚(to)
work’ is a general action concept that denotes activities only in a generic, ‚non-sortal’ way
(ch. I,3).
A Theory of Action deals with this grammatical feature by explaining ‚work’ to be a
type of action (ch. II,1). This kind of approach is exemplified by evaluating Jürgen Habermas’
proposal to conceive ‚work’ as the type of instrumental action, as opposed to the type of
communicative action, the distinction between both being drawn by relating both to different
types of rationality (ch. II,2). This distinction is to correct the effect that anthropological as
5
well as economistic aspects pertaining to certain forms of the epitomal use of ‚work’ have
had, which have facilitated the formation of the so-called „production paradigm“ (ch. II,3-4).
The definition of ‚work’ as instrumental action in terms of action theory ultimately however
turns out to be inconsistent: either communication and instrumental action are governed by
different types of rationality, thus making it impossible to conceive of communicating as
acting – or communication is indeed an action, thus revealing the distinction to be gradual
rather than typical (ch. II,5).
While the conception of ‚work’ that seeks to formulate ‚working’ as a type of action is
internally incoherent, the reason for its contradictory conclusions lies in the fact that
philosophical Theories of Action fall short of understanding the logical grammar of their
pivotal concepts: acting, action, process an activity (ch. III,1). This is because the use of the
expression ‚work’ indicates the actual execution of an activity rather than referring to an
action type; it reflects upon ‚acting’ rather than ‚an act’ (ch. III,2). The expression ‚work’, just
as the Aristotelian distinction between poiesis and praxis, indicates aspects of the form of
human activity, more precisely: it characterizes the form of activity in specifying
processuality, sociality and productivity as its essential aspectual properties (ch. III,3). In
evaluating an action as activity the expression ‚(to) work’ serves as a reflective concept (ch.
III,4): Its use indicates a form of judgement in which the exercise of an activity is conceived
as related to social praxis and its active reproduction. Thus, the epitomal uses of the concepts
‚work’ and ‚(to) work’ are now in retrospect shown to imply reificating misconceptions of
these reflective judgements about human activity, judgements, which were indicated by and
facilitated in the practical use of the reflective conception of ‚work’.
6
I. Vom Inbegriff zur Handlungstheorie
„Ein philosophisches Problem hat die Form: ‚Ich
kenne mich nicht aus’.“ (Wittgenstein 1953, § 123)
1. Historische Rückversicherung
Dass der Ausdruck ‚Arbeit’ – mit den Worten Manfred Riedels – „nicht primär“ einen
„wissenschaftlichen, explizit normierten Prädikator“ bezeichnet, sondern als
„umgangssprachliche[r] Ausdruck“ auftaucht, „dessen Bedeutung in der Vergangenheit (nach
dem Zeugnis überlieferter Texte zu schließen) außerordentlich wechselhaft gewesen und
(nach unserer eigenen Sprecherfahrung) bis heute höchst schwankend, ja heftig umstritten und
wortpolitisch umkämpft ist“ (Riedel 1973, 126), ist eine für wort- und begriffsgeschichtliche
Untersuchung der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ übliche Einschränkung.1 Dass diese
Apologie immer wieder auftaucht, ist Indiz für ein methodisches Problem: Wir kennen,
alltags- und wissenschaftsfachsprachlich, zahllose Verwendungen der Ausdrücke ‚arbeiten’
und ‚Arbeit’; wir wissen also, wie auch immer undeutlich und unausdrücklich, um die
Unterscheidungs- und Ordnungsfunktionen, die diese Ausdrücke in unserem Sprechen
erfüllen. Diese Kenntnis markiert den methodischen Anfang des Unternehmens, die
Geschichte dieser Gebrauchsweise zu erzählen; und es ist mithin kaum verwunderlich, dass
diese Rekonstruktionen im wesentlichen genau die Unsicherheit des heutigen Gebrauchs in
historischen Verwendungen dieser Ausdrücke (oder des betroffenen Wortfeldes)
wiederfinden. Diese Unsicherheit zeigt sich in einer typisierenden Geschichte historischer
Gebrauchsweisen und ihres Verhältnisses; wir führen sie an, um uns gleichsam unserer
eigenen sprachlichen Unsicherheiten zu versichern.
1. Der antike Sprachgebrauch kennt den Ausdruck ergázesthai, der „verschiedenste
Arten des Arbeitens bezeichnen konnte“; „die dadurch gestiftete Gemeinsamkeit
1 Solche wort- und begriffsgeschichtlichen Vorklärungen gehören gleichsam zur Gattungskonvention der
historischen, soziologischen und i. e. S. philosophischen Beschäftigung mit ‚Arbeit’. Sie stimmen in ihren
Ergebnissen – auch durch stabilisierende Querverweise aufeinander – im Wesentlichen überein. Ich nenne
exemplarisch: Barzel 1973, Conze 1972, Engels 2006, Frambach 1990, Fritz 2006, Hund 1990, Kocka 2003,
Meier 2003, Moser 1964, Riedel 1973, Walther 1990; desgl. die Beiträge in Schubert 1986.
7
reichte jedoch nicht weit“ (Meier 2003, 19). Man sieht bereits, wie die Erläuterung des
griechischen Wortgebrauchs weniger eine Klärung unseres Gebrauchs des Ausdrucks
‚Arbeit’ herbeiführt, als vielmehr von ihm ausgeht und ihn investiert. Die Funktion
des Verbs ergázesthai ist die Klassifizierung von Handlungsweisen; es sortiert
Handlungsweisen nach ihrem allgemeinen Zweck: „das Erwerben von Nahrung oder
allgemeiner gesagt: von Lebensunterhalt“ (Meier 2003, 25). Die Beurteilung dieser
Handlungsweisen ist dabei in archaischer Zeit noch durchaus zwiegespalten, wie auch
die Sortierung von Tätigkeiten nach dem allgemeinen Zweck der Erzielung und
Sicherung des ‚Lebensunterhaltes’ inhomogen ist und Ausnahmen zulässt. So sei noch
bei Hesiod und Xenophon, berichtet Jean-Pierre Vernant, die landwirtschaftliche
Tätigkeit in einen religiösen Kontext gestellt worden – sie ist eine besondere Form der
Verhältnispflege zu den transzendenten Gestalten des Götterkosmos. Ebenso positiv
wie die Landwirtschaft sei das Kriegshandwerk beurteilt worden; beide stehen auf
einer Stufe und – etwa in der Ökonomie des Xenophon – dem Handwerk im engeren
Sinn als einer ‚niederen Tätigkeit’ gegenüber.2 Der Grund für diese unterschiedliche
Bewertung von Tätigkeiten liegt in der Entwicklung der arbeitsteiligen Gesellschaft
und ihrer politischen Formen. Dabei wird früh zum Maßstab, dass manche Tätigkeiten
als notwendig erfahren werden in dem Sinn, dass sie – um den Preis einer
Beschädigung des Gemeinwesens – nicht unterlassen werden können. Das ist noch
kein Grund für eine Abwertung; diese kommt erst zustande, wenn menschliches
Handeln überhaupt einer wertenden Sortierung und Reflexion unterworfen wird. Die
wegweisende Unterscheidung ist die aristotelische zwischen poiesis und praxis. Man
fasst diese Unterscheidung üblicherweise so auf, dass sie Handlungstypen nach ihrer
Zweck-Mittel-Struktur differenziert: als poiesis (‚Herstellung’) gelten Handlungen,
die ihren Zweck ‚außer sich’ haben, also in einem Produkt resultieren; praxis dagegen
bezeichnet Handlungen, die ihren Zweck ‚in sich’ haben, deren Ausführung selbst ihr
Zweck ist.3 Diese Unterscheidung liefert zugleich eine Unterscheidung von unfreiem,
also heteronomem und durch äußere Notwendigkeit gesetztem Handeln, und dem
autonomen Handeln im engeren Sinn. Erst in Verbindung mit dieser allgemeineren
Reflexion ergibt sich die Abwertung gewisser Tätigkeiten4 in genau dem Maß, in dem
2 Vgl. Vernant 1955, 262.
3 Vgl. Aristoteles, EN I 2, 1095b 17f. und Met. IX 6, 1048b 17ff.; die „Nikomachische Ethik“ wird in der
Übersetzung von Wolf, die „Metaphysik“ nach der Übertragung von Bonitz zitiert. – Diese übliche Deutung
ist ein Gemeinplatz. Wir kommen auf die Differenzierung des Aristoteles in Kap.III,2 zurück.
4 Vgl. Frambach 1990, 40f.
8
Description:Von der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Stuttgart zur Erlangung der. Würde eines Doktors der und potentiell reduktionistischen Modellen notwendig verfehlt werden müsse: Steinmetz sowie e. Nachw. zu