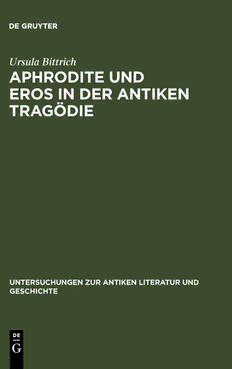Table Of ContentUrsula Bittrich
Aphrodite und Eros in der antiken Tragödie
w
DE
G
Untersuchungen zur
antiken Literatur und Geschichte
Herausgegeben von
Gustav-Adolf Lehmann, Heinz-Günther Nesselrath
und Otto Zwierlein
Band 75
Walter de Gruyter · Berlin · New York
Aphrodite und Eros
in der antiken Tragödie
Mit Ausblicken auf motivgeschichtlich
verwandte Dichtungen
von
Ursula Bittrich
Walter de Gruyter · Berlin · New York
® Gedruckt auf säurefreiem Papier,
das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.
ISBN 3-11-018555-5
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
© Copyright 2005 by Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, D-10785 Berlin.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Ubersetzungen, Mikrover-
filmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Einbandentwurf: Christopher Schneider, Berlin
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen
Vorwort
Dieses Buch ist die geringfügig veränderte Fassung meiner Dissertation,
die der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn im Wintersemester 2004/5 zur Begutachtung vorlag.
Das Thema geht zurück auf einen Vorschlag von Frau Dr. Athena
Kavoulaki, der ich an dieser Stelle herzlich danken will.
Finanzielle Unterstützung haben mir die Studienstiftung des deutschen
Volkes, die Graduiertenförderung der Universität Bonn sowie die griechi-
schen Stiftungen I.K.Y, und A.G. Leventis gewährt. Ihnen allen bin ich
auf besondere Weise verpflichtet.
Meine Familie und meine Eltern haben die Entstehung der Disserta-
tion stets mit viel Anteilnahme und Engagement begleitet.
Bei der Erstellung des Manuskripts für die Drucklegung hat mich Herr
Hans Rieger kompetent beraten.
Für Unterstützung und hilfreiche Hinweise in den verschiedenen Sta-
dien der Arbeit möchte ich den Herren Professoren G.O. Hutchinson und
R. Parker (Oxford), H. Neitzel (Bonn), sowie D.I. Iakob und A. Rengakos
(Thessaloniki) meinen aufrichtigen Dank aussprechen.
Allen voran aber danke ich meinem Doktorvater Herrn Prof. O. Zwier-
lein, der es an konstruktiven Ratschlägen und aufmunterndem Zuspruch
nie hat fehlen lassen.
Thessaloniki, im Juni 2005 Ursula Bittrich
Inhaltsverzeichnis
I. Vor der Tragödie. Aphrodite und Eros im Spannungsfeld
zwischen kosmischem und individuellem Wirken 1
I. 1. Aphrodite (Hesiod, Homer, V. Homerischer Hymnus,
Kirke-Episode der Odyssee) 1
I. 2. Eros (Hesiod, Vorsokratiker, Orphik,
Frühgriechische Lyrik) 12
I. 3. Interaktion und Gemeinsamkeiten der
Liebesgottheiten; Vorgriff auf die Tragödie 14
II. Die Macht der Aphrodite und die Unbezwinglichkeit
des Eros 17
II. 1. Aischylos, Danaidentetralogie 17
II. 2. Sophokles, Das Eroslied der Antigone; fr. 941;
Trachinierinnen 30
II. 3. Euripides, Diktys; Hippolytos Stephanephoros;
Troades 47
II. 4. Seneca, Phaedra 91
III. Die Doppelgesichtigkeit der Aphrodite und ihrer
Wirkkraft, des Eros 105
III. 1. Euripides, Hippolytos Stephanephoros;
Medea; fr. 897 109
III. 2. Der zweifache Eros: Euripides, Stheneboia;
fr. 388; Iphigenie in Aulis 121
III. 3. Die zwei Pfeile Cupidos in Ovid,
met. 1, 469-471 129
IV. Eros-Feindschaft - zürnende Göttin und
deus ultor 131
IV. 1. Euripides, Hippolytos Stephanephoros 131
IV. 2. Der bezwungene Rebell 137
IV. 2. a) Theokrit, Idyll I 137
VIII Inhaltsverzeichnis
IV. 2. b) Ovid, Metamorphosen 151
IV. 2. c) Nonnos, Dionysiaka 155
IV. 3. Versteinerungsgeschichten: Die Sage von der salami-
nischen Jungfrau bei Hermesianax und Ovid 167
IV. 4. Die Rache der unerhört Liebenden 176
IV. 4. a) Ovid, Metamorphosen 3, 339-510 177
IV. 4. b) Anthologia Palatina XVI 251 und XII 144 179
IV. 5. Der Gott der Gegenliebe bei Eunapius von Sardes,
Meleager von Gadara und Themistius 181
IV. 6. Der Gott der Genugtuung bei Seneca, Tibull
und Ovid 183
Conclusio 189
Literaturverzeichnis 194
Indices 205
I. Vor der Tragödie
Aphrodite und Eros im Spannungsfeld zwischen
kosmischem und individuellem Wirken1
I. 1. Aphrodite (Hesiod, Homer, V. Homerischer Hymnus
Kirke-Episode der Odyssee)
In dieser Studie über Aphrodite und Eros soll am Beispiel der Tragödie
und motivgeschichtlich verwandter Texte gezeigt werden, wie das Bild
dieser beiden so facettenreichen Göttergestalten unter Wahrung bestimm-
ter Konstanten, die in den Kapitelüberschriften festgehalten sind, sich
tradiert und gewandelt hat.
Gegenstand der Betrachtung wird dabei hauptsächlich die literarische
Gestaltung und jeweils werkspezifische Gewichtung jener unveränderlichen
Grundzüge sein, und nur am Rande werden wir uns die Frage stellen,
ob und auf welche Weise vor- oder nebenliterarische Erscheinungen wie
Mythos, Kult und philosophische Strömungen in die zu besprechenden
Dichtungen mit eingeflossen sind.
Nun findet sich gerade in der Tragödie eine solche Formenvielfalt im
Auftreten der beiden Liebesgötter, daß der Interpret wohl kaum Gefahr
läuft, in den Fesseln einer gattungsspezifischen Festlegung eine einseitig
verkürzte Darstellung zu bieten.
Aphrodite als Göttin mit kosmischer Ausfaltung hat bei den Tragikern
ebenso ihren Platz wie die ausschließlich für Liebesdinge zuständige, mit
stark anthropomorphen Zügen behaftete Bereichsgöttin des homerischen
Epos.
1 Für die Literaturangaben wurde folgendes Verfahren gewählt: Alle Werke und
Aufsätze der Sekundärliteratur werden bei erstmaliger Nennung vollständig zi-
tiert, danach ohne Ort und Jahr und ggf. mit einer abgekürzten Titelbezeich-
nung. Die Kommentare sind mit allen Angaben im Literaturverzeichnis auf-
geführt, im Text erscheint lediglich der Autorenname und das Jahr. Die jeweils
zugrunde gelegten Textausgaben sind innerhalb des Literaturverzeichnisses mit
einem Sternchen gekennzeichnet. Aufsätze, die nicht öfter als einmal zitiert werden
und nur für einzelne Stellen relevant sind, wurden nicht in das Literaturverzeichnis
aufgenommen.
2 Vor der Tragödie
Einen wichtigen Ausgangspunkt für die beiden Vorstellungen von
Aphrodite als einerseits urgewaltiger und naturbeherrschender, anderer-
seits einem klar umrissenen Bereich zugeordneter Göttin bilden zwei ge-
nealogische Traditionen:
In Hesiods Theogonie nimmt der Mythos von ihrer Entstehung seinen
Anfang mit der Entmannung des Uranos durch seinen Sohn Kronos. Die
Blutstropfen der Gewalttat zeugen im Schoß der Gaia die Erinyen, die
chthonischen Gottheiten par excellence, die Giganten und die „Eschen-
nymphen".
Aus dem Schaum, der sich um die ins Meer geworfene Scham gebildet
hat, entsteigt an der Küste Zyperns Aphrodite. Sie ist also ein Sproß
der Verbindung von Himmel und Meer, und zum Zeichen ihres fruchtbar-
keitsspendenden Vermögens ergrünt unter den Tritten der eben ans Land
Gestiegenen die Erde:
Hesiod, Theogonie 194-95
έκ δ' ϊβη αΐδοΐη καλή θεός, άμφΐ δέ ποίη
ποσσίν υπό (ίαδινοΐσιν άέξετο. ...
Aus stieg die ehrsame, schöne Göttin, rings aber sproß das
Gras unter schlanken Füßen empor ...2
In dieser genealogischen Tradition, die auch die Orphiker kennen,3 wird
Aphrodite unmittelbar in den Kreis der Elemente Himmel, Meer und Erde
hineingestellt. Zusammen mit Kronos und Rheia gehört sie in die zweite
Generation nach Uranos und Gaia, ist also im Stammbaum der Götter
dem Kronos-Sohn Zeus eindeutig übergeordnet. Daß sie aus der Trennung
von Himmel und Erde, der ersten kosmischen Differenzierung, entstanden
ist, hat für ihr Wesen richtungweisende Bedeutung: Sie ist die Macht
2 Die Übersetzungen sind, wenn nicht anders gekennzeichnet, von der Verf. Vgl.
auch Ap. Rh. I, 1142 f., wo als ein Zeichen für Kybeles Erhörung der ihr Opfer
darbringenden Argonauten die Erde üppig Gras hervorsprießen läßt: άμφΐ δέ ποσ-
σίν / αύτομάτη φύε γαία τερείνης δνθεα ποίης.
3 Cf. Orphicorum Fragmente., ed. Ο. Kern, fr. 127 (Kapitel "Ιεροί λόγοι έν £α-
ψωιδίαις). Vgl. auch Orph. hymn., ed. W. Quandt, 55 (Εις Άφροδίτην), v. 5-7:
γενναις δέ τα πάντα, / δσσα τ' έν ούρανώι έστι χαΐ έν γαίηι πολυκάρπωι / έν πόντου
τε βυθώι. Freilich umfassen die auf verschiedenen Quellen beruhenden Rhapsodien
auch die alternative genealogische Tradition, nach der Aphrodite Tochter des Zeus
ist, doch entsteigt sie wie die Urania dem Meer, in das der Same des Zeus gefallen
sein soll: fr. 183 (Kern). Siehe dazu M.L. West, The Orphic Poems, Oxford 1983,
71/72. 73. 91.