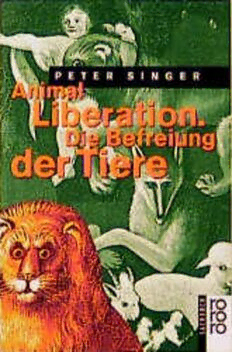Table Of ContentVorwort zur ersten Ausgabe 7
Vorwort zur Ausgabe von 1996 15
Vorwort zur deutschen Ausgabe von 2015 23
Alle Tiere sind gleich 27
1
oder warum das ethische Prinzip, auf dem die Gleichheit der Menschen beruht, von uns fordert, die
gleiche Berücksichtigung auch auf Tiere auszudehnen
Werkzeuge für die Forschung 53
2
Wozu Ihre Steuergelder auch verwendet werden
In der Tierfabrik 125
3
oder wie es Ihrem Abendessen erging, als es noch ein Tier war
Die Entscheidung für eine vegetarische Lebensweise 191
4
oder wie wir weniger Leid und mehr Nahrung erzeugen und zugleich den Schaden für die Umwelt
verringern können
Die Herrschaft des Menschen 219
5
Eine kurze Geschichte des Speziesismus
Speziesismus heute 249
6
Abwehr, Rationalisierungen und Einwände gegen die Befreiung
der Tiere und die Fortschritte bei deren Uberwindung
Anhang 1 Zum Weiterlesen 289
Anhang 2 Leben ohne Grausamkeit 293
Anhang 3 Organisationen 295
Anmerkungen 303
Danksagung 327
Vorwort zur ersten Ausgabe
Das Thema dieses Buches ist die Tyrannei der Menschen über nichtmenschliche Tiere. Das Ausmaß
von Schmerzen und Leid, das diese Tyrannei in der Vergangenheit verursacht hat und noch heute
verursacht, kann nur mit dem Leid verglichen werden, das die jahrhundertelange Tyrannei der
Weißen über die Schwarzen bedeutet hat. Der Kampf gegen diese Tyrannei ist genauso wichtig wie
jede moralische und soziale Frage, um die in der jüngeren Vergangenheit gestritten wurde.
Ich hatte gerade angefangen, an diesem Buch zu arbeiten - wir lebten zu der Zeit in England -, als
meine Frau und ich von einer Dame zum Tee eingeladen wurden, die gehört hatte, dass ich plante,
etwas über Tiere zu schreiben. Sie selbst interessierte sich, wie sie sagte, sehr für Tiere, und eine
Freundin von ihr, die auch schon ein Buch über Tiere geschrieben hatte, wollte uns unbedingt
kennenlernen.
Als wir ankamen, war die Freundin unserer Gastgeberin schon da, und tatsächlich war sie ganz
erpicht darauf, über Tiere zu reden. »Ich liebe Tiere«, begann sie zu erzählen. »Ich habe einen Hund
und zwei Katzen, und Sie können sich nicht vorstellen, wie wunderbar sie sich miteinander
vertragen. Kennen Sie Mrs. Scott? Sie hat ein kleines Krankenhaus für kranke Haustiere ...«, und so
ging es weiter. Als ein Imbiss serviert wurde, machte sie eine kleine Pause, nahm ein Schinken-
sandwich und fragte uns dann, welche Haustiere wir hätten.
Wir sagten ihr, dass wir keine Haustiere haben. Sie schaute etwas überrascht und biss in ihr
Schinkensandwich. Unsere Gastgeberin war gerade fertig damit, die Sandwiches zu servieren, setzte
sich zu uns und nahm die Unterhaltung auf: »Aber Sie interessieren sich doch für Tiere, Mr.
Singer?«
Wir versuchten ihr zu erklären, dass uns die Verhinderung von Leid und Elend interessierte, dass
wir gegen willkürliche Diskriminierung waren, dass wir es für falsch hielten, einem anderen
Lebewesen unnötiges Leiden aufzuerlegen, auch wenn es nicht zu unserer eigenen Spezies gehört,
und dass wir glaubten, dass Tiere von den Menschen rücksichtslos und grausam ausgebeutet
würden, und dass wir wollten, dass sich das ändert. Darüber hinaus, sagten wir, würden wir uns
nicht sonderlich für Tiere »interessieren«. Wir hatten beide niemals eine besondere Vorliebe für
Hunde, Katzen oder Pferde entwickelt, so wie das bei vielen Leuten der Fall ist. Wir »lieben « Tiere
nicht. Wir wollten einfach, dass sie als die unabhängigen und empfindenden Lebewesen behandelt
werden, die sie nun einmal sind, und nicht als Mittel zu menschlichen Zwecken - wie zum Beispiel
das Schwein, dessen Fleisch nun auf den Sandwiches unserer Gastgeberin lag.
Dieses Buch handelt nicht von Haustieren. Es ist wahrscheinlich keine angenehme Lektüre für
Leute, die glauben, dass Tierliebe nicht mehr bedeutet, als eine Katze zu streicheln oder die Vögel
im Garten zu füttern. Dieses Buch richtet sich vielmehr an Leute, denen daran liegt, dass
Unterdrückung und Ausbeutung beendet werden, wo immer sie vorkommen, und die einsehen, dass
das grundlegende moralische Prinzip der gleichen Berücksichtigung von Interessen nicht
willkürlich auf die Mitglieder unserer eigenen Spezies beschränkt werden kann. Die Annahme, dass
Menschen, die sich für diese Fragen interessieren, »Tierfreunde« sein müssen, ist selbst schon ein
Hinweis darauf, dass viele nicht die leiseste Idee davon haben, dass die moralischen Regeln, die für
den Umgang der Menschen miteinander gelten, sich auch auf andere Tiere erstrecken könnten. Wer,
außer vielleicht einem Rassisten, der seine Gegner als »Niggerfreunde« beschimpft, würde wohl
unterstellen, dass man misshandelte Minderheiten lieben muss oder sie niedlich und knuddelig zu
finden hat, um sich für ihr Recht auf Gleichheit einzusetzen. Warum sollten wir also so etwas bei
Menschen annehmen, die sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Tiere einsetzen?
Menschen, die gegen Grausamkeit gegenüber Tieren protestieren, als sentimentale, gefühlsbetonte
»Tierfreunde« darzustellen, hatte die Wirkung, dass die ganze Problematik unseres Umgangs mit
nichtmenschlichen Lebewesen aus der ernsthaften politischen und moralischen Diskussion
ausgeschlossen wurde. Und es ist leicht einzusehen, warum das geschieht. Denn wenn wir diese
Fragen ernsthaft erwägen würden, wenn wir zum Beispiel einmal einen genaueren Blick auf die
Bedingungen werfen würden, unter denen Tiere in der modernen Massentierhaltung leben, in der
unser Fleisch produziert wird, wäre uns möglicherweise gar nicht mehr ganz wohl angesichts der
Schinkensandwiches, des Roastbeefs, der Brathähnchen und all der anderen Bestandteile unserer
Ernährung, die wir uns lieber nicht als tote Tiere vorstellen.
Dieses Buch appelliert nicht an Gefühle, es will keine Sympathie für »niedliche« Tiere wecken. Ich
kann mich über das Schlachten von Pferden oder Hunden zur Fleischgewinnung nicht mehr
aufregen als über das Schlachten von Schweinen. Und es besänftigt mich keineswegs, wenn das
amerikanische Verteidigungsministerium als Reaktion auf Proteste gegen die Durchführung von
Giftgasexperimenten an Beagles anbietet, anstelle der Beagles Ratten zu verwenden.
Dieses Buch ist der Versuch, die Frage, wie wir mit nichtmenschlichen Tieren umgehen sollten,
sorgfältig und in sich widerspruchsfrei zu durchdenken. Nach und nach werden dabei die Vorurteile
sichtbar, die hinter unseren gegenwärtigen Einstellungen und Verhaltensweisen stehen. In den
Kapiteln, die beschreiben, was diese Einstellungen in der Praxis bedeuten - wie Tiere unter der
Tyrannei des Menschen leiden -, wird es Abschnitte geben, die durchaus Gefühle wecken. Ich hoffe,
dass dies Gefühle der Wut und Empörung sein werden, die zu dem Ent- schluss führen, etwas gegen
die beschriebenen Praktiken zu unternehmen. Nirgends in diesem Buch werde ich aber an die
Gefühle der Leser und Leserinnen appellieren, wo diese sich nicht auf Vernunft stützen können.
Wenn unangenehme Dinge beschrieben werden müssen, wäre es unaufrichtig, sie in einer möglichst
neutralen Art und Weise zu beschreiben und damit ihre tatsächliche Unerfreulichkeit zu verbergen.
Wir können nicht objektiv über die Versuche berichten, die Nazi-Ärzte in den Konzentrationslagern
mit Menschen machten, die sie als »Untermenschen« ansahen, ohne damit Gefühle aufzurütteln;
und das Gleiche gilt für die Beschreibung mancher Versuche, die heute an nichtmenschlichen
Lebewesen in Laboratorien in Amerika, England, Deutschland und anderswo durchgeführt werden.
Die eigentliche Rechtfertigung für den Widerstand gegen solche Experimente ist jedoch nicht an
Gefühle gebunden. Sie beruft sich vielmehr auf grundlegende moralische Prinzipien, die wir alle
akzeptieren, und es ist eine Forderung der Vernunft und nicht des Gefühls, diese Prinzipien auf die
Opfer beider Arten von Experimenten anzuwenden.
Für den Titel dieses Buches gibt es einen ernsthaften Hintergrund. Eine Befreiungsbewegung ist
eine Forderung danach, Vorurteile und Diskriminierungen aufzugeben, die auf willkürlichen
Merkmalen wie Rasse oder Geschlecht beruhen. Das klassische Beispiel dafür ist die Befrei-
ungsbewegung der Schwarzen. Die unmittelbare Wirkung dieser Bewegung und ihre ersten, wenn
auch begrenzten Erfolge machten sie zu einem Modell für andere unterdrückte Gruppen. Schnell
wurden wir vertraut mit der Befreiungsbewegung der Homosexuellen und Bewegungen, die sich für
die amerikanischen Indianer und die spanischsprechenden Amerikaner einsetzten. Als schließlich
eine Mehrheit, nämlich die Frauen, ihren Kampf begann, dachten einige, wir seien am Ende des
Weges angekommen. Die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, so hieß es, sei die letzte Form
einer allgemein akzeptierten und praktizierten offenen und unverhohlenen Diskriminierung, die
sogar in jenen liberalen Kreisen üblich war, die sich lange schon damit rühmten, von Vorurteilen
gegenüber rassischen Minderheiten frei zu sein.
Wir sollten grundsätzlich äußerst vorsichtig damit sein, von der »letzten noch verbliebenen Form
der Diskriminierung« zu sprechen. Wenn wir irgendetwas aus den Befreiungsbewegungen gelernt
haben, dann sollten wir heute wissen, wie schwer es ist, uns unterschwelliger Vorurteile in unseren
Einstellungen gegenüber bestimmten Gruppen bewusst zu werden, solange wir nicht mit allem
Nachdruck auf diese Vorurteile hingewiesen werden.
Eine Befreiungsbewegung verlangt von uns die Erweiterung unseres Horizonts. Auf einmal sind
Praktiken, die wir gestern noch für natürlich und unvermeidlich hielten, das Ergebnis nicht zu
rechtfertigender Vorurteile. Wer kann schon von sich mit einiger Zuversicht behaupten, dass keine
seiner oder ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen berechtigterweise hinterfragt werden könnte?
Wenn wir nicht zu den Unterdrückern gehören wollen, müssen wir bereit sein, unsere sämtlichen
Einstellungen gegenüber anderen Gruppen zu überdenken, auch die grundlegendsten. Wir müssen
unsere Einstellungen aus der Sicht jener betrachten, die unter ihnen und den Verhaltensweisen, die
aus ihnen folgen, leiden. Wenn uns dieser ungewohnte geistige Perspektivenwechsel gelingt, könnte
es sein, dass wir in unseren Einstellungen und Verhaltensweisen eine Struktur finden, die sich
immer zugunsten derselben - normalerweise unserer eigenen — Gruppe auswirkt, und das auf
Kosten einer anderen Gruppe. Daran sehen wir, dass es sich hier um einen Fall für eine neue Befrei-
ungsbewegung handelt.
Das Ziel dieses Buches besteht darin, dass Sie diesen geistigen Perspektivenwechsel hinsichtlich
Ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber einer sehr großen Gruppe von Lebewesen
vollziehen: gegenüber den Mitgliedern anderer Spezies. Ich glaube, dass unsere gegenwärtige
Haltung gegenüber diesen Lebewesen auf einer langen Geschichte von Vorurteilen und
willkürlicher Diskriminierung beruht. Ich behaupte, dass es — abgesehen vom egoistischen Streben
der ausbeutenden Gruppe, ihre Privilegien zu bewahren — keinen Grund geben kann, die
Ausdehnung des Grundprinzips der gleichen Berücksichtigung auf Mitglieder anderer Spezies zu
verweigern. Es geht mir darum, Ihnen deutlich zu machen, dass Ihre Einstellungen gegenüber
Mitgliedern anderer Spezies eine Form von Vorurteilen sind, die nicht weniger abzulehnen sind als
Vorurteile gegenüber der Rasse oder dem Geschlecht einer Person.
Verglichen mit anderen Befreiungsbewegungen ist die Tierbefreiungsbewegung in mancherlei
Hinsicht benachteiligt. Zuallererst und ganz offensichtlich sind die Mitglieder der ausgebeuteten
Gruppe nicht zu einem organisierten Protest gegen ihre Behandlung in der Lage (obwohl jedes
einzelne von ihnen durchaus in der Lage ist, sich im Rahmen seiner Fähigkeiten gegen bestimmte
Dinge zu wehren, und dies auch tut). Wir müssen also aufstehen und zugunsten derer sprechen, die
selbst nicht für sich sprechen können. Wenn Sie sich vorstellen, wie lange die schwarze
Bevölkerung der Welt auf ihre Gleichberechtigung hätte warten müssen, wenn diese Menschen
nicht in der Lage gewesen wären, sie selbst zu fordern, dann können Sie einschätzen, wie
schwerwiegend dieses Hindernis ist. Je weniger eine Gruppe in der Lage ist, sich organisiert gegen
ihre Unterdrückung zu wehren, desto leichter wird sie unterdrückt.
Für die Aussichten der Tierbefreiungsbewegung ist aber noch bezeichnender, dass fast alle
Mitglieder der unterdrückenden Gruppe in diese Unterdrückung direkt verstrickt sind und davon zu
profitieren glauben. Nur wenige Menschen können die Unterdrückung von Tieren mit der
Unparteilichkeit betrachten, die zum Beispiel die weißen Nordstaatler besaßen, als sie über die
Sklaverei in den Südstaaten debattierten. Aber \Menschen, die tagtäglich Stücke von geschlachteten
nichtmenschlichen Lebewesen essen, fällt es ziemlich schwer zu glauben, dass sie damit etwas
Falsches tun, und sie können sich auch kaum vorstellen, was sie denn sonst essen könnten. In dieser
Frage sind alle, die Fleisch essen, parteiisch. Sie profitieren - oder zumindest glauben sie es — von
der gegenwärtigen Missachtung der Interessen nichtmenschlicher Tiere. Das macht es schwerer, sie
zu überzeugen. Wie viele Sklavenhalter in den amerikanischen Südstaaten ließen sich denn von den
Argumenten überzeugen, die ihnen die Befürworter der Sklavenbefreiung aus dem Norden
entgegenhielten und die heute von fast allen von uns akzeptiert werden? Einige, aber nicht viele. Ich
fordere Sie auf, von Ihrem Interesse am Fleischessen abzusehen, wenn Sie die Argumente dieses
Buches prüfen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dies auch bei noch so gutem Willen keine
ganz einfache Sache ist. Denn viele Jahre, in denen wir uns ans Fleischessen gewöhnt haben, stehen
hinter jedem momentanen Wunsch, in einer bestimmten Situation Fleisch zu essen, und haben
unsere Einstellung zu den Tieren geprägt.
Gewohnheit. Das ist die entscheidende Schranke, der sich die Tierbefreiungsbewegung
gegenübersieht. Und nicht nur Essensgewohnheiten, sondern auch Denk- und
Sprachgewohnheiten müssen hinterfragt und geändert werden. Unsere Denkgewohnheiten
machen es uns leicht, BeSchreibungen von Grausamkeit gegenüber Tieren als emotional und »nur für Tierfreunde«
abzutun. Oder es wird darauf verwiesen, dass dieses Problem im Vergleich mit menschlichen Problemen doch viel zu banal
sei, als dass ein vernünftiger Mensch ihm Zeit und Aufmerksamkeit widmen würde. Auch das ist ein Vorurteil. Denn wie
können wir wissen, dass ein Problem banal ist, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, uns damit auseinanderzusetzen und seine
Ausmaße kennenzulernen? Um eine möglichst gründliche Auseinandersetzung zu ermöglichen, behandelt dieses Buch nur
zwei Bereiche von vielen, in denen Menschen anderen Lebewesen Leid zufügen. Dennoch glaube ich nicht, dass
irgendjemand, der dieses Buch ganz liest, jemals wieder denken wird, die einzigen Probleme, die Zeit und Energie verdienen,
seien Probleme, die Menschen betreffen.
Wir können die Denkgewohnheiten in Frage stellen, die uns dazu bringen, die Interessen von Tieren
zu missachten, und auf den folgenden Seiten wird genau das geschehen. Dazu muss irgendeine
Sprache verwendet werden, und in diesem Fall ist es die deutsche Sprache. Und sie reflektiert wie
alle anderen Sprachen die Vorurteile derer, die sie benutzen. Autoren und Autorinnen, die diese
Vorurteile angreifen wollen, befinden sich also in einer wohlbekannten Zwickmühle: Entweder sie
benutzen die Sprache, die genau die Vorurteile nährt, die sie hinterfragen wollen, oder sie können
sich nicht mit ihrem Publikum verständigen. Dieses Buch hat sich gezwungenermaßen schon auf
den ersten der beiden Wege begeben. Wir benutzen normalerweise das Wort »Tiere«, wenn es
eigentlich heißen müsste »nichtmenschliche Tiere«. Dieser Wortgebrauch trennt die Menschen von
den anderen Tieren und impliziert damit, dass wir selbst keine Tiere sind — doch alle von uns, die
in der Schule einige Stunden Biologie hatten, wissen, dass diese Implikation falsch ist.
Im normalen Gebrauch wirft der Ausdruck »Tier« so unterschiedliche Lebewesen wie Austern und
Schimpansen zusammen und gräbt gleichzeitig einen Graben zwischen Schimpansen und
Menschen. Tatsächlich sind wir aber mit den Schimpansen viel näher verwandt, als es die Austern
sind. Da es nun einmal keinen anderen kurzen Begriff für nichtmenschliche Tiere gibt, musste ich
»Tier« im Titel dieses Buches und auch im Buch selbst so verwenden, als ob damit nicht auch das
menschliche Tier gemeint sei. Das ist zwar eine bedauerliche Abweichung von einer reinen
revolutionären Terminologie, aber um eine gut funktionierende Verständigung sicherzustellen,
schien sie mir notwendig. Um Sie jedoch daran zu erinnern, dass dies nur um der leichteren
Verständigung willen geschieht, werde ich hin und wieder längere und zutreffendere Bezeichnungen
für die Lebewesen benutzen, die in früheren Zeiten die »niedere Kreatur« genannt wurden.
Grundsätzlich habe ich versucht, eine Sprache zu vermeiden, die Tiere abwertet oder die Herkunft
der Nahrung, die wir essen, verschleiert.
Die Grundprinzipien, auf denen die Befreiung der Tiere basiert, sind einfach. Ich habe versucht, ein
klares und leicht verständliches Buch zu schreiben, das keinerlei Vorkenntnisse voraussetzt.
Dennoch ist es notwendig, dass ich mit einer Darstellung der Prinzipien beginne, die meiner
Position zugrunde liegen. Zwar ist auch daran nichts wirklich schwierig, aber trotzdem könnte es
sein, dass Leser und Leserinnen, die mit dieser Art von Argumenten nicht vertraut sind, das erste
Kapitel ziemlich abstrakt finden. Lassen Sie sich nicht abschrecken. In den darauffolgenden
Kapiteln werden wir uns direkt mit den wenig bekannten Einzelheiten befassen, wie unsere eigene
Spezies andere Spezies unter unserer Kontrolle unterdrückt, und weder an dieser Unterdrückung
noch an den Kapiteln, die sie beschreiben, ist irgendetwas abstrakt.
Würden die Vorschläge berücksichtigt, die ich in den folgenden Kapiteln mache, könnten Millionen
von Tieren beträchtliche Leiden erspart bleiben, und darüber hinaus würden Millionen von
Menschen ebenfalls davon profitieren. Während ich das schreibe, verhungern Menschen in vielen
Teilen der Welt, und viele Menschen sind unmittelbar vom Hungertod bedroht. Die Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika hat klargestellt, dass sie aufgrund schlechter Ernten und abneh-
mender Getreidevorräte nur begrenzt - und unzureichend - zu helfen vermag. Aber in Kapitel 4
dieses Buches werden wir sehen, dass durch die Vorliebe der wohlhabenden Nationen für die
Aufzucht von Tieren zur Fleischproduktion ein Vielfaches der Nahrungsmittel verschwendet wird,
die man schließlich erzeugt. Wenn wir aufhören würden, Tiere zu Nahrungszwecken zu züchten und
zu töten, könnten wir so viel zusätzliche Nahrung für Menschen schaffen, dass - bei richtiger
Verteilung dieser Nahrung — Hungertod und Unterernährung von unserem Planeten verschwinden
würden. Die Befreiung der Tiere ist zugleich die Befreiung der Menschen.
zur Ausgabe 1996
Vorwort von
Ich lese das Vorwort zur ersten Ausgabe dieses Buches, und es ist mir, als kehrte ich in eine Welt
zurück, die ich bereits fast vergessen hatte. Heute bieten mir Leute, die sich über das Wohl der Tiere
Gedanken machen, keine Schinkensandwiches mehr an, und die aktiven Mitglieder der
Tierbefreiungsbewegung leben alle vegetarisch. Selbst in der eher konservativen Tierschutzszene
existiert inzwischen ein gewisses Bewusstsein hinsichtlich der Problematik, Tiere zu essen -
diejenigen, die es dennoch tun, sehen darin zumindest einen Anlass, sich zu entschuldigen und sind
gerne bereit, Alternativen anzubieten, wenn sie für andere kochen. Es existiert ein neues
Bewusstsein dafür, dass es notwendig ist, die Sympathien für Hunde und Katzen auf Schweine,
Hühner und sogar Laborratten auszudehnen.
Ich weiß nicht, welchen Anteil an diesen Veränderungen sich Animal Liberation zuschreiben darf.
In populären Zeitschriften wurde das Buch als »die Bibel der Tierbefreiungsbewegung« gehandelt.
Natürlich schmeichelt mir das, aber zugleich wird mir bei dem Gedanken daran unbehaglich. Ich
glaube nicht an Bibeln: kein Buch ist im alleinigen Besitz der Wahrheit. Und wie auch immer, kein
Buch kann irgendetwas bewirken, wenn es die Menschen, die es lesen, nicht in ihrem Inneren
berührt. Die Befreiungsbewegungen der 60er Jahre haben die Befreiung der Tiere als einen
natürlichen nächsten Schritt erscheinen lassen. In diesem Buch habe ich die Argumente gesammelt
und ihnen eine zusammenhängende Form gegeben. Alles andere haben einige außergewöhnliche
Leute vollbracht, die sich über ethische Fragen Gedanken machen und hart arbeiten. Aus ihnen
besteht die Tierbefreiungsbewegung — zuerst waren es Einzelne, dann Hunderte, aus denen
langsam Tausende wurden, und inzwischen sind es möglicherweise Millionen. Ihnen widme ich
diese überarbeitete Ausgabe meines Buches. Denn ohne sie wäre diesem Buch vielleicht das gleiche
Schicksal widerfahren wie Henry Salts Buch Animals' Rights, das 1892 veröffentlicht wurde und in
den Regalen der British Museum Library verstaubte, bis eine neue Generation achtzig Jahre später
die Argumente neu formulierte, dabei über einige abgelegene Hinweise auf das Buch stolperte und
schließlich entdeckte, dass alles schon einmal gesagt worden war, aber umsonst.
Dieses Mal wird es nicht vergeblich sein. Die Bewegung ist dafür inzwischen zu groß geworden.
Wichtige Erfolge sind bereits erzielt, und noch größere liegen vor uns. Die Tierbefreiungsbewegung
erstreckt sich inzwischen über die ganze Welt, und auch in Zukunft wird man mit ihr rechnen
müssen.
Es kommt häufig vor, dass mich Leute fragen, ob ich glücklich darüber bin, dass die Bewegung so
gewachsen ist. Und schon an der Art und Weise, wie sie das fragen, ist ersichtlich, welche Antwort
sie erwarten. Sie erwarten, dass ich sage, ich hätte nie auch nur zu träumen gewagt, dass das Buch
eine solche Wirkung haben würde. Aber sie täuschen sich. Zumindest in meinen Träumen sagten
alle, die das Buch lasen: »Aber ja, natürlich ...«, und fingen sofort an, vegetarisch zu leben und
gegen das zu protestieren, was wir Tieren antun, damit noch mehr Leute das Anliegen der
Tierbefreiungsbewegung hörten. Und in meinen Träumen konnten wenigstens die schlimmsten und
unnötigsten Formen des Leidens von Tieren durch eine vehemente Welle öffentlichen Protests
schnell beendet werden.
Gewiss, aus solchen Träumen holte mich mein Wissen um die Hindernisse schnell zurück: der
Konservatismus fast aller von uns, wenn es darum geht, was wir unserem Magen einverleiben; der
Kreis der finanziell Interessierten, die bis zur letzten Million kämpfen würden, um ihr Recht zu
verteidigen, Tiere um der Gewinnmaximierung willen auszubeuten; und das schwere Gewicht von
Geschichte und Tradition, auf denen unsere Einstellungen ruhen, die diese Ausbeutung
rechtfertigen. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich Leute getroffen und Briefe von vielen, vielen
Leuten bekommen habe, die das Buch gelesen hatten und sagten: »Ja, natürlich ...«, die aufhörten,
Tiere zu essen und begannen, in der Tierbefreiungsbewegung mitzuarbeiten. Und noch mehr freue
ich mich natürlich darüber, dass der jahrelange harte Kampf vieler Leute dazu geführt hat, dass die
Tierbefreiungsbewegung heute eine politische und gesellschaftliche Realität ist. Aber auch das ist
noch nicht genug, nicht annähernd genug. Wie diese Ausgabe des Buches nur allzu deutlich zeigt,
hat die Bewegung bisher auf die wichtigsten Formen der Ausbeutung von Tieren nur sehr wenig
Einfluss gehabt.
Animal Liberation wurde 1975 veröffentlicht, und in dieser ersten Ausgabe war das Buch seitdem
im Handel. Jetzt müssen aber drei Aspekte überarbeitet werden. Erstens: als das Buch erschien, gab
es noch keine Tierbefreiungsbewegung. Der Begriff selbst war damals noch unbekannt, und große
Organisationen, die dafür arbeiteten, dass sich in den Denk- und Verhaltensweisen der Menschen
gegenüber den Tieren ein radikaler Wandel vollzog, gab es nicht, selbst kleine waren schwer zu fin-
den. Jetzt, 20 Jahre später, wäre es aber zweifellos merkwürdig, wenn in einem Buch mit dem Titel
Befreiung der Tiere keine Notiz von der Existenz der modernen Tierbefreiungsbewegung
genommen würde und somit auch nicht einige Worte zur Entwicklung dieser Bewegung gesagt
würden.
Zweitens: die Entstehung der modernen Tierbefreiungsbewegung war von einer erstaunlichen
Zunahme der Literatur zu diesem Thema begleitet — viele dieser Schriften nahmen Bezug auf die
Position, die ich in der ersten Ausgabe des vorliegenden Buches vertreten habe. Auch habe ich mit
Frauen und Männern, mit denen ich befreundet bin oder die ich aus der Arbeit in der
Tierbefreiungsbewegung kenne, lange Abende damit verbracht, philosophische Fragen und die
praktischen Schlüsse, die aus ihnen folgen, zu diskutieren. Es schien mir notwendig, auf all dies
irgendwie zu reagieren, und sei es auch nur, damit ersichtlich ist, ob und in welchem Ausmaß ich
meine früheren Auffassungen inzwischen geändert oder beibehalten habe.
Drittens: das zweite und dritte Kapitel des Buches beschreiben die Auswirkungen unserer
gegenwärtigen Einstellungen gegenüber Tieren in zwei wichtigen Bereichen, nämlich bei
Tierversuchen und in den Tierhaltungsbetrieben. Irgendwann fingen die Leute an zu sagen: »Ja,
schon, aber seit das geschrieben wurde, ist alles viel besser geworden«, und seitdem weiß ich, dass
ich dokumentieren muss, was heute in Labors und in den Agrarbetrieben geschieht. Ich weiß, dass
ich meine Leser und Leserinnen mit Beschreibungen konfrontieren muss, die nicht einfach mit dem
Hinweis abgetan werden können, dass sie aus einer dunklen, schon lange vergangenen Zeit
stammten.
Die neuen Beschreibungen machen den größten Teil der Unterschiede zwischen den beiden
Ausgaben aus. Allerdings bin ich Vorschlägen nicht gefolgt, auch noch andere Formen des
Missbrauchs von Tieren darzustellen. Denn die Beschreibung der Fakten hat nicht das Ziel, einen
umfassenden Bericht darüber zu liefern, wie wir Tiere behandeln. Sie soll vielmehr, und darauf
weise ich am Ende des ersten Kapitels auch hin, dazu dienen, die Implikationen des dort
behandelten, eher abstrakten philosophischen Begriffs des Speziesismus klar, konkret und mit aller
Schärfe aufzuzeigen. Dass ich zu den Diskussionen über die Jagd, über das Fallenstellen, die
Pelzindustrie, über die Missstände im Umgang mit Haustieren, über Rodeos, Zoos und Zirkusse
hier nichts sage, bedeutet nicht, dass diese Fragen weniger wichtig sind. Es bedeutet nur, dass die
beiden Hauptbereiche, die Tierversuche und die Tierhaltung zur Nahrungserzeugung, genügen, um
das zu zeigen, worauf es mir ankommt.
Auf alle Kommentare einzugehen, die von Philosophen zu den ethischen Argumenten dieses
Buches gemacht wurden, hätte bedeutet, die Art des Buches völlig zu verändern. Es wäre dadurch
zu einem akade- misch-philosophischen Werk geworden, das vielleicht meine Kollegen in der
Philosophie interessiert hätte, das aber für alle anderen Leser und Leserinnen ermüdend gewesen
wäre. Ich habe mich deshalb dagegen entschieden, die Beantwortung all dieser Punkte zu
versuchen. Stattdessen habe ich an geeigneten Stellen im Text auf einige andere Schriften
hingewiesen, in denen ich auf bestimmte Einwände geantwortet habe. Außerdem habe ich einen
Abschnitt des Schlusskapitels neu geschrieben, weil ich meine Meinung über die dort behandelte
philosophische Frage geändert habe, die mit den ethischen Grundlagen der Argumentation dieses
Buches nur am Rande verknüpft ist. Diese Grundlagen selbst habe ich in Vorlesungen behandelt, ich
habe Vorträge bei Konferenzen und in Philosophieseminaren über sie gehalten und sie sowohl
mündlich als auch schriftlich ausgiebig diskutiert. Aber ich bin dabei nicht auf unüberwindliche
Einwände gestoßen, nichts wurde mir je entgegengehalten, das mich zu einer anderen
Schlussfolgerung gebracht hätte als der, dass die einfachen ethischen Argumente, die diesem Buch
zugrunde liegen, stimmig sind. Es hat mich ermutigt festzustellen, dass viele meiner angesehensten
Kollegen aus der Philosophie mit diesen Argumenten übereinstimmen. Somit habe ich sie
unverändert beibehalten.
Damit bleibt noch zum ersten der drei obengenannten aktualisierungsbedürftigen Aspekte etwas zu
sagen: zur Tierbefreiungsbewegung und ihrer Entwicklung.
Einige der wichtigsten Kampagnen und Erfolge der Tierbefreiungsbewegung berücksichtige ich
sowohl in meinen Ausführungen zu Tierversuchen und in der Beschreibung der Massentierhaltung,
als auch im Schlusskapitel dieser überarbeiteten Ausgabe. Ich habe nicht versucht, diese Aktionen
in allen Einzelheiten zu beschreiben, denn in einem Buch mit dem Titel Verteidigung der Tiere, das
ich vor einiger Zeit herausgegeben habe, haben dies bereits einige der führenden Köpfe dieser Kam-
pagnen selbst getan. Dennoch muss eine für die ganze Bewegung wichtige Frage an einer zentralen
Stelle dieses Buches aufgegriffen werden, und ich will dies gleich hier tun. Es handelt sich um die
Frage der Gewalt.
Aktive Mitglieder der Tierbefreiungsbewegung haben sich um eine ganze Reihe von Möglichkeiten
bemüht, ihrem Ziel, der Befreiung der Tiere, näherzukommen. Einige versuchen, die Öffentlichkeit
aufzuklären, indem sie Flugblätter verteilen und Briefe an Zeitungen schreiben.
Andere nehmen Einfluss auf Regierungsbeamte und die ins Parlament gewählten Abgeordneten.
Manche Organisationen veranstalten Demonstrationen und protestieren in der nächsten Umgebung
von Orten, wo Tiere um trivialer menschlicher Zwecke willen gequält werden. Aber viele werden
ungeduldig, denn durch solche Aktionen können nur langsam Fortschritte erzielt werden, und viele
möchten etwas unternehmen, das direkte Wirkungen hat, um dem Leiden sofort ein Ende zu
machen.
Wer um das Leiden der Tiere weiß, wird sich außerstande sehen, diese Ungeduld zu verurteilen.
Angesichts der anhaltenden Gräueltaten kann es wirklich nicht genug sein, sich hinzusetzen und
Briefe zu schreiben. Es geht darum, den Tieren jetzt zu helfen. Aber wie? Die normalen legitimen
Möglichkeiten für den politischen Protest wirken langsam und sind unsicher. Sollte man einbrechen
und die Tiere befreien? Das ist zwar gesetzeswidrig, aber es gibt keine absolute Pflicht, Gesetze zu
befolgen. So brachen, um nur einen ähnlich gelagerten Fall zu nennen, die Menschen völlig
gerechtfertigt das Gesetz, die in den Südstaaten Amerikas geflohenen Sklaven halfen. Ein viel
ernsteres Problem liegt darin, dass die buchstäbliche Befreiung von Tieren aus Laboratorien und
Massentierhaltungsbetrieben nur eine Geste sein kann, um ein Zeichen zu setzen. Denn einerseits
werden die Forscher einfach eine neue Lieferung Tiere bestellen, und andererseits ist es kaum
möglich, für 1000 befreite Schweine oder 100000 Legehennen eine neue Unterbringung zu finden.
In mehreren Ländern haben sich Aktionen der Animal Liberation Front als viel erfolgreicher
erwiesen, wenn es darum ging, Beweismaterial über Missstände sicherzustellen, die sonst niemals
ans Licht gekommen wären. Bei dem Überfall auf das Labor von Dr. Thomas Gennarelli an der
University of Pennsylvania gelang es zum Beispiel, durch die Beweiskraft von gestohlenen
Videobändern sogar den Ge- sundheits- und Sozialminister davon zu überzeugen, dass die Versuche
beendet werden mussten. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass dieses Ergebnis mit anderen Mitteln
hätte erreicht werden können, und ich kann die Menschen, die diese spezielle Aktion so mutig,
sorgfältig und umsichtig geplant und durchgeführt haben, nur beglückwünschen.
Aber es gibt andere illegale Aktionen, die sich von der eben beschriebenen grundsätzlich
unterscheiden. Eine Gruppe namens »Animal Rights Militia« schickte 1982 Briefbomben an
Margaret Thatcher, und 1988 wurde die militante Tierschützerin Fran Trutt verhaftet, als sie dabei
war, in der Nähe der Büros der U.S. Surgical Corporation eine Bombe zu legen. Die Gesellschaft
hatte lebende Hunde benutzt, um an ihnen die Funktionsweise ihrer chirurgischen Heftgeräte zu
demonstrieren. Keine dieser beiden Aktionen war in irgendeinem Sinne charakteristisch für die
Tierbefreiungsbewegung. Von der Animal Rights Militia hatte zuvor noch nie jemand gehört, und
alle britischen Tierbefreiungsorganisationen verurteilten sofort ihr Handeln. Fran Trutt war eine
Ein- zelkämpferin, und ihr Tun wurde von der amerikanischen Bewegung prompt öffentlich
verurteilt. (Auch gab es Hinweise darauf, dass es sich um eine Falle gehandelt hatte, denn Fran
Trutt wurde von einem verdeckt arbeitenden, bezahlten Informanten des Sicherheitsberaters der
Firma zu den Büros gefahren.) Solche Aktionen müssen aber als Extremfälle des Spektrums von
Drohungen und Belästigungen gegenüber Experimentatoren, Pelzhändlern und anderen, die Tiere
ausbeuten, gesehen werden, und darum ist es wichtig, dass all jene innerhalb der Tierbefrei-
ungsbewegung ihre Position gegenüber solchen Aktionen eindeutig klarstellen.
Auch wenn nur eine kleine Minderheit innerhalb der Tierbefreiungsbewegung versuchen würde,
ihren Zielen näherzukommen, indem sie andere verletzt, wäre dies ein tragischer Fehler. Einige
glauben zwar, dass Menschen, die Tieren Leid zufügen, verdienen, dass man ihnen selbst Leid
zufügt. Aber ich halte nichts von Rache, und selbst wenn ich es täte, wäre der Rachegedanke doch
nur eine schädliche Ablenkung von unserer Aufgabe, das Leiden zu beenden. Wir müssen, wenn wir
diese Aufgabe erfüllen weilen, eine Veränderung im Denken der einsichtigen Mitglieder unserer
Gesellschaft bewirken. Wir mögen davon überzeugt sein, dass eine Person, die Tiere missbraucht,
völlig abgestumpft und gefühllos sein muss, aber wir stellen uns mit solchen Leuten auf eine Ebene,
wenn wir sie körperlich verletzen oder ihnen damit drohen. Gewalt kann nur wiederum Gewalt
erzeugen — ein Klischee, gewiss, aber seine tragische Wahrheit beweist sich beständig in vielen
Konflikten auf der ganzen Welt. Die Stärke des Arguments für eine Befreiung der Tiere liegt in
seinem hohen ethischen Anspruch; wir übernehmen damit eine große moralische Verpflichtung, und
sie fallen zu lassen würde bedeuten, denen in die Hände zu spielen, gegen die wir kämpfen.
Es gibt eine Alternative zum Weg der ständig wachsenden Gewalt. Sie besteht darin, dem Vorbild
der beiden größten - und nicht nur zufällig erfolgreichsten - Führer von Freiheitsbewegungen der
jüngeren Vergangenheit zu folgen: Gandhi und Martin Luther King. Ungeachtet der Provokationen
und oft gewalttätigen Angriffe ihrer Gegner haben sie mutig und mit großer Entschlossenheit am
Prinzip der Gewaltlosigkeit festgehalten. Schließlich hatten sie Erfolg, denn die Gerechtigkeit ihres
Anliegens war unleugbar, und ihr Verhalten hatte sogar ihre Gegner nachdenklich gestimmt. Das
Unrecht, das wir anderen Spezies zufügen, ist - wenn es erst einmal in vollem Umfang
wahrgenommen wird - genauso unleugbar; und deshalb liegen die Erfolgsaussichten unseres
Anliegens nicht in der Angst vor unseren Bomben, sondern in der Richtigkeit unserer Sache.
Vorwort zur deutschen Ausgabe von 2015
Ich freue mich sehr, dass Animal Liberation erneut in einer deutschen Ausgabe verfügbar ist.
Zusammen mit den anderen europäischen Ländern haben Deutschland, Osterreich und die Schweiz
eine wichtige Rolle für den Fortschritt gespielt, der mit Blick auf die Tiere in den letzten 40 Jahren
stattgefunden hat. Ich habe die Hoffnung, dass diese neue Ausgabe meines Buches eine neue
Generation von Aktivistinnen und Aktivisten anspornen wird, sich der Sache der Tiere anzunehmen.
Und ich habe auch die Hoffnung, dass dieses Buch vielen zeigt, dass Philosophie wirklich wichtig
ist. Philosophische Argumente müssen nicht undurchsichtig und weitab vom täglichen Leben sein.
Im Gegenteil, sie können sich auf etwas so Konkretes und Unmittelbares wie unser Essen beziehen,
und sie können Leben verändern. Ich weiß das, weil bei meinen öffentlichen Vorträgen sehr oft
Leute zu mir kommen und mir erzählen, dass dieses Buch ihr Leben verändert hat.
Im Jahr 1971, als ich Student in Oxford war, stand ich mit ein paar anderen Studierenden in einer
belebten Oxforder Straße und verteilte Infoblätter, um gegen die Käfighaltung von Hühnern zu
protestieren. Die meisten derer, die ein Infoblatt mitnahmen, wussten nicht, dass ihre Eier von
Hühnern gelegt worden waren, die in so kleinen Käfigen lebten, dass sie ihre Flügel weder völlig
ausstrecken noch mit ihnen schlagen konnten. Die Hühner konnten nicht frei herumlaufen oder ihre
Eier in ein Nest legen.
Damals gab es von keiner der wichtigen Organisationen irgendwelche Aktionen gegen die
Agrarindustrie. In Großbritannien hatte die Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals,
die Mutter aller Tierschutzorganisationen, ihre frühe Radikalität verloren. Sie konzentrierte sich auf
einzelne Missbrauchsfälle und versäumte es, gängigen Formen des Missbrauchs von Tieren in der
Agrarindustrie und in Laboratorien den Kampf anzusagen. Es brauchte die gemeinsame
Anstrengung der neuen radikalen Aktivisten für Tiere in den 1970er Jahren, um die RSPCA aus
ihrer Gleichgültigkeit gegen die Käfighaltung und andere Formen der Intensivhaltung von Tieren
aufzurütteln.
In den 1980er Jahren begannen Kosmetikfirmen unter dem Druck der Tierbefreiungsbewegung,
Geld in die Suche nach Alternativen zu Tierversuchen zu investieren. Die Entwicklung von
Produkttestverfahren, die ohne Tiere auskommen, hat inzwischen eine gewisse Eigendynamik in der
wissenschaftlichen Gemeinschaft gewonnen und ist zum Teil verantwortlich dafür, die Zahl der
verwendeten Tiere niedrig zu halten.
Die überwältigende Mehrheit der von Menschen misshandelten Tiere sind jedoch Tiere in der
Agrarwirtschaft - eine geschätzte Zahl von 60 Milliarden Säugetieren und Vögeln werden jedes Jahr
weltweit für Ernährungszwecke getötet. Da die meisten dieser Tiere unter Bedingungen der
Intensivhaltung aufgezogen werden, erstreckt sich ihr Leiden über ihr gesamtes Leben. Millionen
von Konsumenten und Konsumentinnen waren sich einig, dass solche Formen, Tiere zu halten,
nicht akzeptabel sind, als sie von ihnen erfuhren. Sie begannen, solche grausam erzeugten Produkte
zu vermeiden, und einige Supermärkte hörten auf, Eier aus Legebatterien anzubieten. In vielen
europäischen Ländern wurde der Tierschutz zum politisch relevanten Thema, und der Druck auf die
Regierungen stieg.
In der Schweiz wurde die Käfighaltung von Legehennen Ende 1991 gesetzlich verboten. Statt ihre
Hennen in kleine Drahtkäfige zu sperren, die zu klein waren, um ihnen zu erlauben, ihre Flügel
auszustrecken, hielten die Schweizer Produzenten sie in Hallen, deren Boden mit Stroh j^der
anderem Material bedeckt waren, in dem die Hühner scharren konnten, und wo sie ihre Eier in eine
geschützte Legebox mit weichem Untergrund legen konnten. Nachdem die Schweiz einmal gezeigt
hatte, dass Veränderung möglich ist, wuchs der Widerstand gegen die Legebatterien europaweit. Die
Europäische Union richtete einen wissenschaftlichen Ausschuss ein, um Tierschutzbelange in der
Agrarindustrie zu untersuchen, und der Aussschuss empfahl, die Käfighaltung zu verbieten —
ebenso wie einige andere Formen der Einsperrung auf engem Raum bei Schweinen und Kälbern.
Wie auf den folgenden Seiten dargestellt wird, gehörten Milchkälber in der Intensivaufzucht, die
absichtlich anämisch gemacht wurden, denen man Stroh und Einstreu vorenthielt, und die in Boxen
gehalten wurden, sie so eng waren, dass sich die Kälber nicht einmal umdrehen konnten, zu den
elendsten unter allen Tieren in der Agrarindustrie. Diese Form der Kälberhaltung war in
Großbritannien schon verboten, als ich den Text dieses Buches für die Ausgabe von 1990