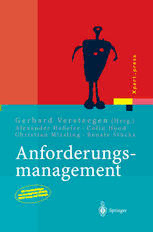Table Of ContentXpert. press
Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
Xpert.pres
Die Reihe s des Springer-Verlags
vermittelt Professionals in den Bereichen
Betriebs- und Informationssysteme, Software
Engineering und Programmiersprachen aktuell
und kompetent relevantes Fachwissen über
Technologien und Produkte zur Entwicklung
und Anwendung moderner Informations-
technologien.
Gerhard Versteegen(Hrsg.)
Alexander Heßeler
Colin Hood
Christian Missling
Renate Stücka
Anforderungs-
management
Formale Prozesse, Praxiserfahrungen,
Einführungsstrategien und Toolauswahl
1 2 3
Herausgeber
Gerhard Versteegen
High Level Marketing Consulting
Säntisstraße 27, 81825 München
Deutschland
Mit 150 Abbildungen
und 11 Tabellen
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliolhek
Die Deutsche Bibliolhek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über <hup://dnb.ddb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-642-62388-2 ISBN 978-3-642-18975-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-642-18975-3
Dieses Werk ist urheberrechtlieh geschützt. Die dadurch begründCl.en
Rechte, insbesondere die der Obersetzung, des Nachdrucks, des Vor
trags,der EOlnahme von Abbildungen und Tabellen,der Funksendung,
der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und
der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur
auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses
Werkes oder von Teilen dieses Werkes iSlauch im Einzelfall nur in den
Grenzen der gesCli'lichen Bestimmungen des UrheberrechtsgeselZes
der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils
geltenden Fassung zulässig. Sie sit grundsätzlich vergütungspOichtig.
Zuwiderhandlungen unterliegen den Stratbestimmungen des
Urheberrechtsgeselzes.
© Springer-Verlag Berlin Heidclberg 2004
Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag Bcrlin Heidclberg New York 2004
Softco"cr reprint orlhc hardcover Ist edition 200-l
Die Wiedergabe von Gcbrauchsnamen, Ilandelsnamen, Warenbezeich
nungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kenn
zeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der
Warenzeichen-und MarkenschutzgesClzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung: KünkclLoka,Hcidclberg
Satz: G&U Publishing Service, rlensburg
Gedruckt auf säurefreiem Papier 3313142XT -5 4 3 2 I 0
Vorwort
Gerhard Versteegen
Ziele dieses Buches
Dieses Buch gibt eine Einführung in die Thematik des professionel-
len und werkzeuggestützten Anforderungsmanagements innerhalb
der Software-Entwicklung und soll dem Leser einerseits dazu ver-
helfen, die Bedeutung des Anforderungsmanagements zu verstehen
und andererseits ihn in die Lage versetzen, Anforderungen korrekt
zu formulieren, so dass sie auch in Software umgesetzt werden kön-
nen. Ferner gibt das Buch eine Einführung in das marktführende
Produkt Telelogic DOORS, die verdeutlicht, wie ein werkzeugges-
tütztes Anforderungsmanagement funktioniert und welche Vorteile
daraus entstehen.
Wer dieses Buch lesen sollte
Dieses Buch richtet sich an alle Projektbeteiligten eines Software-
Entwicklungsprojektes, die sich mit dem Thema Anforderungsma-
nagement beschäftigen, und zwar sowohl auf Kunden- als auch auf
Lieferantenseite Diese werden im weiteren Verlauf dieses Buches
auch Stakeholder genannt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um
die folgenden Rollen innerhalb eines Software-Projektes:
■ Systemanalysten
■ Anforderungsmanager
■ Qualitätssicherer oder Qualitätsbeauftragte
■ Projektleiter
Vorwort V
■
■
Links
■■ DDesiigner
■■ Entwickler
■■ Software-Tester1
Inhalte dieses Buches
DDas vorliegende Buch teilt sich in sechs Kapitel auf: Im erstenn
Kapitel geben wir eine Einführung in das Thema Anforderungsma-
nnagement. Wir beschreiben, warum Anforderungsmanagementt
gerade im Bereich der Software-Entwicklung von so großer Bedeu-
ttung ist und welche Zusammenhänge zu den anderen Disziplinenn
des Software-Engineerings existieren (insbesondere zum eng ver-
wwandten Änderungsmanagement). In diesem Zusammenhang zei-
gen wir auch kurz die Integration des Anforderungsmanagements inn
die beiden Prozessmodelle V-Modell und Rational Unified Process
auf.
Im zweiten Kapitel nähern wir uns einem sehr kritischen Aspekt:
WWie formuliert man Anforderungen? Entscheidend dabei ist, dass
sowohl Mehrdeutigkeiten vermieden werden als auch eine zu frühee
Konzentration auf technische Details verhindert werden muss. Einn
wweiterer Schwerpunkt in diesem Kapitel ist die Vergabe von Attri-
bbuten zu einer Anforderung. Dieses Kapitel ist als Ratgeber zu ver-
stehen und sollte vom Ansatz her in jeden unternehmensinternenn
PProzess integriert werden.
Im dritten Kapitel – geschrieben von Alexander Heßeler (Bea-
rringPoint, ehemals KPMG) – wird dargestellt, wie eine notwendigee
TToolauswahl vorgenommen wird. Kapitel vier stellt dann das der-
zeit am weitesten verbreitete Werkzeug zum Thema Anforderungs-
mmanagement vor: Telelogic DOORS. Anhand dieses Kapitels istt
der Leser in der Lage sich selbstständig in dieses komplexe Produktt
eeinzuarbeiten.
Das fünfte Kapitel beschreibt anschaulich, wie es nach demm
AAnforderungsmanagement weitergeht. Renate Stücka stellt anhandd
eeines weiteren Werkzeuges vor, wie die in DOORS erstelltenn
AAnforderungen nahtlos in ein Modellierungswerkzeug übernom-
mmen werden können und dort mit Hilfe der UML 2.0 visualisiertt
wwerden.
11 Wir werden in diesem Buch näher darstellen, dass professionelles Testen bedeu-
tet, dass eine Software immer gegen die an sie gestellte Anforderungen getestet
werden muss.
VI Vorwort
■
■
Rechts
Im letzten Kapitel berichtet Colin Hood, wie Anforderungsma-
nnagement und DOORS in einem internationalen Unternehmen ein-
geführt wurde. Er beschreibt die typischen Problemfelder und zeigtt
LLösungswege auf.
Im Anhang des Buches gehen wir auf das Thema elektronische
Signatur näher ein. Diese ist mittlerweile in zahlreichen Branchenn
eine wichtige Voraussetzung zur Freigabe von Dokumenten gewor-
den und ist in DOORS integriert worden.
Danksagungen
Unser Dank gilt unter anderem der Firma Telelogic, die durchh
eine kostenlose Bereitstellung des Werkzeuges DOORS mit zumm
Gelingen dieses Buches beigetragen hat. Natürlich bedanken wirr
uuns auch bei unserem persönlichen Umfeld, das in der Entstehungs-
zeit dieses Buches des Öfteren auf unsere Anwesenheit verzichtenn
mmusste.
Vorwortt VII
■
■
Inhaltsverzeichnis 1
1 Einführung in Anforderungsmanagement . . . . . . . . . . . .1
1.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1.2 Begriffsfindungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1.2.1 Anforderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1.2.2 Anforderungsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.2.3 Änderungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.2.4 Änderungsantrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.2.5 Änderungsmanagement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.2.6 Fehlermeldung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.2.7 Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.3 Rollen im Anforderungsmanagement. . . . . . . . . . . . .10
1.3.1 Einführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.3.2 Der Anforderungsmanager . . . . . . . . . . . . . . .10
1.3.3 Der Interviewer und der Moderator. . . . . . . . .11
1.3.4 Der Software-Entwickler. . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.3.5 Der Projektleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.3.6 Der Konfigurationsmanager . . . . . . . . . . . . . .12
1.3.7 Die Rolle des Kunden im Anforderungs-
management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.3.8 Fazit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1.4 State of the Art im Anforderungsmanagement . . . . . .15
1.4.1 Einführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
1.4.2 Ergebnisse der Standish Group. . . . . . . . . . . .15
1.4.3 Der Yphise-Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
1.4.4 Ergebnisse der META Group . . . . . . . . . . . . .19
1.5 Die Integration des Anforderungsmanagements
in den Software-Entwicklungsprozess . . . . . . . . . . . .20
1.5.1 Einführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Inhaltsverzeichnis IX
■
■
Links
1.5.2 Das V-Modell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5.3 Der Rational Unified Process. . . . . . . . . . . . . 23
11.55.44 FFaziit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2266
1.6 Herausforderungen im Anforderungs- und
Änderungsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.6.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.6.2 Die Fähigkeit Auseinandersetzungen
einzugehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.6.3 Auf den Machtkampf einlassen . . . . . . . . . . . 29
1.7 Methodische Ansätze im Anforderungs-
management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.7.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.7.2 Das V-Modell des Anforderungs-
managements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.8 Beispielhafte Return-on-Investment-Rechnung. . . . . 34
1.8.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.8.2 Fallbeispiel aus der Automobilbranche . . . . . 34
1.8.3 Vorgenommene Investitionen und erzielte
Einsparungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.8.4 Time to Market. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.8.5 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
22 Die Formulierung von Anforderungen. . . . . . . . . . . . . . 39
2.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2 Richtlinien im Anforderungsmanagement. . . . . . . . . 40
2.2.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2.2 Ergebnisorientierter Ansatz . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2.3 Änderungen berücksichtigen . . . . . . . . . . . . . 41
2.2.4 Rechtzeitig Ergebnisse zeigen . . . . . . . . . . . . 41
2.2.5 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3 Die Struktur einer Anforderung. . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.4 Kriterien für eine gut formulierte Anforderung. . . . . 43
2.4.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.4.2 Typische Kriterien für Anforderungen. . . . . . 44
2.4.3 Ergänzende Kriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4.4 Die Formulierung an sich. . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.4.5 Das Erstellen und Pflegen von Attributen
von Anforderungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.4.6 Die Strukturierung von Anforderungen
innerhalb eines Dokumentes. . . . . . . . . . . . . . 47
2.4.7 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
X Inhaltsverzeichnis
■
■
Rechts
2.5 Anwenderanforderungen und System-
anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
22.55.11 EEiinffüühhrung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4488
2.5.2 Unterschiede zwischen Anwender-
anforderungen und Systemanforderungen . . . .48
2.5.3 Das User Requirements Document. . . . . . . . .49
2.5.4 Das System Requirements Document. . . . . . .50
2.6 Typische Quellen von Anforderungen . . . . . . . . . . . .51
2.7 Reviews. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
2.7.1 Einführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
2.7.2 Unterschiedliche Reviewarten und Ziele
von Reviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
2.7.3 Der Reviewprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
2.7.4 Richtlinien für die Durchführung
eines Reviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
2.8 Häufige Fehler bei der Formulierung von
Anforderungen und im Anforderungsmanagement . . . 56
2.8.1 Einführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2.8.2 Die Besetzung der Rolle des
Anforderungsmanagers . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2.8.3 Fehlender Einsatz eines professionellen
Werkzeuges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
2.8.4 Die Einstellung des Kunden zur Bedeutung
des Anforderungsmanagements. . . . . . . . . . . .59
2.8.5 Die 10 häufigsten Problemfelder im
Anforderungsmanagement . . . . . . . . . . . . . . .62
2.9 Weitere Attribute von Anforderungen . . . . . . . . . . . .62
33 Auswahl eines Werkzeuges für das
Anforderungsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
3.1 Einführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
3.2 Welchen Nutzen soll das Tool bringen? . . . . . . . . . . .67
3.3 Voraussetzungen für die Toolauswahl . . . . . . . . . . . .69
3.3.1 Der Prozess für das Anforderungs-
management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
3.3.2 Herausfinden der Stakeholder. . . . . . . . . . . . .71
3.3.3 Wer versteht was unter Anforderungs-
management?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
3.3.4 Welches Ziel soll mit dem neuen Tool
erreicht werden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
3.3.5 Ist im Unternehmen bereits ein Tool für
das gleiche Problem vorhanden?. . . . . . . . . . .74
Inhaltsverzeichniss XI
■
■