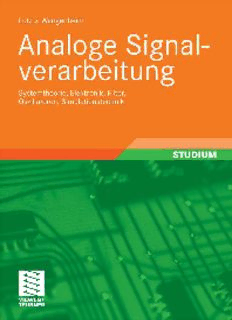Table Of ContentLutz v. Wangenheim
Analoge Signalverarbeitung
Lutz v. Wangenheim
Analoge Signal-
verarbeitung
Systemtheorie, Elektronik, Filter,
Oszillatoren, Simulationstechnik
Mit 119 Abbildungen
STUDIUM
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Das in diesem Werk enthaltene Programm-Material ist mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgend -
einer Art verbunden. Der Autor übernimmt infolgedessen keine Verantwortung und wird keine daraus
folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses
Programm-Materials oder Teilen davon entsteht.
Höchste inhaltliche und technische Qualität unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der Produktion und
Auslieferung unserer Bücher wollen wir die Umwelt schonen: Dieses Buch ist auf säuref reiem und
chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die Einschweißfolie besteht aus Polyäthylen und damit aus
organischen Grundstoffen, die weder bei der Herstellung noch bei der Ver brennung Schadstoffe frei-
setzen.
1. Auflage 2010
Alle Rechte vorbehalten
© Vieweg+Teubner | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2010
Lektorat: Reinhard Dapper | Walburga Himmel
Vieweg+Teubner ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.
www.viewegteubner.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich ge schützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Ur heber rechts ge set zes ist ohne
Zustimmung des Verlags unzuläss ig und strafb ar. Das gilt insb es ondere für
Vervielfältigungen, Über setzun gen, Mikro verfil mungen und die Ein speiche rung
und Ver ar b eitung in elek tro nischen Syste men.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im
Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher
von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg
Druck und buchbinderische Verarbeitung: STRAUSS GMBH, Mörlenbach
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
Printed in Germany
ISBN 978-3-8348-0764-9
Vorwort
Was ist eigentlich ein Filterpol?
Was bedeutet eine negative Gruppenlaufzeit?
Gibt es negative Widerstände und negative Frequenzen?
Mit grundsätzlichen Fragen dieser Art wird wahrscheinlich jeder irgendwann einmal konfrontiert,
der sich intensiv mit Schaltungen und Systemen zur analogen Signalverarbeitung befasst –
entweder als Student der Informations- und Kommunikationstechnik oder auch als Ingenieur in
der Praxis, der für ein neues Projekt auf etwas in den Hintergrund getretenes Grundlagenwissen
zurückgreifen muss.
Falls man bei der einen oder anderen Antwort nicht ganz sicher ist, kann vielleicht ein passendes
Fachbuch weiterhelfen – aber welches? Welches Buch gibt beispielsweise darüber Auskunft,
warum für die in der Systemtheorie verwendete komplexe Frequenzvariable s=((cid:86)+j(cid:90)) in manchen
Fällen vereinfachend s=j(cid:90) gesetzt wird? Benutzt wird diese komplexe Größe s in praktisch
allen Fach- und Lehrbüchern zur Systemtheorie, zur Elektronik sowie zur Filter-, Regelungs-
und Informationstechnik. Aber findet man dort auch immer eine befriedigende Antwort auf
Verständnisfragen dieser Art?
Die Idee zum vorliegenden Buch stammt ursprünglich von einem meiner Studenten, der im
Verlaufe eines Vorbereitungsgesprächs auf eine Klausur aus dem Bereich „Elektronik und
analoge Signalverarbeitung“ mir den Vorschlag machte, doch einmal die Antworten auf einige
grundsätzliche Fragen zu diesem Themenkomplex in Kurzform zusammenzustellen.
Als Ergebnis ist daraus diese katalogartige Sammlung von Fragen und Antworten entstanden,
die - in sechs Abschnitte gegliedert - auf 100 typische Fragestellungen eingeht, die zum großen
Teil im Verlaufe einer 25-jährigen Lehrtätigkeit an der Hochschule Bremen an mich herange-
tragen worden sind.
Dabei kann und soll das Buch natürlich kein Lehrbuch ersetzen. Es wird hoffentlich aber dabei
helfen können, beim Leser das Verständnis zu entwickeln und zu vertiefen für einige ausge-
wählte Aspekte – Definitionen, Aussagen, Funktionsprinzipien, Simulationsverfahren – im
Zusammenhang mit der modernen elektronischen Signalverarbeitung. Wenn auf diese Weise
Missverständnisse oder Fehler bei der Anwendung des erworbenen Fachwissens aufgeklärt
oder vermieden werden können, hat das Buch seinen beabsichtigten Zweck erfüllt.
Bremen, im Februar 2010 Lutz v. Wangenheim
Inhalt
1 Allgemeine System- und Rückkopplungstheorie........................................................ 1
1.1 Was sind komplexe Frequenzen?.......................................................................... 1
1.2 Warum Poldarstellung in der s-Ebene?................................................................. 4
1.3 Welche Bedeutung hat die Polfrequenz?............................................................... 5
1.4 Wozu überhaupt Rückkopplung? ......................................................................... 6
1.5 Wie sind Mit- und Gegenkopplung definiert?....................................................... 7
1.6 Welche Bedeutung hat die Schleifenverstärkung?................................................ 10
1.7 Was ist ein Mindestphasen-System?..................................................................... 13
1.8 Wie viel Stabilitätsreserve ist sinnvoll? ............................................................... 14
1.9 Gibt es mehrere Nyquist-Stabilitätskriterien? ....................................................... 17
1.9.1 Theoretischer Hintergrund ....................................................................... 17
1.9.2 Das allgemeine Stabilitätskriterium ......................................................... 18
1.9.3 Das vereinfachte Nyquist-Kriterium ......................................................... 20
1.9.4 Beispiel zum Nyquist-Kriterium .............................................................. 21
1.10 Was versteht man unter bedingter Stabilität? ....................................................... 23
1.11 Sind Betrags- und Phasenverlauf voneinander abhängig? .................................... 24
1.12 Wie prüft man die Stabilität mehrschleifiger Systeme?........................................ 26
1.12.1 Beispiel: Regelkreis mit zwei Rückführungen ........................................ 26
1.12.2 Stabilitätsprüfung...................................................................................... 28
1.13 Ist die Schleifenverstärkung aus der Systemfunktion ablesbar?............................ 29
1.14 Ist der gegengekoppelte Verstärker ein Regelkreis?............................................. 30
1.15 Wie unterscheiden sich Phasen- und Gruppenlaufzeit? ........................................ 32
1.16 Kann die Gruppenlaufzeit auch negativ sein?....................................................... 34
1.17 Was besagt das Substitutionstheorem? ................................................................. 36
1.18 Gibt es negative Frequenzen? ............................................................................... 37
1.19 Was bedeutet die Operation „Faltung“? ............................................................... 40
1.20 Welche Bedeutung hat die Hilbert-Transformation? ............................................ 42
2 Elektronik ..................................................................................................................... 43
2.1 Sind Bipolartransistoren strom- oder spannungsgesteuert? .................................. 43
2.2 Was ist ein negativer Widerstand?........................................................................ 44
2.3 Was ist ein frequenzabhängiger Widerstand?....................................................... 46
2.4 Wozu dienen Stromspiegel?.................................................................................. 48
VIII Inhalt
2.5 Was sind translineare Schaltungen? ..................................................................... 51
2.5.1 Beispiel 1 (Stromspiegel).......................................................................... 51
2.5.2 Beispiel 2 (spannungsgesteuerter Stromspiegel) ...................................... 52
2.5.3 Das translineare Prinzip............................................................................ 53
2.5.4 Translineare Schaltungen mit MOSFET................................................... 53
2.5.5 Anwendung translinearer Schaltungen .................................................... 54
2.6 Was bedeutet Signalverarbeitung im „Log-Modus“? ........................................... 54
2.6.1 Beispiel: Tiefpass ..................................................................................... 55
2.6.2 Anwendung von Log-Modus-Filtern ....................................................... 58
2.7 Verzerrungen – linear oder nichtlinear? ............................................................... 58
2.8 Ein digitaler Baustein als Linearverstärker? ......................................................... 59
2.9 Warum sind AGC-Verstärker „linear-in-dB“? ..................................................... 61
2.10 Die Phasenregelschleife (PLL) – linear oder nichtlinear? .................................... 63
3 Integrierte Linearverstärker ....................................................................................... 67
3.1 Wie wichtig ist die Symmetrie der Spannungsversorgung? ................................. 67
3.2 Operationsverstärker mit nur einer Versorgungsspannung? ................................ 68
3.3 Warum Verstärkerbetrieb nur mit Gegenkopplung? ......................................... 69
3.4 Warum Frequenzkompensation? ......................................................................... 70
3.5 Gibt es auch unkompensierte Verstärker? ............................................................ 72
3.6 Was versteht man unter gemischter Rückkopplung? .......................................... 73
3.7 Stabilitätsprobleme durch kapazitive Belastung? ................................................ 76
3.7.1 Methode 1: Trennwiderstand ................................................................. 77
3.7.2 Methode 2: Bedämpfung mit RC-Serienschaltung ................................ 78
3.7.3 Methode 3: Zweifach-Gegenkopplung .................................................. 79
3.8 Viel oder wenig Gegenkopplung für hohe Stabilität? .......................................... 80
3.9 Was ist ein Pol-Nullstellen-Paar? ........................................................................ 83
3.10 Kann man zwei Operationsverstärker kombinieren? ........................................... 85
3.11 Wodurch werden Anstiegs- und Einschwingzeiten festgelegt? ........................... 88
3.12 Was sind voll-differentielle Operationsverstärker? ............................................. 89
3.13 Warum Vorzugsbereiche für Widerstände und Kapazitäten? .............................. 92
3.14 Wird der OTA auch gegengekoppelt? ................................................................. 95
3.15 Sind Operationsverstärker gute Komparatoren? .................................................. 96
3.16 Kleinsignal- oder Großsignal-Bandbreite? ...................................................... 98
3.17 Nutzt der Miller-Integrator den Miller-Effekt? .................................................... 100
3.18 Welches ist die beste Integratorschaltung? .......................................................... 102
3.19 Was ist ein Transimpedanzverstärker? ................................................................ 104
3.20 Was sind „Current-Feedback“-Verstärker? ......................................................... 105
3.21 „Current-Feedback“-Verstärker als Integrator? ................................................... 108
3.22 Was ist ein „Current Conveyor“? ........................................................................ 109
Inhalt IX
4 Elektronische Filtertechnik ......................................................................................... 111
4.1 Sind analoge Filter heute noch von Bedeutung? .................................................. 111
4.2 Was ist eigentlich ein Aktivfilter ? ....................................................................... 112
4.3 Welche Vorteile haben aktive Filter? ................................................................... 113
4.4 Aktivfilter auch mit Einzeltransistoren? ............................................................... 114
4.5 In welchem Frequenzbereich arbeiten Aktivfilter? .............................................. 114
4.6 Wodurch unterscheiden sich Allpol-, Tschebyscheff- und Sallen-Key-Filter? .... 116
4.7 Wie viele Tiefpass-Schaltungsvarianten gibt es? ................................................. 116
4.8 Gibt es die optimale Filterschaltung? ................................................................... 117
4.9 Gibt es ein „Kochrezept“ für den Filterentwurf? ................................................. 118
4.10 Gilt die 3-dB-Grenzfrequenz für alle Filter? ....................................................... 119
4.11 Was ist eigentlich ein Filterpol? ........................................................................... 120
4.12 Welche Rolle spielt die Polgüte bei Tiefpässen? ................................................. 121
4.13 Was ist ein Kosinus-Filter? .................................................................................. 122
4.14 Was sind Zustandsvariablen-Filter? ..................................................................... 123
4.15 Wofür werden Allpässe verwendet? .................................................................... 124
4.16 Welchem Zweck dient die Bruton-Transformation? ............................................ 125
4.17 Gibt es Aktivfilter ohne Ohmwiderstände? .......................................................... 127
4.18 SC-Filter – analog oder digital? .......................................................................... 128
4.19 Wie arbeiten SC-Filter? ........................................................................................ 128
4.20 Was ist ein LDI-Integrator? ................................................................................. 131
4.21 SC-Stufen mit OPV oder OTA? ........................................................................... 132
4.22 Aktivfilter in RC- oder SC-Technik? ................................................................... 133
4.23 Warum sind kleine Grenzfrequenzen problematisch? .......................................... 135
4.24 Was sind Median-Filter? ..................................................................................... 137
4.25 Welche Technologie für integrierte Analogfilter? ............................................... 140
4.26 Was ist ein Polyphasen-Filter? ............................................................................. 141
4.27 Was ist ein Optimalfilter? ................................................................................... 143
4.28 Sind Filterentwurfs-Programme empfehlenswert? ............................................... 145
5 Harmonische Oszillatoren ........................................................................................... 147
5.1 Was ist ein harmonischer Oszillator? ................................................................... 147
5.2 Wann schwingt der Zweipol-Oszillator? ............................................................. 148
5.3 Wann schwingt der Vierpol-Oszillator? .............................................................. 149
5.4 Der Clapp-Oszillator – Zweipol- oder Vierpol-Oszillator? .................................. 150
5.5 Sind Oszillatoren lineare Schaltungen? ................................................................ 152
5.6 Gibt es eine hinreichende Schwingbedingung? .................................................... 153
5.7 Sinusform auch ohne Amplitudenstabilisierung? ................................................ 155
5.8 Gibt es ein allgemeines Qualitätskriterium für Oszillatoren? .............................. 158
5.9 Was ist ein Ringoszillator? .................................................................................. 159
X Inhalt
5.10 Welcher Oszillator für den milli-Hz-Bereich? ..................................................... 160
5.11 Was ist das Verfahren der „harmonischen Balance“? .......................................... 161
5.12 Was ist die beste Oszillatorschaltung? ................................................................. 164
6 Simulationstechnik ....................................................................................................... 167
6.1 Wie wird die offene OPV-Verstärkung simuliert? .............................................. 167
6.2 Wie überprüft man die Polverteilung bei Aktivfiltern? ....................................... 168
6.3 Kann SPICE mehr als Schaltungsanalyse? .......................................................... 169
6.4 Falsch oder richtig? .............................................................................................. 171
6.5 Wie wird die Schleifenverstärkung simuliert? ..................................................... 174
6.5.1 LC-Kopplung ......................................................................................... 174
6.5.2 Strom-Spannungs-Einspeisung .............................................................. 175
6.5.3 Spannungseinspeisung ........................................................................... 176
6.5.4 Beispiel (Vergleich) ............................................................................... 176
6.6 Kann man die Phasenreserve direkt bestimmen? ................................................. 177
6.6.1 Das Phasensteilheits-Verfahren ............................................................. 178
6.6.2 Beispiel .................................................................................................. 178
6.6.3 Modifikation des Verfahrens ................................................................. 180
6.7 Phasenkompensation mit SPICE? ........................................................................ 180
6.8 Wie simuliert SPICE den Frequenzgang von SC-Filtern? ................................... 185
6.8.1 Separate Nachbildung beider Taktphasen .............................................. 185
6.8.2 Die Storistor-Methode ........................................................................... 186
Anhang A Der Begrenzungseffekt bei Integratoren................................................. 189
Anhang B Das Phasensteilheits-Verfahren (Interpolation)....................................... 193
Anhang C Phasenkompensation (Ableitung der Formeln)....................................... 195
Literaturverzeichnis .......................................................................................................... 197
Sachverzeichnis ................................................................................................................ 199
1 Allgemeine System- und Rückkopplungstheorie
1.1 Was sind komplexe Frequenzen?
Die üblicherweise mit dem Symbol s (in mathematisch orientierten Abhandlungen oft auch
mit p) bezeichnete Größe ist eine komplexe Frequenzvariable, die im Zusammenhang mit der
Laplace-Transformation definiert wird.
Die Eigenschaften frequenzabhängiger Systeme können durch Differentialgleichungen
(DGLn) beschrieben werden, deren Lösungen entscheidend vereinfacht werden, wenn die
DGLn speziellen Integraltransformationen unterzogen werden. Dadurch wird die DGL in eine
einfach zu lösende algebraische Gleichung überführt, wobei die ursprüngliche Zeitvariable t
(Originalbereich) in eine neue Frequenzvariable (Bildbereich) übergeht.
Besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Fourier-Transformation, deren
Anwendung auf eine beliebige Zeitfunktion x(t) zum zugehörigen Amplitudendichtespektrum
X(j(cid:90)) führt:
F(cid:94)x(t)(cid:96)(cid:32) X(j(cid:90))(cid:32)(cid:179)(cid:14)(cid:102)x(t)e(cid:16)j(cid:90)tdt.
(cid:16)(cid:102)
Diese Form der Integraltransformation ergibt jedoch nur dann ein auswertbares Ergebnis,
wenn die Funktion x(t) mit wachsender Zeit kleiner wird – das Integral also „konvergiert“. So
würde beispielsweise die bevorzugt als Testsignal benutzte Einheits-Sprungfunktion zu keiner
vernünftigen Lösung führen.
Deshalb wird die in den Frequenzbereich zu transformierende Funktion mit einem zusätzlichen
Faktor e-(cid:86)(cid:152)t multipliziert, der mit wachsender Zeit abnimmt. Dabei kann (cid:86) immer so gewählt
werden, dass die Konvergenz des Integrals gewährleistet ist:
(cid:94) (cid:16)(cid:86)t(cid:96) (cid:14)(cid:102) (cid:16)(cid:86)t (cid:16)j(cid:90)t
F x(t)e (cid:32)(cid:179) x(t)(cid:152)e (cid:152)e dt.
(cid:16)(cid:102)
Werden die Exponenten unter dem Integral abkürzend mit s=((cid:86) + j(cid:90)) zusammengefasst und
gleichzeitig die untere Integrationsgrenze auf t=0 festgelegt, entsteht die einseitige Laplace-
Transformation:
L(cid:94)x(t)(cid:96)(cid:32) X(s)(cid:32)(cid:179)(cid:14)(cid:102)x(t)(cid:152)e(cid:16)stdt .
0
Durch die reelle Größe (cid:86) ist im Bildbereich (Frequenzbereich) somit eine neue Variable s
entstanden, die als Ausdehnung der Frequenzvariablen j(cid:90) in den komplexen Zahlenbereich
interpretiert werden kann und deshalb als „komplexe Frequenz“ bezeichnet wird. Für (cid:86)=0
geht die Laplace-Transformation dann wieder in die Fourier-Transformation über.
Eine besonders wichtige Konsequenz aus diesen Überlegungen ist die umgekehrte Aussage,
dass Bereiche, für die das Laplace-Integral nicht konvergiert (Unendlichkeitsstellen), dann
insbesondere nur für negative (cid:86)-Werte auftreten können.
Dieses kann am Beispiel eines einfachen passiven Netzwerks aus Widerstand, Kondensator
und Spule verdeutlicht werden.