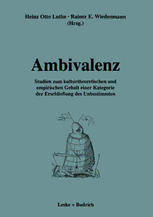Table Of ContentAmbivalenz
Heinz Otto Luthel
Rainer E. Wiedenmann (Hrsg.)
Ambivalenz
Studien zum kulturtheoretischen
und empirischen Gehalt
einer Kategorie der Erschließung
des Unbestimmten
Leske + Budrich, Opladen 1997
Veröffentlicht mit finanzieller Unterstützung der Otto-von-Freising-Stiftung
Umschlaggestaltung unter Verwendung einer Gravur aus den
"Songes drolatiques de Pantagruel", einer Sammlung aus dem Jahre 1565
Die Deutsche Bibliothek -CIP-Einheitsaufnahme
Ambivalenz: Studien zum kulturtheoretischen und empirischen Gehalt einer Kategorie
der Erschließung des Unbestimmten / Heinz Otto LuthelRainer E. Wiedenmann (Hrsg.).
-Opladen: Leske + Budrich, 1997
ISBN 978-3-8100-1913-4 ISBN 978-3-322-91433-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-91433-0
©1997 Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und stratbar. Das gilt insbesondere ftir Vervielfaltigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis Seite
Vorwort ................................................... 7
Heinz Otto LuthelRainer E. Wiedenmann
Einleitung ................................................. 9
Gerhard Gamm
Die Flucht aus der Kategorie.
Die Unbestimmtheit der modernen Welt im Spiegel
philosophischer Diskurse ..................................... 35
Ursula A.J Becher
Kontingenz und historische Erzählung ......................... 65
Wolfgang Brückner
Spiegel-Erkenntnis.
Mittelalterliche Realie und doppeldeutige Metapher ................ 83
Zygmunt Bauman
Modernity and Clarity.
The Story of a Failed Romance ............................... 109
Heinz-Günter Vester
Ambivalenzen der postmodernen Geschichte .................. 123
Birgitta Nedelmann
Typen soziologischer Ambivalenz
und Interaktionskonsequenz ................................ 149
RudolfS tichweh
Ambivalenz, Indifferenz und die Soziologie
des Fremden ............................................. 165
Rainer E. Wiedenmann
Tierbilder im ProzeB gesellschaftlicher Differenzierung.
Überlegungen zu Struktur und Wandel soziokultureller
Ambivalenzkonstruktion 185
Heinz Otto Luthe
Validierungsprozesse -Zur Dynamik von Ambivalenz 223
Autorinnen und Autoren ................................... 245
Vorwort
Die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes gehen auf Vorträge im Rahmen
einer Arbeitstagung zum Thema "Ambivalenz und Kultur" zurück, die vom
23. bis 25. Oktober 1996 an der Katholischen Universität Eichstätt stattfand.
Für ihre Unterstützung bei der TextersteIlung danken wir Herrn Arne Bladt,
Frau Julia Ellis, Herrn Wolfgang Schäfer M.A. und Frau Dipl.-Soz. Kirsten
Toepffer-Wenzel. Unser besonderer Dank gebührt Frau Ursula Niefuecker fUr
ihre engagierte Mithilfe bei der Tagungsorganisation und der Anfertigung der
Druckvorlage.
Nicht zuletzt danken wir der Otto-von-Freising-Stiftung, die unser Projekt
finanziell unterstützt hat.
Die Herausgeber
Einleitung
Heinz Otto Luthe und Rainer E. Wiedenmann
"Gegen Ende dieses Jahrhunderts ist die Ambivalenz der Modeme nicht nur ein
Thema der Soziologie, sondern zumindest in den westlichen Industriegesell
schaften die Erfahrungsgrundlage einer allgemeinen Krisenstimmung. .. ", I heißt
es in einem kürzlich erschienenen Sammelband mit dem Titel "Modernität und
Barbarei". In den letzten Jahren verbinden sich soziologische Gegenwarts
diagnosen, die sich des Ambivalenzbegriffs bedienen, um diese "Krisenstim
mung" einzufangen, vor allem mit dem Stichwort der "reflexiven Modernisie
rung" und den Thesen von Zygmunt Bauman. Unabhängig davon, ob eine "spä
te Modeme" sich nun durch reflexive Selbstmodernisierung vollenden soll,2
oder ob es um ein "ästhetisches Paradigma der Moderne"3 geht, das die Rele
vanz von Ambivalenzen und Kontingenzen fiir die Entwicklungsbedingungen
und immanenten Grenzen der "reflexiven Modernisierung" aufWeisen will, -
unübersehbar ist allemal eine kaum verhüllte Ratlosigkeit angesichts eines
Modernitätsbegriffs, der zusehens den Aufforderungscharakter einer allumfas
senden Zeitdiagnose anzunehmen scheint.
I
Vor allem Publikationen von Zygmunt Bauman4 haben in den letzten Jahren
wesentliche Orientierungsvorgaben eines soziologischen Diskurses geliefert,
dessen Fluchtpunkt die Frage nach einer globalen Diagnose "der" Modeme zu
sein scheint. Baumans Leitthese zufolge war es eine zentrale Tendenz der
Modeme, in Wissenschaft, Verwaltung, Kunst und Politik "klare und distinkte"
Klassifikationsordnungen zu etablieren, "Ordnungen", die darauf abzielten,
Ambivalenz auszulöschen, d.h. die Universalisierung rational gebändigter
Diskurse wie auch die fortschreitende Transparenz lebensweltlicher "Ordnun-
I M. MiIler, H.-G. Soeffner 1996: 10.
2 Vgl. besonders U. Beck, A,. Giddens, S. Lash 1996.
3 S. Lash 1992.
4 Vgl. bes. Z. Bauman 1989; 1990; 1992.
10 Heinz Dito LutheiRainer E. Wiedenmann
gen" zu gewährleisten.s Freilich, gerade diese Ordnungsanstrengungen der Mo
derne provozieren eine Wiederkehr der Ambivalenzen: "Die Gesamtsumme der
Ambivalenz scheint sowohl auf personaler wie auf gesellschaftlicher Ebene
unaufhaltsam zu wachsen. Allem Anschein nach gedeiht Ambivalenz besonders
prächtig auf dem Boden der Anstrengungen, sie zu zerstören .. .'>6 Demgegen
über sei es ein Signum der sich abzeichnenden Postmoderne, sich mit den
Ambivalenzen zu arrangieren und den modernen Perfektionsidealen zu entsa
gen. Baumans Ansatz rehabilitiert eine Ambivalenz, die den Traum der Ver
nunft mitsamt seinen Ungeheuem bannen soll.
Die Diskussionen und kritischen Einwände, die sich an diese Thesen an
geschlossen haben,7 sollen hier nicht nachgezeichnet oder gewichtet werden.
Problematisch erscheint weniger, daß diese Debatte immer dann Engfilhrungen
aufweist, wenn ältere Befunde und Erträge einer sozial- und kulturwissen
schaftlichen Ambivalenz- bzw. Ambiguitätsforschung vergessen bzw. nicht
(oder kaum) zur Kenntnis genommen werden. Gravierendere Bedenken müssen
dort angemeldet werden, wo Prozesse der reflexiven Modemisierung oder der
gesellschaftlichen Ambivalenzproduktion bzw. -reduktion zu Leitformeln einer
umfassenden oder linearistischen Entwicklung hypostasiert werden. Hier
zeichnet sich die Gefahr einer spätmodernen, paradoxerweise sogar postmoder
nen Version einer die Geschichtsphilosophie beerbenden "Metaerzählung" ab.
Daß etwa Baumans Arbeiten 4erartige Deutungen eher unterstützen als unter
minieren, darauf machen nicht nur einige der hier vorgestellten Arbeiten
aufmerksam, -auch die jüngste Kritik weist auf diesen Sachverhalt hin.8
Unsere kritischen Anmerkungen sollten freilich nicht als Verabschiedung der
Ambivalenzthematik mißverstanden werden. Im Gegenteil: Nicht nur die
Soziologie, auch ihre Nachbarwissenschaften sind vielleicht nun "erst recht"
angehalten, sich dem Facettenreichtum und der Plastizität der damit assoziier
ten Sachverhalte zu stellen. In empirischer wie theoretischer Hinsicht meint der
5 Z. Bauman denkt hier an die verschiedenen Formen des Anomalien bereinigenden
"social engineering", -bis hin zum Versuch einer physischen Ausrottung der Ambi
valenz im Holocaust.
6 Z. Bauman 1992: 279.
7 VgL die Beiträge von W. Bonß (1993) oder U. Bielefeld (\993) im Heft 4 der Zeitschrift
"Mittelweg".
8 So merkt z.B. B. Rommelspacher (1997: 260) in ihrer Besprechung von Z. Baumans
"Postmoderner Ethik" zu dessen Modernitätskonzept an: "Die Modeme erscheint in
Baumans Charakterisierung als monolithisch. Die Gegenseite wird nirgendwo sichtbar."
Einleitung 11
Begriff der Ambivalenz zunächst ja sehr unterschiedliche Erscheinungen,
Phänomene, die oftmals durch verwandte Konzepte wie Mehrdeutigkeit, Mehr
wertigkeit, Unbestimmtheit, Fremdheit, Unordnung, Kontingenz usw. um
schrieben werden. Sie alle markieren einen Gegenstandsbereich, der eine exak
te Grenzziehung und Zuordnung von konkreten Erscheinungen nicht zuläßt,
sondern jeweils die "beiden", diesseits wie jenseits der definitorischen Grenzen
zu findenden Bereiche, also Bekanntes und Unbekanntes, Altes und Neues,
Fremdes und Eigenes miteinander in Beziehung bringt und damit Grenz-und
Passage- (Liminal-)bereiche enthält bzw. eröffuet. Das so bezeichnete For
schungsfeld entgeht zumeist der definitorischen Auflnerksamkeit oder bleibt
durch die Fraglosigkeiten alltagsweltlicher oder wissenschaftlicher Klassifika
tionsusancen oftmals verdeckt.
Insbesondere die Soziologie sucht "ambivalenzträchtige" Sachverhalte nicht
selten durch Konzepte wie Mehrdeutigkeit, Kontingenz, Risiko oder auch
Ambiguität9 auf den Begriff zu bringen. Vor allem beim Konzept der Ambigui
tät vermißt man häufig eine erkennbare Abgrenzung der bei den Konzepte. So
behandelt etwa Lothar Krappmann in seinen Überlegungen zu den Bedingun
gen und Facetten der "Ambiguitätstoleranz"l0 nicht nur Studien der sozial-und
persönlichkeitspsychologischen Ambiguitätsforschung, 11 sondern auch die
Ambivalenzkonzepte von Robert K. Merton, E. Barber, Lewis Coser oder
Erving Goffinan.12
9 So gibt es einige soziologische Fachwörterbucher, die beide Stichwörter (Ambivalenz,
Ambiguität) anfilhren, z.B. K.-H. Hillmann (1994: 22f.), G. Reinhold (1991: 13) und W.
Fuchs u.a. (1994: 34,427). Letztere filhren "Ambivalenz", "Ambivalenzkonflikt" "Am
biguitätstoleranz" sogar als gesonderte Stichwörter an, unter "Ambiguität" findet sich
ein Verweis auf das Stichwort "Mehrdeutigkeit". Hier wird der Leser dann auf For
schungen von E. Frenkel-Brunswik und auf das Problem der "Intoleranz gegen Mehr
deutigkeit" aufinerksam gemacht (sowie auf die Stichwörter "Rigidität" und "autoritäre
Persönlichkeit"). Daneben finden sich Soziologielexika, die ausschließlich "Am bi
valenz"f'ambivalence" auffiihren (z.B. G. Marshalll994: 13). Vgl. zur Abgrenzung von
Ambivalenz und Ambiguität im übrigen die Arbeit von I. Bindseil 1976.
10 Vgl. L. Krappmann 1975: 150ff. Ein jüngeres Beispiel ist hier H. Geller, der Formen
und Bedingungen der "Ambiguitätstoleranz" nachspürt (vgl. H. Geller 1994: 127ff.).
In der Konfliktsoziologie wurde der Ambiguitätsbegriffneben dem Ambivalenzkonzept
vielleicht besonders häufig verwendet; vgl. etwa J. Galtungs (1973: 149ff.) Diskussion
der Ambiguität (hier: der "Zweideutigkeit") bzw. der Unzweideutigkeit der Entschei
dungsmechanismen bei der Konsensfindung.
II Z.B. E. Frenkel-Brunswik 1949/50, P. O'Connor 1952, J. Block und J. Block 1951, A.
Davids 1955; 1956.
12 Vgl. R. Merton, E. Barber 1976, L. Coser 1972: 74ff., E. Goffinan 1981.
12 Heinz Otto Luthe/Rainer E. Wiedenmann
Im Vergleich damit sind Studien sehr viel zahlreicher, in denen zwar einzelne
Bezüge zu unterschiedlichen "Ambivalenz"-Facetten anklingen, die aber die
inhaltlichen Implikationen und Grenzen dieses Konzepts höchstens andeutungs
weise erkennen lassen. Im Bereich der Soziologie ruraler Lebensverhältnisse ist
Z.B. von einer "farmer ambivalence toward agricultural research"13 die Rede,
andernorts von der "Ambivalenz der Arbeiterschaft" gegenüber ihren Unter
nehmenl4 oder von der Ambivalenz der politischen Öffentlichkeit gegenüber
der RegierungiS usw. Andere Untersuchungen behandeln Ambivalenzen im
Ralunen so umfassender Fragestellungen, wie: des Naturverhältnisses der Mo
deme, der Kontingenzen gesellschaftlicher "Möglichkeitshorizonte", der gesell
schaftlichen Kommunikationsstrukturen oder der Ästhetik des Posthistoire.16
Wieder andere Beiträge diskutieren die immanenten oder ideengeschichtlich
aufweisbaren Ambivalenzen theoretischer Ansätze. Hier geht es darum, die
"Ambivalenz der Modeme" bei Ernst Troeltsch aufzuzeigen oder auch die
Ambivalenzen und Ambiguitäten in Max Webers, Max Horkheimers oder
Theodor W. Adornos Sicht der Modeme auszuloten.17 Nicht zuletzt benutzen
Studien über soziale Bewegungen oftmals das Ambivalenzkonzept als In
strument zur Erfassung widersprüchlicher Tendenzen oder gegenläufiger
Auswirkungen sozialer Bewegungen.18 Seltener sind Arbeiten, die im Rahmen
themenspezifischer Fragestellungen weitergehende Differenzierungen des
Ambivalenzkonzepts vornehmen.19
11
Dennoch: In den Sozial-und Kulturwissenschaften finden sich durchaus auch
vergleichsweise "ausgearbeitete" Ambivalenz-bzw. Ambiguitätskonzeptionen,
13 G. Gillespie, F. Buttel 1989.
14 V. Perez-Diaz 1988.
15 V gl. am Beispiel der Gesundheitsreformprojekts der Clinton-Adminstration L. Jacobs
1993.
16 K. Eder 1992; M. Makropoulos 1990; J. Westerbarkey 1991; D. Kamper 1988.
17 H. Fischer 1984; S. Benhabib 1982: bes. 127, 137.
18 Vgl. z.B. K. Eder 1986; K.-W. Brand 1989.
19 Vgl. zur Ambivalenz des Sicherheitsstrebens Z.B. F.-X. Kaufmanns (1970: 28ff.) Dar
stellung des Verhältnisses von "innerer" und "äußerer" Sicherheit.