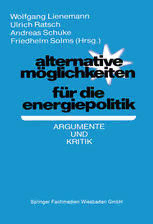Table Of ContentWolfgang Lienemann/Ulrich Ratschl Andreas Schuke/Friedhelm Solms (Hrsg.)
Alternative Moglichkeiten fur die Energiepolitik
Wolfgang Lienemann· Ulrich Ratsch
Andreas Schuke . Friedhelm Solms (Hrsg.)
Alternative Moglichkeiten
fur die Energiepolitik
Argumente und Kritik
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Alternative Moglichkeiten fUr die Energiepolitik:
Argumente u. Kritik / Wolfgang Lienemann ...
(Hrsg.). - Opladen: Westdeutscher Verlag, 1978.
ISBN 978-3-531-11463-7
NE: Lienemann, Wolfgang [Hrsg.]
© 1978 Springer Fachmedien Wiesbaden
Urspriinglich erschienen bei Westdeutscher Verlag GmbH, Op1aden 1978
Umschlaggestaltung: Ursula und Dieter Gielnik, Wiesbaden
Satz: Vieweg, Wiesbaden
Alle Rechte vorbehalten. Auch die fotomechanische Vervielfăltigung (Fotokopie, Mikrokopie)
oder von Teilen daraus bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages.
ISBN 978-3-531-11463-7 ISBN 978-3-322-83864-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-83864-3
Inhalt
Vorwort cler Herausgeber ..................................... 7
THESEN
Wolfgang Lienemann, Ulrich Ratsch, Andreas Schuke, Friedhelm Solms
Alternative Moglichkeiten fUr die Energiepolitik .............. . 11
Einleitung 11
1. Die gegenwartige Energiepolitik der Bundesrepublik Deutschland 16
Die Ziele der offiziellen Energiepolitik ................ . 16
Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen .............. . 17
Szenario 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Diskussion cler gegenwartigen Energiepolitik und ihrer Konsequenzen 23
Diskussion der innen- und augenpolitischen Rahmenbedingungen der
gegenwartigen Energiepolitik .......................... 31
IL Notwendigkeit und Prioritaten einer alternativen Energiepolitik der
Bundesrepublik Deutschland ................................ 42
III. Umrisse einer alternativen Energiepolitik in der
Bundesrepublik Deutschland ......... 49
Ansatze zur rationellen Energienutzung ..... 49
Szenario II ....................................... 52
Diskussion einer alternativen Energiepolitik und ihrer Konsequenzen . 54
Anhang .......................................... 64
1. Abkiirzungen uncl Erlauterungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2. Verzeichnis der Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland 70
3. Anmerkungen .......................................... 72
ARGUMENTE
Ulrich Ratsch
Energieszenarien ........................................... 75
Roman Bauer
Okologische Risiken durch Energieumwandlungsprozesse in Kraftwerken . . . . .. 91
Manfred Fischer
Okologische Grenzen und Industriegesellschaft 105
Andreas Schuke
Wirtschaftswachstum - Beschăftigung - Energieeinsparung.
Bemerkungen zu einem umstrittenen Zusammenhang ..... 119
Hans-Joachim Bieber
Die politische Entwicklung der friedlichen Kernenergienutzung in der
Bundesrepublik Deutschland .................................. 130
Siegfried de Witt
Kernenergie und Rechtsstaat ............................. 146
Wolfgang Lienemann
Prognose - Planung Kontrolle. Oberlegungen zum Problem verstărkter
Btirgerbeteiligung im Bereich der Energieplanung ................ 157
Friedhelm Solms
Das Ende ei ner Illusion. Zur Problematik der Unterscheidung von ziviler und
militărischer Nutzung der Atomenergie .......................... 179
Bernhard Moltmann
Internationale Nuklearpolitik unter dem Vorzeichen traditioneller Machtpolitik 204
Gerhard Liedke
Kernenergie und Schopfungsauftrag 215
KRITlKEN
Friedrich-Karl Boese / Hermann Henssen
Kommentare zur Studie "Alternative Moglichkeiten ftir die Energiepolitik"
der Forschungsstătte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FESt). . . . . . 227
Wolf Hafele
Stellungnahme zu der von der Forschungsstătte der Evangelischen Studien
gemeinschaft vorgelegten Schrift: "Alternative Moglichkeiten fUr die
Energiepolitik" ....................................... 239
Otto Kimminich
Stellungnahme zur Studie "Alternative Moglichkeiten ftir die Energiepolitik" 243
Heinz-Jiirgen Schiirmann
Grundlagen einer marktwirtschaftlich orientierten Energiepolitik als
Kontrastprogramm ................................ . .. 256
Dieter Smidt
Stellungnahme zur Studie "Alternative Moglichkeiten ftir die Energiepolitik"
der Forschungsstătte der Evangelischen Studiengemeinschaft ........... 276
Autorenverzeichnis 285
Vorwort
Seit der Debatte iiber die Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik Deutschland und
den Auseinandersetzungen iiber die Notstandsgesetze hat es in diesem Lande kein
Thema gegeben, iiber das so erbittert gestritten worden ist und weiter gestritten wird
wie iiber das Problem der langfristigen Energieversorgung. Der Dissens iiber die Rolle,
die der Kernenergie in diesem Zusammenhang zukommt, geht quer durch alle Parteien
und gesellschaftlichen Gruppen. Er hat auch die Wissenschaften nicht unangetastet ge
lassen. Sie haben nicht verhindern k6nnen, daG beide Seiten unter oft bedenkenloser
Verwendung wissenschaftlicher Argumente ihre jeweiligen Positionen vertreten; denn
Befiirworter wie Gegner der Kernenergie finden sich heute in jeder Fachwissenschaft.
Das gilt selbst fUr die Naturwissenschaften. Friiher als andere gesellschaftliche Gruppen
sind die Kirchen, ob sie es nun wollten oder nicht, in diese Auseinandersetzung hinein
gezogen worden. Viele Gemeindemitglieder und auch pfarrer haben sich auf die Seite
von Biirgerinitiativen gestellt, die sich gegen den Bau weiterer Kernkraftwerke wenden.
In dieser Situation, die geprăgt war von einer kaum zu iiberbriickenden Polarisierung
der Gesellschaft, wachsendem Zweifel an der Unabhăngigkeit wissenschaftlichen Sach
verstandes und einem unausweichlich gewordenen politischen Entscheidungsdruck
wandte sich Ende 1975 die Evangelische Landeskirche in Baden an die Forschungs
stătte der Evangelischen Studiengemeinschaft (F.E.St.) mit der Bitte um ein wissen
schaftliches Gutachten zur Energieproblematik. Entsprechend der satzungsgemăGen
Aufgabe des Instituts haben daraufhin Vorstand, wissenschaftliches Kuratorium und
Kollegium der FEST gemeinsam beschlossen, dieser Anfrage zu entsprechen und ein
Projekt durchzufUhren, das die wissenschaftlichen Grundlagen fiir ein solches Gutach
ten erarbeiten sollte.
Trăger der mehr als fiinfzehnmonatigen Forschungsarbeit war ein interdisziplinăr
zusammengesetzter Kreis von 25 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aus verschiedenen Fachrichtungen. Dazu geh6rten neben den beteiligten Mitgliedern des
Kollegiums der F .E.St. 12 Mitarbeiter aus Instituten und Institutionen, zu denen die
F.E.St. seit langem stăndige Arbeitskontakte unterhălt und die fachwissenschaftlich
auf dem Energiesektor tătig sind. Ohne deren umfassende Sachkompetenz und spon
tane Bereitschaft, fiir die Laufzeit des Projekts zum Teil unentgeltlich feste Arbeits
verpflichtungen zu iibernehmen, hătte das Projekt schon wegen der komplexen Pro
blemlage und der Heterogenităt der zu beriicksichtigenden Forschungsergebnisse nicht
durchgefiihrt werden k6nnen. Es erwies sich als sachlich notwendig, dariiber hinaus zu
thematisch zentralen Fragestellungen der Energieproblematik Konsultationen durch
zufUhren, zu denen aus dem In- und Ausland jeweils Experten aus Wissenschaft, Wirt
schaft und Verwaltung mit m6glichst unterschiedlichen Standpunkten eingeladen
wurden. Diese Kosultationen hatten in der Regel die Form eines Hearings und dienten
8 Vorwort der Herausgeber
vor allem der kritischen Prlifung dessen, was in der energiepolitischen Diskussion wis
senschaftlich gesichert und was offen oder kontrovers ist. Daneben gab es zahlreiche
Einzelgesprăche mit Fachleuten liber Detailfragen. Das Ergebnis dieser Arbeit war ein
Gutachten, das im Mai 1977 in den "Texten und Materialien der Forschungsstătte der
Evangelischen Studiengemeinschaft, Reihe A, Nr. 1" der bffentlichkeit vorgelegt
wurde.
Seit dem Frlihjahr 1977 lassen sich indes Korrekturen an der bisher verfolgten Ener
giepolitik beobachten. Die noch Mitte der 70er Jahre vorgelegten Prognosen liber die
mutma~liche Entwicklung des Energiebedarfs der Bundesrepublik Deutschland sind
alle erheblich nach unten korrigiert worden. Dazu haben gewi~ auch die bescheidene
ren Erwartungen hinsichtlich des klinftigen Wirtschaftswachstums beigetragen.
Ebenso aber spiegelt sich darin die wachsende Einsicht, da~ die Anstrengungen zur
Ausschopfung aller Potentiale des Energiesparens Priorităt verdienen. Die Bundesre
gierung legt zwar ihrer Zweiten Fortschreibung des Energieprogramms vom 14.12.1977
nach wie vor die quantitativen Abschătzungen ihrer "Grundlinien und Eckwerte" vom
23.3.1977 zugrunde, aber sie bekennt sich in der Formulierung ihrer Priorităten zu
der Aufgabe, "den langfristigen Zuwachs der Energienachfrage zu verringern" (Tz. 4).
Dieser Kurs wurde wohl nicht zuletzt unter dem Eindruck der Fachkonferenz der
SPD im April 1977 zum Thema "Energie ~ Beschăftigung ~ Lebensqualităt" einge
schlagen.
Man kann beobachten, da~ die Einsicht in die Notwendigkeit langfristigen Energie
Nullwachstums und "stabiler" Energieszenarien allmăhlich wăchst. Nahezu unvermit
telt steht daneben aber die Unfăhigkeit der Wirtschaftspolitik, den konjunkturellen
Krisenerscheinungen anders zu begegnen als mit den alten Rezepten der Politik des
Wirtschaftswachstums. Eine Energiepolitik, die vor allem den kurzfristigen Zielen des
wirtschaftspolitischen Krisenmanagement dient, mu~ aber angesichts der von ihr not
wendig erzeugten Folgeprobleme als hochst fragwiirdig gelten. Es wird in der năchsten
Zeit viei davon abhăngen, ob es gelingt, da~ die Gegner im Streit um die klinftige Ener
gieversorgung sich dieser Verantwortung nicht entziehen. Weil in dem Gutachten der
F .E.St. gerade diese langfristigen Probleme dargestellt und zur Diskussion gestellt wer
den soli ten, verdienen die einzelnen Argumente auch heute noch unverminderte Beach
tung.
Eine liberarbeitete Fassung der Einleitung und der Teile I~III dieses Textes, die
kritische Anmerkungen und Anregungen wăhrend der ersten Diskussionsphase berlick
sichtigt, bildet den ersten Teil dieses Buches. Diese Studie ist mit dem Gutachten der
F. E. St. also nicht identisch. Flir sie tragen die Herausgeber, die das Projekt als Team
geleitet und koordiniert haben, die alleinige Verantwortung. Der zweite Teil enthălt
Einzelstudien zu wichtigen Argumentationen. Die Beitrăge sind in ihren Grundzligen
wăhrend der Projektarbeit entstanden. Zusammen mit weiteren Studien, die in drei
Bănden ebenfalls in den "Texten und Materialien der Evangelischen Studiengemein
schaft" erschienen sind, dienen sie der Begrlindung fUr die einzelnen Aussagen des
ersten Teils. Den dritten Teil schlie~lich bilden Kritiken von prominenten Energie
experten, die auf Bitten der Herausgeber eigens fUr dieses Buch geschrieben worden
sind. Sie sind vor Drucklegung zwischen den Autoren und den Herausgebern nicht dis-
VOI'Wort der Herausgeber 9
kutiert worden und erscheinen hier in ihrer authentischen Fassung. Darauf im Rahmen
dieses Buches noch einmal einzugehen, hielten die Herausgeber aus Griinden der Fair
neg und um der Offenheit der Kontroverse willen fUr unangemessen.
Allen, die an diesem Projekt und insbesondere an diesem Auswahlband mitgearbei
tet, seinen Fortgang durch Anregungen und Kritik gefordert und damit die Veroffent
lichung in dieser Form ermoglicht haben, danken die Herausgeber auch an dieser Stelle.
Wolfgang Lienemann
Ulrich Ratsch
Andreas Schuke
Friedhelm Solms
THESEN
Wolfgang Lienemann, Ulrich Ratsch, Andreas Schuke, Friedhelm Solms
Alternative Moglichkeiten fur die Energiepolitik
Einleitung
(1) Die Energieversorgung ist eines der entscheidenden Strukturprobleme aller
Staaten wăhrend der letzten J ahrzehnte dieses J ahrhunderts. Ihr kommt zugleich
eine zentrale Bedeutung fUr das Verhăltnis zwischen den hochindustrialisierten Lăn
dern und den Lăndern der Dritten und Vierten Welt zu. Erst in den vergangenen
J ahren ist der bffentlichkeit bewugt geworden, dag die Reserven der Erde an fossilen
Energietrăgern (Kohle, Erdăl, Erdgas) begrenzt sind. Man hat angefangen zu begrei
fen, dag eine bkonomie, die auf einer stăndig wachsenden Ausbeutung dieser Energie
trăger beruht, sich selbst zum Kollaps verurteilt. Vor dem blschock des Jahres 1973
hatten die Vălker, die Trăger der wirtschaftlichen Entscheidungen und die Regierun
gen diesen einfachen Zusammenhang nahezu vollstăndig verdrăngt. Allmăhlich aber
kann man sich nicht mehr der Erkenntnis verschliegen, dag einige privilegierte Lăn
der natiirliche Ressourcen, die in J ahrmillionen der Erdgeschichte entstanden sind,
innerhalb von rund 150 J ahren so schnell verbrauchen, dag die Erschăpfung dieser
Vorrăte absehbar ist. Die zunehmende Verknappung von Bodenschătzen, vor allem
aber die Begrenztheit der Reserven an fossilen Energietrăgern, treibt die Preise in die
Hăhe. Lebensnotwendige Energie wird damit ftir viele Lănder der Dritten und Vier
ten Welt unbezahlbar.
(2) Die Energiepreissteigerungen der letzten J ahre waren ein verstărkender Faktor
in einer weltweiten Wirtschaftskrise, von der auch die Volkswirtschaft der Bundes
republik Deutschland aufgrund ihrer starken internationalen Verflechtung und ihrer
hohen Abhăngigkeit von Rohstoffimporten betroffen ist. Die mittelbaren Folgen
dieser Weltwirtschaftskrise zeigen sich an der erheblich gestiegenen Arbeitslosen
quote der vergangenen J ahre, von der niemand weig, ob und wann sie sich verringern
Iăgt. Manche erklăren, dag ein kontinuierliches Wachstum des Energieeinsatzes zur
Senkung der Arbeitslosigkeit unbedingt erforderlich sei. Diese Behauptung, die in
energiepolitischen Diskussionen gerne und hăufig wiederholt wird, ist jedoch keines
wegs so stichhaltig, wie sie klingt. In den letzten J ahren jedenfalls hat das Dberange
bot an Energie zu einem nennenswerten Abbau der hohen strukturellen Arbeitslosig
keit nicht beigetragen.
12 Wolfgang Lienemann u. a.
(3) Die Notwendigkeit, in verstarktem MaB Kernenergie einzusetzen, wird von
de ren Befiirwortern aus den erwahnten krisenhaften Entwicklungen hergeleitet. Die
Begrenztheit an fossilen Energietragern, so wird argumentiert, n6tigt dazu, in gr6Berem
Umfang zu Kernenergie als alternativer EnergiequelIe tiberzugehen. Gerade gegen den
forcierten Ausbau der Kernenergie aber richtet sich der zum Teil massive Widerstand
von Btirgerinitiativen. Ftir sie symbolisiert die Kernenergie die verhangnisvolIen Konse
quenzen ei nes ausbeuterischen Umgangs mit der Natur, der sich in der neuzeitlichen
Technik ausgebildet hat. In dem verbreiteten Protest gegen den Bau von Kernkraft
werken kommt also ein KrisenbewuBtsein zum Ausdruck, das nicht leichthin tiber
gangen werden darf. Das Unbehagen vieler Btirger erwachst zum einen aus dem MiB
trauen gegentiber einer neuen Energieform, deren m6gliche weitreichenden Folgen ftir
die Zukunft der Menschheit ihnen nicht hinreichend durchdacht erscheinen. Diese
Energieform stelIt das herausragende Beispiel ftir groBtechnische Systeme dar, die von
immer mehr Menschen zunehmend als inhuman erfahren werden. Zum anderen zeigt
sich am Protest gegen den Bau weiterer Kernkraftwerke der Unmut an einer Verwal
tungspraxis, die dem Anspruch der Btirger auf Mitsprache nicht gerecht wird. Dadurch
wachsen Zweifei an der Funktionsfahigkeit des Rechtsstaates. Es wachst eine Staats
verdrossenheit, die ftir ein demokratisches Gemeinwesen auf Dauer unertriiglich sein
muB.
(4) Die Kernenergie unterscheidet sich von anderen GroMormen der Technik
dadurch, daB sich bei ihr langfristige Probleme mit besonderer Intensitat stelIen. Dazu
geh6ren die Endlagerung der radioaktiven AbfalIe, die besondere GefahrIichkeit
des Plutoniums, dessen Radioaktivitat erst nach mehr als 100000 Jahren auf unbe
denkliche Werte abklingt, und die Erh6hung der Wahrscheinlichkeit genetischer Scha
den, die sich erst nach Generationen zeigen. Man hatte deshalb erwarten mtissen, daB
einer Entscheidung ftir den Einsatz dieser EnergiequelIe besonders grtindliche Unter
suchungen tiber m6gliche Auswirkungen auf die nattiriiche Umwelt wie auf die GeselI
schaft vorausgehen. Dies ist in einem gewissen Umfang in Fachkreisen wohl auch ge
schehen. Doch die politischen Entscheidungen kamen keineswegs auf der Basis ein
deutiger und einhelIiger wissenschaftlicher Einsichten zustande. Und es wurde ver
saumt, die bffentlichkeit tiber den Stand der wissenschaftlichen Kontroverse ange
messen zu informieren. Der "Dialog mit den Btirgern" tiber Kernenergie wurde erst
gesucht, als diese sich dagegen wehrten, fortwahrend vor volIendete Tatsachen gestelIt
zu werden. Kennzeichnend fUr die gegenwartige Situation ist, daB die Auswirkungen
der Kernenergie von verschiedenen Wissenschaftlern h6chst unterschiediich beurteilt
werden. In jeder Fachwissenschaft finden sich sowohl Befiirworter als auch Gegner
der Kernenergie. Beide Gruppen versichern, daB sie tiber fundierte Argumente ftir ihre
Beurteilung verfUgen. Dabei tibersehen sie leicht, daB auch jedes wissenschaftliche
Urteil von geschichtlichen, sozialen und biographischen Voraussetzungen mitgepragt
ist. Eine abstrakte Objektivitat, die unabhangig von den historischen Prozessen und
losgeI6st von der Dynamik der GeselIschaft in einem geschichtslosen Vakuum ange
siedeit ist, gibt es nicht. Deshalb geh6rt zu jedem Urteil tiber Kernenergie eine Analyse
des Standorts, von dem aus gesprochen wird.