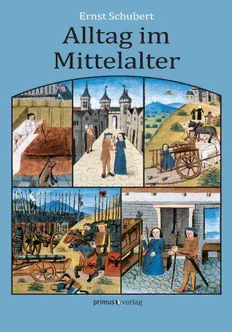Table Of ContentErnst Schubert
Alltag im Mittelalter
Natürliches Lebensumfeld
und menschliches Miteinander
Für Arno Borst
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in
und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Sonderausgabe 2012
(2., unveränderte Auflage; 1. Auflage 2002)
© 2012 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Covergestaltung: Neal McBeath, Stuttgart
Coverbild: „Schützenfest im Zunftgarten“.
Gemälde des Frankfurter Meisters, 1493.
Museum der Schönen Künste, Antwerpen. Foto: bpk Berlin
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder
der WBG ermöglicht.
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Printed in Germany
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-534-25082-0
Die Buchhandelsausgabe erscheint beim Primus Verlag
Umschlaggestaltung: Jutta Schneider, Frankfurt
Umschlagabbildung: Ausschnitt aus
Les Onze Joies de Mariage(Die elf Freuden der Ehe),
französische Buchmalerei, 1495; © akg-images
ISBN 978-3-86312-306-2
www.primusverlag.de
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): 978-3-534-72898-5 (für Mitglieder der WBG)
eBook (epub): 978-3-534-72899-2 (für Mitglieder der WBG)
eBook (PDF): 978-3-86312-796-1 (Buchhandel)
eBook (epub): 978-3-86312-797-8 (Buchhandel)
Inhalt
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ERSTER TEIL:
NATÜRLICHES LEBENSUMFELD
1. Das Klima und die Sorge um frische Luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. Der Mensch und die Erde: Das Beispiel des Waldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Urwald – „Unland“ – Kulturland. Überleben im Frühmittelalter . . . . . . . . . . . . . . . 37
Rodung: Die Veränderung von Gesellschaft, Wirtschaft und Herrschaft im Hoch-
mittelalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Der Wald in Gefahr: Holznutzung als Grundlage spätmittelalterlicher Urbani-
tät und Wirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Die ersten Maßnahmen zum Schutz des Waldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3. Das Wasser – Voraussetzung des Lebens und Grundlage der Kultur . . . . . . . . . . . . 65
Geschichte unter den Gefahren von Meer und Fluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Flüsse als Hauptstränge des mittelalterlichen Verkehrsnetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Natur und Kunst: Die Brücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Wasser als Nahrungsspender – die Fische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Die Stadt und das Wasser: Die Gaben der Natur und die Leistung der Menschen . . 86
Bürger und Umwelt: Die Entsorgung von Abfällen und Unrat . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4. Der unmittelbare Umgang mit Gottes Schöpfung: Menschen und Tiere . . . . . . . . 108
5. Umrisse des Natur- und Umweltbewußtseins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Die ersten Erfahrungen einer Veränderung der Umwelt: Der Verlust der Wildnis . . 124
Die Natur – Gottes Zeichensetzung oder von ihm verhängtes Schicksal. Gelehrte
Deutung und populäre Erfahrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Zusammenfassung und Ausblick: Ausgangs- undRahmenbedingungen eines Um-
weltbewußtseins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6 Inhalt
ZWEITER TEIL:
MENSCHLICHES MITEINANDER
1. „Deutsch reden“ – Grundlagen der Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
2. Umgangsformen: Der Alltag hinter der höfischen Etikette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Willkommen und Abschied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Der lange Weg vom „Du“ zum „Sie“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3. Direktheit: Wie beurteilen die Menschen einander? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
4. Die Beschimpfung des Mitmenschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5. Flüche und Segen: Gott und seine Heiligen im alltäglichen Umgang . . . . . . . . . . 186
6. Gefährliche Direktheit: Jähzorn und spontane Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
7. Mitleid, die Grenzen des Mitgefühls und die Schadenfreude . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
8. Die Grundlage des Umgangs: Mißtrauen und Vertrauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
9. Freundschaft, Gesellschaft, Nachbarschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
10. Die Menschenkenntnis des Mittelalters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
11. Kinder, Ehefrauen, Ehemänner: Wie ging man innerhalb der Familie miteinan-
der um? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Kinderleben und Kinderschicksal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Die Ehefrau: „Nicht Magd, sondern Genossin“? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Überlebensgemeinschaft Ehe . . . . . . . 237
Die Heirat junger Mädchen, die Hausherrschaft erfahrener Frauen . . . . . . . . . . . 241
Die Ehe als Überlebensgemeinschaft armer Leute.Der Hintergrund der Bigamie
im Mittelalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
12. Die Liebe – als Thema des Umgangs der Menschen miteinander . . . . . . . . . . . . . 248
Wurde die Liebe im 12.Jahrhundert entdeckt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Liebe und Vertragsehe – die evolutionäre Wirkung eines kirchenrechtlichen
Grundsatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Mittelalterliche Erscheinungsformen eines überzeitlichen Renommierzwangs
oder: Der Beischlaf als Mannesstolz und die Akzeptanz der Sexualität . . . . . . . 262
Inhalt 7
Entspanntes Verhältnis zur Sexualität? Die Erscheinungsformen der Obszönität 265
Die Rationalität des Liebeszaubers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Schluß: Wie ‚mittelalterlich‘ war das Mittelalter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Abbildungsnachweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405