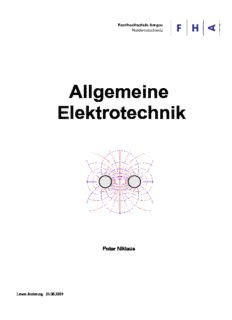Table Of ContentAllgemeine
Elektrotechnik
Peter Niklaus
Letzte Änderung: 23.06.2005
aet/nik Inhaltsverzeichnis
I
NHALTSVERZEICHNIS
LITERATUR 1
1 EINFÜHRUNG 2
1.1 Geschichtliches 2
1.2 Physikalische Grössen und Einheiten 5
1.2.1 Zahlenwert und Einheit 5
1.2.2 Grundeinheiten und abgeleitete Einheiten 5
1.2.3 Gebrauch von Gleichungen und Einheiten 6
1.2.4 Skalare und vektorielle Grössen 9
1.3 Elektrizität und ihre Wirkungen 10
1.3.1 Elektrische Ladung, elektrischer Strom 10
1.3.2 Aufbau der Materie, Ladungsträger 11
1.3.3 Leiter und Nichtleiter 12
2 GRUNDBEGRIFFE UND GRUNDGESETZE (GLEICHSTROM) 13
2.1 Spannung, Strom und Widerstand 13
2.1.1 Kraft zwischen Punktladungen (Coulomb) 13
2.1.2 Feldbegriff (Faraday) 14
2.1.3 Arbeit im Feld, Spannung und Potential 16
2.1.4 Strom 18
2.1.5 Widerstand 20
2.2 Der einfache Gleichstromkreis 24
2.2.1 Zählpfeile und Zählpfeilrichtungen 24
2.2.2 Das Ohmsche Gesetz 25
2.2.3 Die Kirchhoffschen Gesetze 26
2.2.4 Leistung und Arbeit 28
2.2.5 Elemente von Stromkreisen (Begriffe) 29
2.2.6 Einfache Schaltungen von Widerständen 31
2.2.7 Quellen, Ersatzschaltungen und Kennlinien 33
2.2.8 Zusammenschalten von Quellen 39
2.2.9 Verfügbare Quellenleistung und Leistungsanpassung 40
2.3 Analyse von Gleichstromkreisen 42
2.3.1 Anwendung von Knoten- und Maschensatz 42
2.3.2 Netzumwandlung 44
Dreieck-Stern-Umwandlung (∆→Y) und Stern-Dreieck-Umwandlung (Y→∆) 44
U-Quellen verdoppeln (Punkte mit gleichem Potential trennen) 45
I-Quellen verdoppeln (Zusätzliche Einströmungen einführen) 45
Ersatzquellen einführen 45
2.3.3 Überlagerungssatz (Superposition) 47
aet/nik Inhaltsverzeichnis
2.3.4 Knotenpotentialverfahren 49
2.3.5 Maschenstromverfahren 52
2.3.6 Dualität (und Äquivalenz) 54
3 EINFACHE RLC-NETZWERKE IM ZEITBEREICH 57
3.1 Grundgesetze im Zeitbereich 57
3.1.1 Widerstand 58
3.1.2 Spule 58
Selbstinduktion (am Beispiel der Drahtschlaufe) 59
3.1.3 Kondensator 61
3.1.4 Momentanleistung und Energie 61
3.2 Periodische Zeitabhängigkeit (Wechselgrössen) 63
3.2.1 Definitionen und Begriffe 63
3.2.2 Mittelwerte 64
Linearer Mittelwert 64
Betragsmittelwert (Gleichrichtmittelwert) 65
Effektivwert (Quadratischer Mittelwert) 65
Scheitelfaktor SF 66
Formfaktor FF 67
3.3 Ein- und Ausschaltvorgänge (Transientes Verhalten) 68
3.3.1 RC-Netzwerke 68
3.3.2 RL-Netzwerke 75
3.3.3 Übergang zum stationären Zustand 76
4 HARMONISCHE ZEITABHÄNGIGKEIT 77
4.1 Grundgesetze bei "Sinusstrom" 77
4.1.1 Widerstand 77
4.1.2 Spule 78
4.1.3 Kondensator 78
4.1.4 Momentanleistung 80
4.1.5 Gespeicherte Energie in Spule und Kondensator 81
4.2 Komplexe Zahlen 83
4.2.1 Definitionen, Begriffe und Darstellung 83
4.2.2 Rechenoperationen 86
4.3 Zeiger und harmonische Zeitabhängigkeit 87
4.3.1 Komplexer Drehzeiger 87
4.3.2 Komplexer Festzeiger (Zeiger) 87
4.3.3 Harmonische Zeitfunktion und Zeiger 87
4.4 Grundgesetze im Operatorbereich (Frequenzbereich) 89
4.4.1 Widerstand 89
4.4.2 Spule 89
4.4.3 Kondensator 89
4.4.4 Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung 91
aet/nik Inhaltsverzeichnis
4.4.5 Begriff der "Übertragungsfunktion" 94
4.5 Darstellung im Frequenzbereich 96
4.5.1 Ortskurve 96
4.5.2 Frequenzgang (Bodediagramm) 100
4.6 Mehrphasensysteme 106
4.6.1 Begriffe und Übersicht 106
4.6.2 Drehstromverbraucher 109
a) Dreieck-Schaltung, Symbol ∆ 109
b) Stern-Schaltung, Symbol Y (mit Mittelpunktsleiter) 110
c) Stern-Schaltung ohne Mittelpunktsleiter 110
4.6.3 Leistungsmessung (Wattmeter) 112
Leistungsmessung bei mehrphasigen Systemen 113
4.7 Ausgewählte Anwendungen 114
4.7.1 Resonanz, Gütefaktor und Schwingkreise 114
4.7.2 Serie-Parallel-Umformung 116
4.7.3 Serieschwingkreis und Resonanz 117
4.7.4 Der Parallelschwingkreis 120
Bestimmung des Gütefaktors Q aus der Phasensteilheit 123
Resonanzfrequenz bei verlustbehafteten Schwingkreisen 124
4.7.5 Reaktanzeintore 125
4.7.6 Leistungsanpassung mit reaktiven Elementen 125
Leistungsanpassung bei komplexer Quellenimpedanz 128
5 PERIODISCHE ZEITFUNKTIONEN UND FOURIERREIHE 130
5.1 Einführung 130
5.1.1 Vektordarstellung und Skalarprodukt 130
5.1.2 Orthogonalitätsbegriff für Funktionen 131
5.1.3 Sin- und Cos-Funktion(en) als Beispiel einer orthogonalen Basis 133
5.2 Definitionen und Beispiele 133
5.2.1 Fourierreihe mit a und b 133
k k
5.2.2 Ausgewählte Beispiele 134
5.2.3 Fourierreihe mit A und ϕ 136
k k
5.3 Anwendungen 140
5.3.1 Effektivwert (Leistung) bei mehrwelligen Zeitfunktionen 140
5.3.2 Klirrfaktor 141
5.3.3 Zeigerrechnung für mehrwellige Zeitfunktionen 141
Mittlere Leistung P, wenn u(t) und i(t) als Fourierreihe gegeben sind 144
aet/nik Inhaltsverzeichnis
7 ZWEITORE (2-TORE) 130
7.1 Einführung 130
7.2 Einteilung der 2-Tore 133
7.3 2-Tor-Gleichungen und -matrizen 140
7.4 Umrechnung von 2-Tor-Matrizen 140
7.5 Umkehrung eines 2-Tores, reziproke und symm. 2-Tore 140
7.6 Leerlauf und Kurzschluss am 2-Tor 140
7.7 Eingangsimpedanz und Übertragungsgrössen bei beliebiger Last 140
7.8 Der Gyrator 140
7.9 Gesteuerte Quellen 140
7.10 Ersatzschaltungen 140
7.11 Zusammenschalten von 2-Toren 140
7.12 Spezielle 2-Tore 140
aet/nik Literatur 1
L
ITERATUR
[1] John D. Kraus, Electromagnetics. McGraw-Hill, 1984.
[2] A. von Weiss, M. Krause, Allgemeine Elektrotechnik. Vieweg, 1984
[3] H. Fricke, P. Vaske, Grundlagen der Elektrotechnik Teil 1: Elektrische Netzwerke.
B. G. Teubner, Stuttgart, 1982.
[4] A. Führer, K. Heidemann, W. Nerreter, Grundgebiete der Elektrotechnik, Band 1:
Stationäre Vorgänge. Carl Hanser Verlag, 1994.
[5] A. Führer, K. Heidemann, W. Nerreter, Grundgebiete der Elektrotechnik, Band 2:
Zeitabhängige Vorgänge. Carl Hanser Verlag, 1994.
[6] G. Epprecht, Technische Elektrizitätslehre III, Vorlesungsmanuskript der ETH,
AMIV-Verlag, 1979.
[7] Reinhold Paul, Elektrotechnik und Elektronik für Informatiker, Band 1: Grundgebiete
der Elektrotechnik. B. G. Teubner Stuttgart 1994.
[8] H. Frohne, Karl-Heinz Löcherer, Hans Müller, Moeller, Grundlagen der Elektrotechnik.
B. G. Teubner Stuttgart 2002.
[9] P. Leuchtmann, Einführung in die elektromagnetische Feldtheorie. Pearson Studium, 2005.
aet/nik 1 Einführung 2
1 E
INFÜHRUNG
1.1 Geschichtliches
Etwa 600 Jahre v. Chr. stellte Thales von Milet (ein griechischer Mathematiker, Astronom und
Philosoph) fest, dass ein mit einem Seidentuch geriebener Bernsteinstab Funken produzierte. Der
geriebene Bernstein schien auch magische Kräfte zu haben, denn er zog Staubteilchen, Flaum und
sogar Strohhalme an. Das griechische Wort für Bernstein ist elektron, und von dort stammt unsere
Bezeichnung für Elektrotechnik, Elektron und Elektronik. Thales bemerkte auch die Kräfte zwi-
schen Steinen (natürlicher Magnetismus), die am Ort Magnesia gefunden wurden; das führte zu den
heutigen Begriffen Magnet und Magnetismus. Thales war ein Pionier für beide Gebiete Elektrizität
und Magnetismus, aber sein Hauptinteresse galt der Philosophie und war eher theoretischer als
praktischer Natur. Es dauerte 22 Jahrhunderte, bis diese Phänomene seriös und experimentell unter-
sucht wurden.
Erst William Gilbert führte etwa um 1600 n. Chr. die ersten systematischen Experimente zu
elektrischen und magnetischen Phänomenen durch; niedergeschrieben im berühmten Buch De
Magnete. Gilbert erfand das Elektroskop zur Messung elektrostatischer Effekte. Er war auch der
erste Mensch, der erkannte, dass die Erde ein riesiger Magnet ist; damit gewann er neue Erkennt-
nisse zum Kompass und zur Kompassnadel als Indikator für magnetische Kräfte.
Um 1750 experimentierte der amerikanische Wissenschaftler/Staatsmann Benjamin Franklin
mit Elektrizität und erfand den Blitzableiter. Franklin wies auch die Ladungserhaltung nach und
bestimmte, dass positive und negative Ladungen existieren. Der Franzose Charles Augustin de
Coulomb entwickelte eine empfindliche Torsionswaage, mit der er elektrische und magnetische
Kräfte mass. Etwa in dieser Zeit formulierte Karl Friedrich Gauss (deutscher Mathematiker und
Astronom) seinen berühmten Divergenzsatz, welcher das Volumenintegral mit dem Oberflächen-
integral in Beziehung setzt.
Der Italiener Alessandro Volta erfand 1800 die Spannungszelle und durch Serieschalten der
Zellen die elektrische Batterie. Mit Batterien konnten elektrische Ströme erzeugt werden und 1819
fand der dänische Physiker Hans Christian Oersted, dass eine Kompassnadel durch einen strom-
durchflossenen Draht abgelenkt wird. Damit entdeckte er, dass Elektrizität Magnetismus erzeugen
konnte (Kopplung der elektrischen und magnetischen Kräfte); früher wurden beide Effekte als un-
abhängige Phänomene betrachtet.
Im folgenden Jahr erweiterte der Franzose André Marie Ampère die Beobachtungen von
Oersted. Er erfand die kreisförmige Spule und erzeugte damit magnetische Felder; er postulierte
ebenfalls die korrekte Theorie, das Magnetfeld von Magnetmaterial (Permanentmagnet) werde
durch kleine Kreisströme im Material erzeugt. Zu dieser Zeit publizierte Georg Simon Ohm sein
nun berühmtes Gesetz über den Zusammenhang von Spannung, Strom und Widerstand. Anfänglich
wurde Ohm belächelt und verspottet und erst eine Dekade später realisierten die Forscher die Kor-
rektheit und Wichtigkeit des Ohm’schen Gesetzes.
Michael Faraday zeigte 1831 in London mit einem Experiment, dass ein änderndes magneti-
sches Feld elektrischen Strom erzeugen kann. So wie Oersted fand, dass Elektrizität Magnetismus
erzeugen kann, so entdeckte Faraday, dass Magnetismus Elektrizität erzeugen kann. Etwa gleich-
zeitig entdeckte Joseph Henry of Albany (New York) denselben Effekt unabhängig von Faraday.
Henry erfand auch den elektrischen Telegraph und das Relais.
aet/nik 1 Einführung 3
Faradays ausgedehnte experimentellen Untersuchungen erlaubten James Clerk Maxwell (Professor
an der Cambridge Universität, England) elegant und tiefgründig die gegenseitige Abhängigkeit von
Elektrizität und Magnetismus zu zeigen. In seiner klassischen Abhandlung von 1873 publizierte er
die erste vereinheitlichte Theorie von Elektrizität und Magnetismus und begründete damit die
Wissenschaft der elektromagnetischen Felder. Er postulierte, dass Licht von elektromagnetischem
Ursprung sei und dass elektromagnetische Strahlung (Wellen) mit anderer Wellenlänge auch
möglich sein müsse.
Obwohl die Maxwellgleichungen von grosser Bedeutung sind und zusammen mit den Rand-
und Kontinuitätsbedingungen die Grundlagen des modernen Elektromagnetismus bilden, waren
viele Forscher zu Maxwell’s Zeit skeptisch gegenüber seinen Theorien eingestellt. Erst 15 Jahre
Pioniere der Elektrotechnik
Name Daten Wichtiger Beitrag Einheit
Thales von Milet 636-546 v. Chr. Pionier in Elektrizität und Magnetismus
William Gilbert 1540-1603 n. Chr. Erkannte, dass die Erde ein riesiger Magnet ist Gilbert (Gb)
Benjamin Franklin 1706-1790 Nachweis der Ladungserhaltung
Charles A. de Coulomb 1736-1806 Mass elektrische und magnetische Kräfte Coulomb (C)
Karl F. Gauss 1777-1855 Divergenzsatz Gauss (G)
Alessandro Volta 1745-1827 Erfand die Spannungszellen Volt (V)
Hans C. Oersted 1777-1851 Entdeckte, dass elektrische Felder magnetische Oersted (Oe)
Felder erzeugen können
André M. Ampère 1775-1836 Erfand die Spule (Solenoid) Ampere (A)
Joseph Henry 1797-1878 Experimente zum elektrischen Telegraph Henry (H)
Georg S. Ohm 1787-1854 Formulierte das Ohm’sche Gesetz Ohm (Ω)
Michael Faraday 1791-1867 Zeigte, dass magnetische Felder elektrische Felder Farad (F)
erzeugen können
James P. Joule 1818-1889 Wies nach, dass die Wärme proportional zum Joule (J)
Quadrat des Stromes ist
James C. Maxwell 1831-1879 Gründer der Theorie der elektromagnetischen Maxwell (Mx)
Felder und Wellen
Heinrich Hertz 1857-1894 Begründer des Radio (Wellenausbreitung) Hertz (Hz)
Guglielmo Marconi 1874-1937 Praktische Anwendungen der Wellenausbreitung
Thomas A. Edison 1847-1931 Erfinder der Glühlampe und Erbauer der ersten
Energieübertragung
Nikola Tesla 1856-1943 Zeigte den praktischen Wert von Wechselstrom Tesla (T)
Albert Einstein 1879-1955 Machte die Maxwell’schen Gleichungen universell
gültig mit Hilfe seiner Relativitätstheorie
Weitere Pioniere, die mit SI-Einheiten geehrt wurden
Name Daten Wichtiger Beitrag Einheit
Isaac Newton 1642-1727 Formulierte die allgemeinen Bewegungsgesetze der Newton (N)
Mechanik und der Gravitation. Die Newton’schen
Gesetze sind für Mechanik die Grundlagen, so wie
die Maxwell’schen Gleichungen für die
Elektrotechnik
James Watt 1736-1819 Bahnbrechende Anwendungen bei der Watt (W)
Dampfmaschine
Wilhelm E. Weber 1804-1891 Leistete grundlegende Arbeiten zum Weber (Wb)
Erdmagnetismus
aet/nik 1 Einführung 4
später (1888) wurden seine Theorien durch Heinrich Hertz gerechtfertigt. Hertz war ein deutscher
Physikprofessor in Karlsruhe. Er erzeugte und detektierte elektromagnetische Wellen (Radiowellen)
mit einer Wellenlänge von etwa 5 m (Frequenz ≈ 60MHz). Mit einem Funkensender und Empfänger
zeigte er experimentell, dass Polarisation, Reflexion und Brechung von Radiowellen identisch
waren zu Licht; mit dem einzigen Unterschied der Wellenlänge.
Hertz war der Vater der Radiowellen, aber seine Erfindung blieb eine Laborkuriosität bis der
Italiener Guglielmo Marconi das Funkensystem von Hertz adaptierte und damit Informationen durch
den freien Raum schickte. Marconi erweiterte die Anlage mit einer Abstimmung, grösserer Antenne
und einem Erdungssystem; der Wechsel zu grösserer Wellenlänge erlaubte die Überbrückung
grosser Distanzen. Es war eine Weltsensation, als Marconi 1901 Radiosignale über den Atlantik
schickte. Marconi war auch ein Pionier bei der Entwicklung von Funksystemen für Schiffe. Vor der
„drahtlosen Ära“ war ein Schiff auf hoher See komplett isoliert. Es konnten sich Unglücksfälle
ereignen, völlig unbemerkt vom Festland oder von anderen Schiffen. Mit Marconi veränderte sich
diese Situation abrupt, und Funksysteme (Radio) gewannen grosse wirtschaftliche Bedeutung.
Thomas Alva Edison, der grosse amerikanische Erfinder, entwickelte mit Elektrizität und
Magnetismus praktische Anwendungen wie Telegraph, Telephon, Licht, Energieerzeugung und
Energieübertragung. Während Edison eine Vorliebe für Gleichstrom hatte, so entwickelte Nikola
Tesla eine Energieübertragung mit Wechselstrom und erfand den Induktionsmotor. Tesla entwarf
ein grosses Kraftwerk für die Niagarafälle. Als das Kraftwerk 1895 seinen Betrieb aufnahm, er-
zeugte es gleichviel Leistung, wie alle anderen Kraftwerke zusammen in den USA. Tesla war als
junger Mann von Jugoslawien nach den USA emigriert.
Frühere Denker glaubten, dass das Verrinnen der Zeit absolut sei und dass die Zeit, unab-
hängig vom Bezugssystem (ruhend oder bewegt), überall die gleiche Bedeutung habe. Eine kritische
Analyse durch Albert Einstein führte 1905 (als Angestellter des Patentamts in Bern) zu einem
neuen Konzept über das Raum-Zeitgebilde. Einstein’s Relativitätstheorie sagt uns, dass eine vom
Beobachter unabhängige Physik nicht existiert. Was uns, als ruhendem Beobachter, als ein stati-
sches elektrisches Feld erscheint, nimmt ein bewegter Beobachter zum Teil als magnetisches Feld
wahr. Bis zu Einstein wurden Gravitation und Elektromagnetismus als völlig unabhängig betrachtet,
aber Einstein’s Voraussage über die Ablenkung von Licht durch eine grosse Masse (Stern) hat sich
in der Praxis bestens bestätigt.
Einstein und andere Forscher suchten nach einer Theorie (Grand Unified Theory), die alle
fünf Kräfte der Physik vereinheitlicht (elektrische Kraft, magnetische Kraft, Gravitation, schwache
und starke Wechselwirkung), die Maxwell’schen Gleichungen wären dann nur ein Spezialfall dieser
Theorie. Bis heute wurde diese vereinheitlichte Theorie (GUT) noch nicht gefunden, aber die Arbeit
daran ist immer noch eine der grossen Herausforderungen der modernen Physik.
Wenig Gebiete sind so gründlich verstanden worden wie der Elektromagnetismus und wenig
Gebiete haben einen grösseren Einfluss auf das praktische Leben. Motoren und Generatoren, Licht
und Wärme, Telephon, Radio, Fernsehen, Datenkommunikation, Computer, Internet, Medizinelek-
tronik, Radar, Fernsteuerungen u.a. haben unser Leben komplett verändert. Hunderte von geosta-
tionären Satelliten umkreisen die Erde in etwa 36000 km Höhe. Mit Radioteleskopen (terrestrisch
und im Weltraum) erkunden wir das Universum bis an seine Grenzen, auf allen Wellenlängen (von
den kürzesten Gammastrahlen bis zu den längsten Radiowellen).
Unsere Zivilisation wurde revolutioniert durch die Anwendung der Elektrotechnik.
aet/nik 1 Einführung 5
1.2 Physikalische Grössen und Einheiten
1.2.1 Zahlenwert und Einheit
Physikalische Grössen geben die messbaren Eigenschaften physikalischer Gegenstände, Vorgänge
oder Zustände (also z.B. Länge, Zeit, Masse, Geschwindigkeit, Energie, Leistung, Kraft, Tempera-
tur, Spannung) wieder. Eine solche Grösse hat stets einen Zahlenwert (Masszahl) und eine Einheit,
die erst eine physikalische Grösse als solche auch quantitativ kennzeichnet. So kann etwa eine
Strecke l in den Einheiten Meter (m), Kilometer (km) oder gar Zoll angegeben werden, z.B. l = 1 m
= 0.001 km ≈ 39.37 Zoll. Zahlenwert und Einheit sind somit stets miteinander verknüpft sowie
voneinander abhängig. Jedes Formelzeichen (Symbol) für eine physikalische Grösse, z.B. l für
Länge, stellt ein Produkt aus Zahlenwert und Einheit dar.
Erweist sich eine Einheit als unpraktisch, weil sie einen sehr grossen oder sehr kleinen
Zahlenwert erfordert, so kann man dekadische Teile oder Vielfache der Einheit verwenden. Das
Einheitszeichen wird dann mit einem Vorsatzzeichen verwendet.
Vorsatzzeichen
Vorsatzzeichen Abkürzung Grösse
Exa E 1018
Peta P 1015 Es sind dann mit der Längeneinheit Meter (m)
Tera T 1012
Giga G 109 10000 cm = 100 m = 0.1 km
Mega M 106
Kilo k 103
Milli m 10-3
Micro µ 10-6 und mit der Spannungseinheit Volt (V)
Nano n 10-9
Pico p 10-12 0.001 V = 1 mV = 1000 µV
Femto f 10-15
Atto a 10-18
Von der Einheit einer physikalischen Grösse ist ihre Dimension zu unterscheiden. Während die
Einheit einer Grösse zu ihrer quantitativen Charakterisierung dient, gibt die Dimension ihre quali-
tative Charakterisierung an und kennzeichnet die Art der Grösse. So haben Weg, Höhe und Strecke
die gleiche Dimension einer Länge.
1.2.2 Grundeinheiten und abgeleitete Einheiten
Grund- oder Basiseinheiten können nicht aus anderen Einheiten abgeleitet werden, sie dienen viel-
mehr selbst zur Ableitung weiterer Einheiten. Das 1960 international angenommene Einheitensy-
stem (Système Internationale d’Unités, Abk. SI) besteht aus den sieben Grundeinheiten:
Basisgrösse Basiseinheit Abkürzung
Länge Meter m
Masse Kilogramm kg
Zeit Sekunde s
Stromstärke Ampere A
Temperatur Kelvin K
Stoffmenge Mol n
Lichtstärke Candela cd
Description:Page 1. Allgemeine. Elektrotechnik. Peter Niklaus. Letzte Änderung: 23.06.2005. Page 2. aet/nik. Inhaltsverzeichnis. INHALTSVERZEICHNIS.