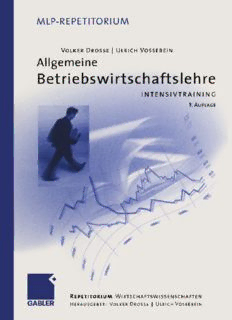Table Of ContentVolker Drosse I Ulrich Vossebein
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
I NTENSIVTRAI N I NG
Der gUnstige Preis dieses Buches wurde durch
groBzUgige UnterstUtzung der
MlP Finanzdienstleistungen AG Heidelberg
ermoglicht, die sich seit vielen Jahren als Partner der
5tudierenden der Wirtschaftswissenschaften versteht.
Ais fUhrender unabhangiger Anbieter von Finanz
dienstleistungen fUr akadem ische Berufsgruppen fUhlt
sich MLP 5tudierenden besonders verbunden. Deshalb
ist es MLP ein Anliegen, 5tudenten mit dem
MLP-REPETITORIUM Informationen zur VerfUgung zu
stellen, die ihnen fUr 5tudium und Examen groBen
Nutzen bieten, der sich schnell in Erfolg umsetzen lasst.
MLP-REPETITORI UM
I
Volker Drosse Ulrich Vossebein
Allgemeine
Betriebswi rtschaftsleh re
INTENSIVTRAINING
3. AUFLAGE
REPETITORIUM WI RTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
GABLER I
HERAUSGEBER: VOLKER DROSSE ULRICH VOSSEBEIN
PROF. DR. VOLKER DROSSE ist Fachleiter fur Controlling und Rechnungswesen
an der FOM in Essen.
PROF. DR. ULRICH VOSSEBEIN lehrt Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und
Marketing an der Fachhochschule GieBen-Friedberg und ist Unternehmensbe
rater in den Bereichen Qualitatsmanagement und strategisches Marketing.
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet uber <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
1. Auflage 1997
3., uberarbeitete Auflage Mai 2005
Aile Rechte vorbehalten
© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr.Th.Gabler/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005
Der Gabler Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media.
www.gabler.de
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschutzt. Jede Verwertung
auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags
unzulassig und strafbar. Das gilt insbesondere fUrVervielfaltigungen, Obersetzungen, Mikro
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
waren und daher von jedermann benutzt werden durften.
Gedruckt auf saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Lektorat Jutta Hauser-Fahr I Walburga Himmel
Jmschlagkonzeption independent, Munchen
ISBN-13: 978-3-409-32611-7 e-ISBN-13: 978-3-322-86756-8
DO I: 10.1007/978-3-322-86756-8
Vorwort zurn Repetitoriurn Wirtschaftswissenschaften
Das Repetitorium Wirtschaftswissenschaften richtet sich an Dozenten und
Studenten der Wirtschaftswissenschaften, des Wirtschaftsingenieurwesens
und anderer Studiengange mit wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten an
UniversiHiten, Fachhochschulen und Akademien. Es ist gleichermaBen
zum Selbststudium fur Praktiker geeignet, die auf der Suche nach einem
fundierten theoretischen Hintergrund fur ihre Entscheidungen in den Un
ternehmen sind.
In allen Banden des Repetitoriums wird besonderer Wert auf Beispiele,
Ubersichten und Ubungsaufgaben gelegt, die die Erarbeitung des jeweili
gen Lernstoffs erleichtem und das Gelemte festigen sollen. Zur Sicherung
des Lernerfolgs dienen auch die zahlreichen Tipps zur Losung der Aufga
ben, die vor einem Vergleich der eigenen Losung mit der Musterlosung
eingesehen werden sollten. Sie enthalten einerseits die Resultate der Mus
terlosungen und zum anderen Hinweise zum Losungsweg.
Dieser Grundkonzeption folgt auch die dritte Auflage der "Allgemeinen
Betriebswirtschaftslehre". 1m Vergleich zur zweiten Auflage wurde insbe
sondere das Kapitel tiber die Rechtsformen den neuen gesetzlichen Rege
lungen angepasst. Dartiber hinaus wurde das gesamte Buch einer kritischen
Durchsicht unterzogen.
Ftir Anregungen, die der weiteren inhaltlichen und didaktischen Verbesse
rung des Repetitoriums dienen, sind wir dankbar.
Die Herausgeber
Volker Drosse Ulrich Vossebein
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ................................................................................................ 1
2. Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre ............................................ 3
2.1 Griinde fiir wirtschaftliches Handeln ................................................ 3
2.1.1 Bedtirfnis, Bedarf, N achfrage .................................................. 3
2.1.2 Wirtschaftliche Gtiter ............................................................... 5
2.1.3 Das okonomische Prinzip ........................................................ 6
2.2 Trager von Volkswirtschaften ........................................................... 8
2.3 Der Einfluss des Wirtschaftssystems ............................................... 10
2.4 Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft ...................................... 12
2.4.1 Anforderungen an eine Wissenschaft .................................... 12
2.4.2 Erkenntnisgewinnung in der Betriebswirtschafts-
lehre ........................................................................................ 14
2.4.3 Nachbarwissenschaften .......................................................... 15
2.5 Die Geschichte der Betriebswirtschaftslehre .................................. 16
Ubungsaufgaben zum 2. Kapitel.. ............................................................... 18
3. Grundbegriffe ....................................................................................... 22
3.1 Betriebliche Strom-und BestandsgroBen ........................................ 22
3.1.1 Auszahlungen und Einzahlungen .......................................... 24
3.1.2 Ausgaben und Einnahmen ..................................................... 25
3.1.3 Aufwendungen und Ertrage ................................................... 26
3.1.4 Kosten und Leistungen .......................................................... 28
3.2 Bewertung des wirtschaftlichen Handelns ...................................... 31
3.2.1 Produktivitat ........................................................................... 32
3.2.2 Wirtschaftlichkeit. .................................................................. 33
3.2.3 Rentabilitat ............................................................................. 34
3.2.4 Liquiditat ................................................................................ 36
Ubungsaufgaben zum 3. Kapitel.. ............................................................... 39
4. Unternehmensgriindung ...................................................................... 44
4.1 Untemehmensziele als Entscheidungsproblem ............................... 44
4.1.1 Zieldimensionen ..................................................................... 44
vn
4.1.2 Einflussfaktoren auf die Zielbildung ..................................... 49
4.2 Gegenstand der untemehmerischen TatigkeiL ............................... 51
4.2.1 Eigen-und Marktanalyse ....................................................... 51
4.2.2 Innovation oder Me-too-Produkt ........................................... 53
4.3 Standortwahl .................................................................................... 55
4.3.1 Standortfaktoren ..................................................................... 56
4.3.2 Intemationale Standortfaktoren ............................................. 59
4.3.3 Bestimmung des optimalen Standorts ................................... 61
Ubungsaufgaben zum 4. Kapitel.. ............................................................... 63
5. Rechtsformen ........................................................................................ 67
5.1 Entscheidungskriterien bei der Rechtsformenwahl ......................... 68
5.1.1 GriindungserfordernisselRechtsgestaltung ............................ 69
5.1.2 Leitungsbefugnisse ................................................................ 69
5.1.3 Gewinn-Nerlustbeteiligung und Besteuerung ...................... 70
5.1.4 AuBenfinanzierungsmoglichkeiten ........................................ 70
5.1.5 Vorschriften zum Jahresabschluss ......................................... 70
5.1.6 Beschrankungen bei der Rechtsformenwahl ......................... 71
5.2 Einzeluntemehmen .......................................................................... 72
5.3 Personengesellschaften .................................................................... 75
5.3.1 Gesellschaft des btirgerlichen Rechts (GbR) ......................... 75
5.3.2 Offene Handelsgesellschaft (OHG) ....................................... 77
5.3.3 Kommanditgesellschaft (KG) ................................................ 79
5.3.4 Stille Gesellschaft .................................................................. 81
5.4 Kapitalgesellschaften ....................................................................... 83
5.4.1 Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) ................... 83
5.4.2 Aktiengesellschaft (AG) ........................................................ 88
5.4.3 Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ......................... 94
5.5 Steuerliche Behandlung von Personen-und Kapital-
gesellschaften ................................................................................... 96
5.6 Sonder-und Mischformen ............................................................... 99
5.6.1 Genossenschaft ...................................................................... 99
5.6.2 GmbH & Co. KG ................................................................. 102
5.6.3 Doppelgesellschaften ........................................................... 105
5.7 Bestimmung der optimalen Rechtsform ........................................ 106
Ubungsaufgaben zum 5. Kapitel.. ............................................................. ll0
VIII
6. Unternehmensverbindungen ............................................................. 115
6.1 Differenzierungskriterien .............................................................. 115
6.2 Kooperationsformen ...................................................................... 118
6.2.1 Interessengemeinschaften .................................................... 118
6.2.2 Verblinde .............................................................................. 118
6.2.3 Arbeitsgemeinschaften und Konsortien .............................. 119
6.2.4 Kartelle ................................................................................. 120
6.2.5 Joint-Ventures ...................................................................... 122
6.2.6 Franchising ........................................................................... 123
6.3 Konzentrationsformen ................................................................... 123
6.3.1 Verbundene Untemehmen .................................................. 124
6.3.2 Fusion ................................................................................... 125
Ubungsaufgaben zum 6. Kapitel.. ............................................................. 126
7. Produktionsfaktoren .......................................................................... 129
7.1 Potenzialfaktoren ........................................................................... 130
7.1.1 Objektbezogene Arbeit ........................................................ 130
7.1.1.1 Personenbezogene Einflussfaktoren ....................... 131
7.1.1.2 Entgelt ..................................................................... 132
7.1.1.3 Umfeldbezogene Faktoren ...................................... 136
7 .1.2 Betriebsmittel ....................................................................... 137
7.2 Verbrauchsfaktoren ........................................................................ 139
7.3 Dispositiver Faktor ........................................................................ 140
7.3.1 Zielsetzung ........................................................................... 141
7.3.2 Planung ................................................................................. 143
7.3.3 Entscheidung ........................................................................ 144
7.3.4 Realisierung ......................................................................... 147
7.3.5 Kontrolle .............................................................................. 150
7.3.6 Fiihrung ................................................................................ 150
7.4 Zusatzfaktoren ............................................................................... 152
Ubungsaufgaben zum 7. Kapitel.. ............................................................. 153
Tipps zur Losung der Ubungsaufgaben .................................................... 156
Musterlosungen zu den Ubungsaufgaben ................................................. 159
IX
Literaturempfehlungen .............................................................................. 172
Stichwortverzeichnis ................................................................................. 173
x
Description:Prof. Dr. Volker Drosse ist Fachleiter für Controlling und Rechnungswesen an der FOM in Essen. Prof. Dr. Ulrich Vossebein lehrt Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing an der Fachhochschule Gießen-Friedberg und ist Unternehmensberater in den Bereichen Qualitätsmanagement und strategisch