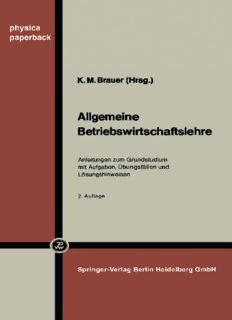Table Of ContentBrauer (Hrsg.), Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Anleitungen zum Grundstudium
mit Aufgaben, Übungsfallen und Lösungshinweisen
von
Reinhard Baumgarten, Kar! M. Brauer, Jürgen Firnkorn, Wolfgang Haas,
Dieter Mirow, Brun Osterloh, Wilhelm Schreiterer, Gunnar Streidt,
Axel B. Tübke, OlafWeiß
herausgegeben von
Karl M. Brauer
2. Auflage
Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
1971
ISBN 978-3-7908-0106-4 ISBN 978-3-662-41499-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-41499-6
Das Buch oder Teile davon dii.rfen weder photomechanisch, elektromsch noch in irgend einer anderen Fonn ohne
schriftliche Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden
©
Springer-Ver1ag Berlin Heide1berg 1971
UrsprUnglich erschienen bei Physica-Ver1ag. Rudo1fLiebing KG.WUrzburg 1971.
Satz: Maschinensatzbetrieb Hagedorn. 1 Berlin·Tempelhof
VORWORT
Das Grundstudium der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre hat zum
Ziel, den Studierenden der Betriebswirtschaftslehre, des Wirtschafts
ingenieurwesens, der Volkswirtschaftslehre und zunehmend auch einer
Reihe weiterer Disziplinen die Möglichkeit zu bieten, sich ein elementa
res Wissen über betriebswirtschaftliche Sachverhalte und Probleme an
zueignen. Es soll Gelegenheit geben, Gegenstand und Methoden der
Betriebswirtschaftslehre kennenzulernen und damit Voraussetzungen
für eine begabungs- und interessenorientierte Wahl der wirtschafts
wissenschaftlichen Spezialgebiete im weiteren Studium schaffen. Der
im Rahmen dieser Zielsetzung zu behandelnde Stoff hat in den letzten
Jahrzehnten an Umfang und Schwierigkeit zugenommen. Das führte
zusammen mit dem starken Anwachsen der Studentenzahl zur Entwick
lung neuer akademischer Lehrformen. Ein erstes Experiment an der
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität
Berlin [vgl. GüMBEL] und die Erfahrungen, die. danach von Hochschul
lehrern, wissenschaftlichen Mitarbeitern, Tutoren und Studenten mit
Weiterentwicklungen gemacht wurden, veranlaßten die Verfasser, bei
ihrer Arbeit von folgender Konzeption auszugehen:
Die betriebswirtschaftliehen Grundtatsachen und Fragestellungen kön
nen nicht mehr durch Massenvorlesungen und -übungen mit mehreren
hundert Teilnehmern vermittelt werden, sondern müssen durch das
Studium der elementaren Literatur selbständig erarbeitet werden. Dabei
muß der Studierende durch schriftliche Anleitungen, genaue Literatur
angaben, laufende Beratung und die Möglichkeit der unmittelbaren
Überprüfung seines Wissens durch Aufgaben und kleine Fälle unter
stützt werden. Er ist dann in der Lage, sich in den darauffolgenden von
Assistenten und Tutoren geleiteten Übungen und Tutorien in kleinen
Gruppen aktiv an der Diskussion betriebswirtschaftlicher Probleme zu
beteiligen.
Ein solches Studium unterscheidet sich also grundlegend von der Me
thode, die klassischen Vorlesungen durch Arbeit in Tutorengruppen be
gleiten zu lassen [vgl. z. B. ACKERMANN]. Es wird ausschließlich als
systematisches Literaturstudium mit der selbständigen Bearbeitung von
Aufgaben und der Diskussion in kleinen Gruppen betrieben und ist als
eigenständige Lehrveranstaltung in Studienplänen und Prüfungsord-
6 Vorwort
nungen verankert. Das erforderte die Ausarbeitung spezieller Arbeits
unterlagen, die in diesem Buch wiedergegeben sind. Auf bereits existie
rende Fragen-, Aufgaben- und Fallsammlungen zur Betriebswirtschafts
lehre [vgl. z. B. ANTHONY, ÜÜMBEL, JACOB, ScHEIBLER] konnte nicht zu
rückgegriffen werden, da die Arbeitsunterlagen in Konzeption und Um
fang streng auf wenige, aber in großer Zahl für die Studenten bereit
gestellte Lehrbücher abgestimmt werden mußten. Dieses Buch eignet
sich daher auch für ein selbständiges Literaturstudium der Grundlagen
neuerer Betriebswirtschaftslehre außerhalb des Lehrbetriebes an einer
Uni versi tä t.
Der Einteilung des in diesem Buch dargelegten Stoffes in die Teile I bis
IV liegt seine Behandlung in vier einsemestrigen Kursen zugrunde. An
der Erarbeitung der Studienanleitungen, Übungsfälle und -aufgaben für
die einzelnen Teile haben mitgewirkt: Dipl.-Kfm. Baumgarten (I), Dr.
rer. oec. Brauer (I bis IV), Dipl.-Kfm. Firnkorn (I und III), Dipl.-Ing.
Haas (II und IV), Dipl.Ing. Mirow (II und IV), Dipl.-Ing. Osterloh (III),
Dipl.-Ing. Schreiterer (II und IV), Dipl.-Ing. Streidt (I und III), Dipl.
Kfm. Tübke (I und III) und Dipl.-Ing. Weiß (I und III). Die leitende
und koordinierende Tätigkeit oblag Dr. Brauer.
Die schwierigen und umfangreichen Schreibarbeiten wurden von Frau
Irmgard Friedrich ausgeführt, während Herr cand. ing. Carsten Smalla
die Zeichnungen und graphischen Darstellungen anfertigte. Die Verfasser
danken ihnen dafür.
Berlin, im Juli 1970
Die Verfasser
INHALTSVERZEICHNIS
1 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
11 Unternehmungsformen, -Organisation und -ziele . . . . . . . . . . 11
111 Einfache Unternehmungsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
112 Komplexe Unternehmungsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
113 Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
114 Organisation, Ziele der Unternehmung . . . . . . . . . . . . . . . 26
12 Finanzierungstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
121 Kapitalbedarf und Kapitalbeschaffung . . . . . . . . . . . . . . . 35
122 Kapitalbeschaffung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
123 Finanzielles Gleichgewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
124 Finanzierung und Rechtsformen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
13 Investitionstheorie und -rechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
131 Kostenvergleichsrechnung, Amortisationsrechnung . . . . 50
132 Rentabilitätsrechnung, MAPI-Verfahren . . . . . . . . . . . . . 55
133 Kapitalwertmethode, Methode des internen Zinssatzes. . 60
134 Vereinfachte dynamische Verfahren, Optimales Investi-
tionsbudget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
14 Wiederholungen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
141ZudenAbschnitten111 bis122 ..................... 75
142 Zu den Abschnitten 123 bis 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
143 Zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre I. . . . . . . . . . . . 88
15 Hinweise zur Lösung der Übungsfälle und -aufgaben zur All-
gemeinen Betriebswirtschaftslehre I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
21 Theorie der Produktionsfaktoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
211 Produktionsfaktor Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
212 Produktionsfaktor Betriebsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
213 Produktionsfaktor Werkstoff und Produktionsfaktor Be-
triebsführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
22 Produktions- und Kostentheorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
221 Produktionsfunktionen vom Typ A (Ertragsgesetz) . . . 155
222 Produktionsfunktionen vom Typ B (Verbrauchsfunktio-
nen, GuTENBERG-Produktionsfunktionen). . . . . . . . . . . . . 158
223 LEONTIEF-Produktionsfunktionen.................... 161
8 Inhaltsverzeichnis
224 Kosten bei zeitlicher, intensitätsmäßiger und quantitati-
ver Anpassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
225 Vergleichende Darstellung typischer Produktionsfunk-
tionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
23 Absatztheorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
231 Absatzpolitische Instrumente, Marktformen . . . . . . . . . . 168
232 Preispolitik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
233 Produktgestaltung, Absatzmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
234 Werbung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 9
24 Wiederholungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
241 Zu den Abschnitten 211 bis 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
242 Zu den Abschnitten 224 bis 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
243 Zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre II........... 191
25 Hinweise zur Lösung der Übungsfälle und -aufgaben zur All
gemeinen Betriebswirtschaftslehre /I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
3 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
31 Grundlagen der Kostenrechnung........................ 233
311 Aufgaben und Grundbegriffe der Kostenrechnung . . . . . 233
312 Kostenarten und -stellenrechnung, Innerbetriebliche
Leistungsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
313 Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung..... 243
314 Kostenträgerzeitrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
32 Kostenrechnungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
321 Überblick über die Kostenrechnungssysteme . . . . . . . . . . 254
322 Probleme der Plankostenrechnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
323 Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis . . . . . . . . . . . . . 265
324 Grenzplankostenrechnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
33 Kostenrechnung und Planungsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
331 Kritische Werte für die kurzfristige Planung. . . . . . . . . . . 279
332 Kurzfristige Produktionsprogrammplanung. . . . . . . . . . . 283
34 Wiederholungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
341 Zu den Abschnitten 311 bis 322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
342 Zu den Abschnitten 323 bis 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
343 Zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre III . . . . . . . . . . 294
35 Hinweise zur Lösung der Übungsfälle und -aufgaben zur All
gemeinen Betriebswirtschaftslehre /I[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
4 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
41 Bewertungsprobleme und Bilanzauffassungen . . . . . . . . . . . . . . 333
411 Theorie der Bewertung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Inhaltsverzeichnis 9
412 Praxis der Bewertung.............................. 338
413 Bilanzauffassungen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
42 Bilanzierung nach Handelsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
421 Die Aktivseite der Handelsbilanz.................... 347
422 Die Passivseite der Handelsbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
423 Gewinn- und Verlustrechnung, Geschäftsbericht....... 355
43 Konzern- und Sonderbilanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
431 Konzernbilanzen.................................. 357
432 Sonderbilanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
433 Steuern und Steuerbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
44 Wiederholungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
441 Zu den Abschnitten 411 bis 422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
442 Zu den Abschnitten 423 bis 433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
443 Zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre IV . . . . . . . . . . 375
45 Hinweise zur Lösung der Übungsfälle und -aufgaben zur All-
gemeinen Betriebswirtschaftslehre IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
1 ALLGEMEINE
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I
11 Unternehmungsformen, -Organisation und -ziele
111 Einfache Unternehmungsformen
Gegenstand dieses Abschnittes sind die "einfachen" Unternehmungs
formen. Zusammen mit den "komplexen" Unternehmungsformen (Un
ternehmungszusammenschlüssen), die im Abschnitt 112 behandelt wer
den, bilden sie das Untersuchungsfeld des ersten Teiles des Kapitels 11.
Wirtschaften vollzieht sich in "Betrieben" bzw. "Unternehmungen".
Diese Termini werden hier synonym gebraucht.
Mit den Formen der Unternehmungen befassen sich Betriebswirt
schaftslehre und Rechtswissenschaft. Je nachdem, ob mehr auf die wirt
schaftlichen oder auf die rechtlichen Tatbetände abgestellt wird, verwen
det man die Bezeichnungen "UNTERNEHMUNGSFORMEN" oder
"RECHTSFORMEN". Da diese Termini nur eine unterschiedliche
Sichtweise ausdrücken, werden sie gleichbedeutend verwendet, wenn
gleich der wirtschaftliche Aspekt ( = Unternehmungsform) im Vorder-
grund steht. ·
Die rechtliche Abgrenzung der verschiedenen Unternehmungen ge
geneinander ist primär eine Angelegenheit der Rechtswissenschaft. Für
die Betriebswirtschaftslehre ist sie jedoch insofern von Interesse, als sich
aus den bestehenden Rechtsnormen eine Anzahl betriebswirtschaftlicher
Probleme ergeben, wie z. B. Fragen der Organisation, der Finanzierung
u.a. So hängt das Ausmaß der Eigen- bzw. Fremdfinanzierung wesent
lich davon ab, in welcher Rechtsform die Unternehmung geführt wird.
Durch die Wahl einer bestimmten Rechtsform unterwerfen die Be
triebsgründer bzw. die Unternehmungsführung die Unternehmung be
stimmten Vorschriften. Sie stehen damit vor dem Problem, unter meh
reren möglichen Rechtsformen diejenige auszuwählen, die hinsichtlich
ihrer Ziele die "optimale" darstellt.
Diese Wahl setzt die Kenntnis der in Frage kommenden Rechtsformen
und deren Merkmale voraus, die daher in den ersten sieben Aufgaben
behandelt werden: