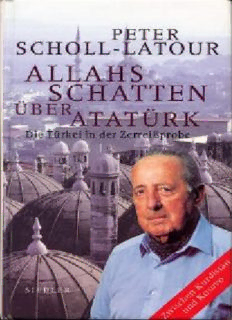Table Of ContentPeter Scholl-Latour
Allahs Schatten über Atatürk
Die Türkei in der Zerreißprobe
Das Buch bietet einen Überblick über die verschiedenen Gruppierungen in der Türkei, mit denen der
türkische Staat immer wieder konfrontiert wird. Dabei spannt der Autor einen Bogen von der PKK über
islamistische politische Parteien, wie die "Tugend-Partei" bis zu anderen religiösen Gruppierungen, wie z.B
den Aleviten. Ausführlich geht er auf die unterschiedlichen Bewegungen ein, die sich innerhalb der
türkischen Volksgruppe in der Bundesrepublik aktiv entwickelt haben und die Deutschen unmittelbar
betreffen.
ISBN 3-88680-630-8
© 1999 by Siedler Verlag
Karten: Adolf Böhm, München
Schutzumschlag: Rothfos + Gabler, Hamburg
Dieses E-Book ist nicht zum Verkauf bestimmt!!!
Klappentext
Die inneren Probleme der Türkei - man denke nur an den Kurden-Aufstand -
finden ihren Niederschlag in der deutschen Innenpolitik. Darüber hinaus sind die
deutschen Soldaten im Kosovo auf einem Territorium eingesetzt, das 500 Jahre
lang dem Osmanischen Reich angehörte. Ob die Türkei Bestandteil der
Europäischen Union wird, ist heute ungewisser denn je. Aber das Schicksal
dieses befreundeten Landes ist mit der Zukunft Deutschlands auf vielfältige
Weise verknüpft. Peter Scholl-Latour, der bereits 1951 seine ersten Türkei-
Reportagen verfaßte, geht der Auseinandersetzung zwischen säkularem
Kemalismus und islamischer Wiedergeburt nach. Im Sommer 1998 hat er
intensiv im kurdischen Aufstandsgebiet recherchiert, im Sommer 1999
erkundete er die chaotische Situation im Kosovo, wo er auch auf türkische
Soldaten stieß.
Avantpropos
Wer über die Türken und über die Türkei schreibt - nicht akademisch und
abstrakt, sondern aus eigenem Erlebnis und mit persönlicher Anteilnahme -, läßt
sich auf ein Wagnis ein. Ich bin mir dessen voll bewußt. Hier handelt es sich ja
um ein Land, das uns nicht nur unmittelbar als Nachbar Europas angeht; ein
beachtlicher Teil der deutschen Bevölkerung ist bereits türkischen Ursprungs. So
wird der Kulturkampf zwischen säkularen »Aufklärern« und engagierten
KoranGläubigen, der sich unter vielfältigen Aspekten der gesamten islamischen
»Umma« bemächtigt hat, auch auf deutschem Boden ausgetragen. Die
Beobachtungen, die ich im Aufstandsgebiet Südost-Anatoliens sammelte,
werden auf Zustimmung oder Widerspruch bei einer halben Million Kurden
stoßen, die in der Bundesrepublik leben. Am Ende dieses Buches widme ich dem
Kosovo-Konflikt breiten Raum. Das hat seine Gründe. Die deutschen Soldaten
der KFOR und ihre Verbündeten bewegen sich dort in einem unsicheren
Territorium, dessen Problematik nur vor dem Hintergrund seiner langen
osmanischen Geschichte gedeutet werden kann. P. S.-L. Aus Gründen der
Diskretion und vor allem der Sicherheit für die Betroffenen habe ich in manchen
Fällen die Namen meiner Gesprächspartner und den Ort unseres
Zusammentreffens verändert. Bei der Niederschrift fremder Begriffe und Namen
habe ich im Türkischen, das sich des lateinischen Alphabets bedient, gewisse
Eindeutschungen - wie »Hodscha« statt »Hoca« - berücksichtigt. Soweit es sich
um arabische Wörter handelt, die vom Türkischen übernommen und modifiziert
wurden - wie »dinvedevlet« statt »din wa dawla« -, habe ich, wo immer möglich,
der Originalform den Vorrang gegeben und mich an die übliche, allgemein
verständliche Transkription gehalten. Für die Anhänger des weit verbreiteten
Derwisch-Ordens zum Beispiel, die man in der Türkei als »Naksibendi«
bezeichnet, wurde die ursprüngliche Schreibweise »Naqschbandi« beibehalten.
INHALT
Avantpropos
Einstimmung
Die armen Leute von Yakub Abdal
Kurdistan Der türkische Alptraum
Auf Vorposten in Hakkari
Unter dem strengen Blick Khomeinis
Heroinstadt Yüksekova
Orientalische Jakobiner
Wenig Raum für Kompromisse
Der Scheiterhaufen Abrahams
Auf den Spuren Helmuth von Moltkes
Karawanserei der Seidenstraße
Die letzten Christen
Der Fluch der »Rotköpfe«
Haci Bektas am Bosporus
Ein armenischer Friedhof
Die PKK greift an
Selim der Grausame
Die Islamisten »Unsere Minaretts sind unsere Lanzen«
»Schleier ist Würde«
Ein kemalistischer Playboy
Im Viertel »Neu-Bosnien«
Der Wolf hat Kreide gefressen
Der »Wunderknabe« Turgut Özal
An den Quellen der Mystik
»... und Atatürk ist ihr Prophet«
Türken in Deutschland Halbmond über Berlin
Öcalan - Held oder Verräter?
»Tag der offenen Moschee«
Ramadan in Bonn
Diaspora an der Donau
Die Aleviten Tanz der Schamanen
Eine anatolische Jeanne d'Arc
Von der Adria zum Baikal-See
Der böse Mann » Avropa«
Kosovo Die Rache der Janitscharen
Schwarz-Rot-Gold in Prizren
»Madeleine Albright's War«
Derwische gegen den Sultan
Ein serbischer Groß-Vezir
Intrigen im Grand Hotel
Die Brücke über den Ibar
Die Türken sind wieder da
Zeittafel
Anhang
Kartenmaterial
Einstimmung
Die armen Leute von Yakub Abdal
Yakub Abdal, 5. Dezember 1998
Atatürk kam nicht bis Yakub Abdal. Dabei ist das Dorf nur zehn Kilometer von
der auswuchernden Metropolis Ankara entfernt. Aber Yakub Abdal gehört einer
anderen Epoche an, ist in anatolischer Zeitlosigkeit erstarrt. Wir sind eben von
der vierspurigen Autobahn abgezweigt, die nach Samsun am Schwarzen Meer
führt, und schon umfängt uns die Steppe, baumlos, schwermütig, schier
unendlich. Im fernen zentralasiatischen Kasachstan am Rande der Kisylkum-
Wüste sieht es nicht anders aus. Das Dorf hat die Lehmkaten von einst durch
unverputzte Ziegelmauern oder hastig verschalte Zementhäuser ersetzt. Mehr als
fünfhundert Menschen leben nicht in Yakub Abdal. Es hat geregnet, und wir
waten in tiefem Schlamm. Am düsteren Himmel treibt der eisige Wind
Wolkenfetzen nach Süden, zerrt an den verkümmerten Ästen einer entblätterten
Pappel. Am Horizont, wo die Sonne versinkt, flackert ein Karree aus Rot und
Gold. Die Grasfläche des hügeligen Umlandes ist schmutzig gelb mit schwarzen
Flecken wie das Fell einer Hyäne. Es begegnen uns nur wenige Menschen im
buckligen Labyrinth der Gassen. Die Frauen hüllen den Kopf in weitfallende
Schleier und tragen noch die geblümte Pluderhose aus osmanischer Zeit. Sie
huschen an den Fremden wie Schemen vorbei. Die Mädchen wenden das bleiche
Gesicht zu Boden, hüten sich, den Eindringlingen auch nur einen Blick zu
schenken. Ebenso teilnahmslos drängt das Vieh einzeln streunende Kühe, Schafe
und Ziegen - an uns vorbei. Die Kinder hingegen beäugen uns unbefangen mit
Neugier und mit Respekt. Wir haben einen älteren Mann in einem unförmigen
Mantel angesprochen. Er stellt sich uns bereitwillig als Lotse zur Verfügung.
Seine Augen blicken freundlich aus dem stoppelbärtigen, verhärmten
Hirtenantlitz. »Sie sind an einem besonderen Tag gekommen«, erklärt er meinem
Begleiter Hayrettin, der an der Universität Köln an seiner Promotion in
Politologie arbeitet. »Es werden heute in Yakub Abdal zwei Hochzeiten
gefeiert.« Tatsächlich klingt jetzt die Festmusik zu uns herüber. Ein Trommler
und ein Flötenspieler kommen uns entgegen, als würden sie eine Beerdigung
anführen. Die beiden sind erbärmlich gekleidet. Die Paukenschläge begleiten die
wimmernden Töne eines primitiven Blasinstruments aus Schilf oder
Bambusrohr. Heiterkeit kann dabei nicht aufkommen. Mich erinnert diese
jammernde Weise an das Ächzen des »Kagni«, jenes für Anatolien seit der
Frühzeit der kriegerischen Hethiter typischen Ochsenkarrens, der mit vollen,
scheibenförmigen Holzrädern ausgestattet ist und bei meinem ersten Türkei-
Besuch im Sommer 1951 die ländlichen Verbindungswege beherrschte. Aber
noch ganz andere, historische Reminiszenzen weckt die Kakophonie der
Hochzeitsmusikanten. Als Mehmet II., der Eroberer, im Jahr 1453 zum
siegreichen Sturm auf Konstantinopel ansetzte, hatten die christlichen
Einwohner von Byzanz wochenlang einer ähnlich barbarischen und monotonen
Totenklage von tausend Pauken und Blasinstrumenten lauschen müssen, die
damals mächtig und bedrohlich aus den Zeltlagern der Janitscharen zu ihnen
herüberklangen wie die Kunde ihres unvermeidlichen Untergangs. Der
Einheimische im zerbeulten Mantel lädt uns zum Hochzeitsmahl ein. Wir seien
als Gäste hochwillkommen, und unsere Gegenwart werde als Ehre betrachtet.
Aber vorher will er uns noch die wenigen Sehenswürdigkeiten seines Dorfes
zeigen. Immerhin kann er eine bescheidene Ambulanzstation des Roten
Halbmondes vorweisen und eine von privaten Stiftungen finanzierte Schule. Auf
der grob getünchten Mauer dieser Behelfskonstruktion blickt das Porträt des
Staatsgründers Atatürk überdimensional und heroisch auf den wuchtigen Rohbau
der nahen, noch unvollendeten Moschee. Aber man lasse sich nicht täuschen.
Der »Vater der Türken«, der Held von Gallipoli, der Schöpfer der modernen
Republik von Ankara wird zwar in Yakub Abdal gebührend und untertänig
geehrt; heimisch ist Atatürk mitsamt seiner westlichen Staatsdoktrin hier nicht
geworden. Auf der Zementwand der Schule triumphiert er nicht als jener
stürmische Erneuerer, der seinen türkischen Nationalstaat dem
islamischosmanischen Schlendrian entreißen und die laizistische Republik auf
europäische Sitten, auf europäische Ordnung ausrichten wollte. An dieser Stelle
thront er gewissermaßen als Wiedergeburt sultanischosmanischer Macht, als
»Gazi«, als siegreicher Feldherr des Islam, der die griechischchristlichen
Ungläubigen, die 1922 mit ihrer Armee bis in die Nachbarschaft von Yakub
Abdal vorgedrungen waren, aus Anatolien vertrieb. Ihm wird hier, von der
autoritätsgewohnten, einfältigen Landbevölkerung als dem »ebedi chef« - man
beachte die semantische Mischung aus Arabisch und Französisch - als
»unsterblichem Führer« gehuldigt, als dem neuen Padischah und nicht als dem
Verkünder einer schwer verständlichen, säkularen Ideologie. Die anatolische
Republik, die Mustafa Kemal Pascha, wie der aus Saloniki gebürtige General bis
zum Jahr 1934 genannt wurde, aus der Konkursmasse des osmanischen
Imperiums als Nationalstaat hinüberrettete, mußte dem einfachen Bauernvolk
Anatoliens fremd und verwirrend erscheinen. Auf ähnliche Weise waren ja auch
die gebieterischen Anordnungen und Edikte des Obersten Herrn am Bosporus in
den vergangenen Jahrhunderten unterwürfig akzeptiert und bauernschlau
umgangen worden, ob es sich nun um das »Timar«-System der Sipahi-Pfründe
handelte, mit dem Mehmet II. einst die vorherrschende Agrarordnung
revolutionierte, oder um das ausgeklügelte Rechtssystem, das Süleyman der
Prächtige, »Kanuni« oder Gesetzgeber von seinen Untertanen genannt, erließ. Im
anatolischen Hochland war auch die halbherzige Modernisierung der
»Tanzimat« verhallt, die zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts eine verfrühte
Hoffnung auf radikale Neuerungen der Pforte weckte, und auch jener turbulente
Aufbruch der Jungtürken, die unter der französischen Parole »Union et Progrès«
um die letzte Jahrhundertwende angetreten waren, nationalistischer Vorläufer des
von Anfang an militärisch ausgerichteten Kemalismus. Wer hatte unter diesen
armseligen Bauern, Hirten und Pächtern jemals die erlauchten »Firmane« des
Sultans und Kalifen zu diskutieren gewagt, wo es doch relativ einfacher war,
ihnen mit gebeugtem Rücken und in devoter Scheinanpassung auszuweichen?
Das stolze Credo Atatürks, das in jeder türkischen Ortschaft anzutreffen ist, ist
auch in Yakub Abdal in kräftigen lateinischen Lettern unter sein Bildnis
gepinselt: »Ne mutlu Türküm diyene« - in der Übersetzung: »Welches Glück
wird dem zuteil, der sagen kann, ich bin ein Türke!« -, und dennoch bleiben wir
bei der Feststellung, zu der uns der auf Eboli und auf Christus bezogene
Buchtitel Carlo Levis angeregt hat: Atatürk ist wohl nicht bis Yakub Abdal
gelangt. Seine Formel: »Es gibt verschiedene Kulturen, aber es gibt nur eine
Zivilisation, die europäische«, hat hier nie Gültigkeit gewonnen. Unser
dörflicher Führer, der sich unter dem Namen Tengiz vorgestellt hat, nimmt
Hayrettin bei der Hand und weist auf ein altes, bescheidenes Gebetshaus - viel
weniger anspruchsvoll als die neue »Cami« aus rohem Beton, die am Dorfrand
mit ragenden Minaretts auf ihre Vollendung wartet. Diese moderne Moschee
wurde durch freiwillige Zuwendungen der Gläubigen oder durch Gaben reicher
privater Spender errichtet, aber ihr Imam oder Hodscha, ihr Vorbeter oder
Prediger, wird vom Regierungsamt für Religiöse Angelegenheiten in Ankara
benannt. Er erhält von dieser kemalistischislamischen Behörde auch sein Salär.
Sogar der Text seiner religiösen Ermahnungen und Aufrufe wird ihm von dort
rigoros vorgeschrieben. Da wirkt das grün bemalte Holzhäuschen mit seinem
windschiefen Turm unter dem Halbmond, das seit Jahrhunderten als Grabstätte
eines heiligen Mannes die Pilger anzieht, weit inniger und weihevoller. Wir sind
an das Grab, an die »Türbe« des frommen »Pir« aus dem Mittelalter getreten,
und meine beiden muslimischen Begleiter erstarren mit erhobenen Händen zur
Rezitation der Eröffnungssure des Koran, der »Fatiha«. Über den Sarkophag ist
ein grünes Tuch gebreitet mit dem islamischen Glaubensbekenntnis, daß es